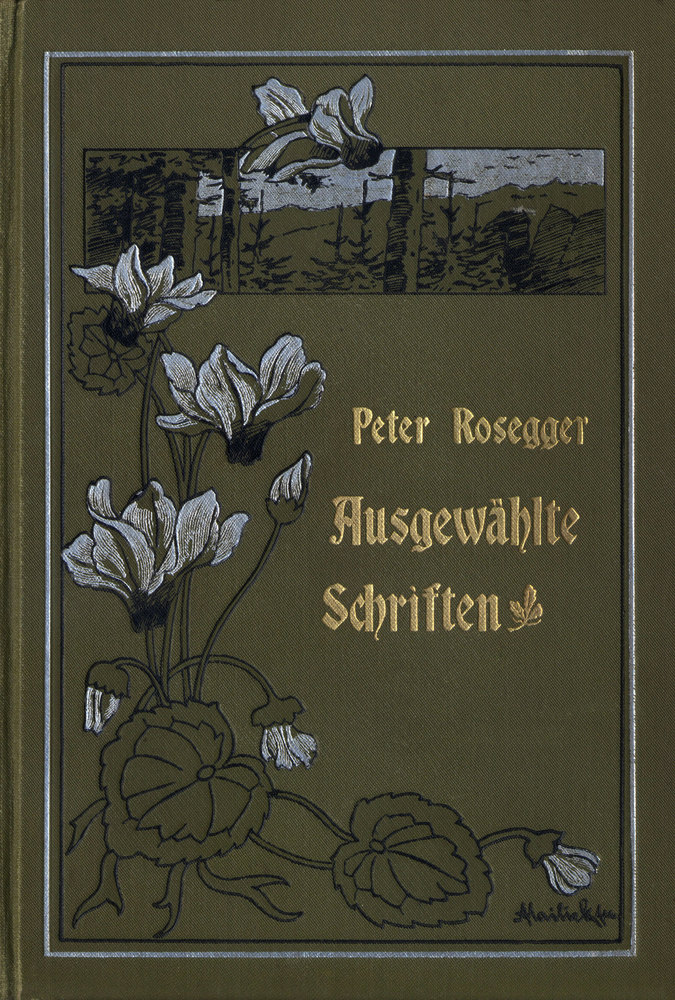
Project Gutenberg's Da Buch der Novellen. Erster Band, by Peter Rosegger This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: Da Buch der Novellen. Erster Band Author: Peter Rosegger Release Date: October 18, 2020 [EBook #63498] Language: German Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DA BUCH DER NOVELLEN. ERSTER BAND *** Produced by the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der 1906 erschienenen Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen sowie Schreibvarianten bleiben gegenüber dem Original unverändert, sofern der Sinn des Texts dadurch nicht beeinträchtigt wird. Passagen in Dialekt wurden ohne Korrektur übernommen.
Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) wurden im vorliegenden Buch in deren Umschreibung (Ae, Oe, Ue) dargestellt, mit Ausnahme der Buchwerbung am Ende des Bandes. Das Inhaltsverzeichnis wurde der Übersichtlichkeit halber vom Bearbeiter an den Anfang des Buches versetzt.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.
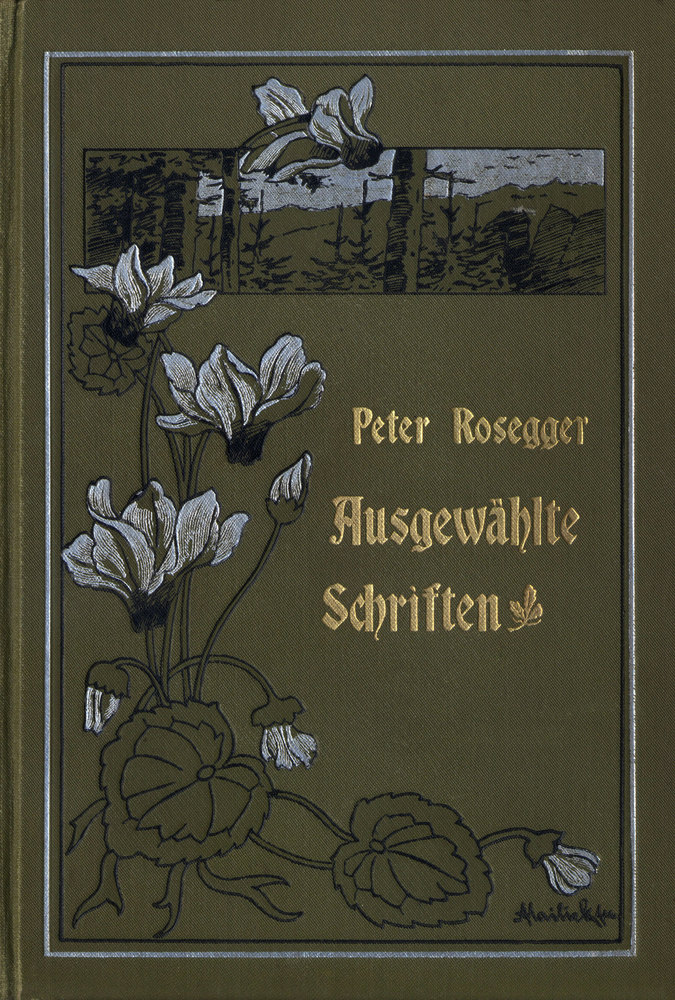
Von
Peter Rosegger.
Erster Band.
Einundzwanzigste Auflage.
Leipzig.
Verlag von L. Staackmann.
1906.
Alle Rechte vorbehalten.
Druck von C. Grumbach in Leipzig.
|
Seite
|
|
|
Die Harfenspieler
|
|
|
Felix der Begehrte
|
|
|
Das Haus auf der Höhe
|
|
|
Der Geldfeind
|
|
|
Das Holzknechthaus
|
|
|
Das Reich Gottes
|
|
|
Das Felsenbildniß
|
|
|
Das Viktel
|
|
|
Das Leben siegt
|

Die Gegend ist fremd, der Wald ist finster und abendlich, die Wege verrinnen in den Schluchten, an den Hängen, in den Dickichten – und wir haben keine Zuflucht. Ueber den Almen und Felswänden hängen die Wolken, die schweren, hochsommerlichen Wolken. Die Bäume wagen sich nicht zu rühren, denn in ihren Zweigen schlafen die Vögel.
In den Tiefen rauscht der Waldbach; – wenn in den Tiefen so sehr der Waldbach rauscht, sagen die Leute, dann kommt ein Sturm.
Wir wollten hinüber zum Kirchlein des heiligen Hubertus, das im Walde steht und den Waldleuten am Tage des Herrn als Versammlungsort dient. Nun ist keine Zeit dazu. Laßt jetzt auch das Suchen nach Himbeeren und Alpenrosen – es fallen schon die schweren, eiskalten Tropfen.
Ein mattes, plötzliches Hinleuchten zwischen den Stämmen – da beginnt es hoch oben zu rollen, rauh und schwer, wie das Aufathmen des Himmels, dem der Alp auf der Brust sitzt. Jetzt werden die Bäume wach. Sie schlagen mit den Aesten um sich, das Gevögel schreckt auf. Der Wald[S. 4] rauscht, hoch in den Wänden tost der Widerhall – über den Wipfeln kreist der Habicht, der bringt den Sturm.
An uns Eilenden huscht ein Mann vorüber, eine schwarze, verwilderte Gestalt mit einer Flinte. Plötzlich steht er wie gebannt, lauert, kauert sich zu Boden und richtet den Lauf des Gewehres in die Luft. Wie von seinem glühenden Auge entzündet, kracht der Schuß – aus den Lüften nieder stürzt der Habicht. Das Thier fällt an den Bäumen langsam von Ast zu Ast herab und bleibt endlich hängen über dem Haupte des Schützen. – Am Felshange fliegen die Wolken herab. Der Mann klettert auf den Baum wie eine Wildkatze, faßt mit den Zähnen den todten Vogel, springt zur Erde und eilt durch Wald und Wettersturm der Hütte zu.
Die Hütte steht zwischen uralten Fichten; vor derselben sind rauchende Kohlenmeiler, der Bretterbarren und der Ziegenstall; hinter ihr der brausende Bach.
Und aus dieser finsteren Hütte schimmert zu den kleinen Fenstern Licht heraus in die große, wilde Welt. Die Thüre ist verschlossen, der Mann rüttelt: „Kilian! Mach’ auf, die Räuber und Mörder sind da!“
„Erschreck’ Du einen Andern,“ sagt hierauf eine Stimme von innen, „ich kenne Dich wohl, Du bist der Hans.“
„Und darf der Hans in dieser Nacht bei Dir sein?“ fragte der Ankömmling. Die Thüre ging auf, der Kohlenbrenner stand da und sagte: „Bist gern gesehen.“
„Sollst es nicht umsonst thun, ich geb’ Dir ein paar Pfeifen Tabak.“
„Die paar Pfeifen Tabak nehme ich,“ sagte der Kilian, „aber für das Dableiben wirst nichts schuldig. In so einer ungestürmen Nacht ist’s kurzweiliger, wenn Zwei sind. Die Brautleut’ sind nach Feichtau gegangen und noch gar nicht[S. 5] daheim, die stecken sich bei dem Gewitter heilig unter einen Tannenbusch.“
Der Köhler, der das sagte, war eine große, derbe Gestalt, deren Gesichtszüge unter dem dichten Kohlenruß kaum zu erkennen waren. Seine Augen schauten offen und sanft. Er stak in einem weiten Lodenkittel, die Schenkel umspannte eine verschlissene und versengte Lederhose, vom Knie abwärts waren die Füße nackt bis auf die Holzschuhe. Er warf Aeste und Kohlen in sein prasselndes Herdfeuer, welches den vorderen Raum der Hütte durch den Rauch mit flackerndem Roth erhellte. Zu Fuß des Herdes war ein beweglicher Holzbalken, und so oft der Mann auf denselben trat, sprühte und lohte das Feuer in heftiger, blauer Flamme auf. An der berußten Holzwand hingen unter Haus- und Küchengeräthen große Hämmer, Zangen und Hacken, und neben dem Herde stand ein kleiner Amboß.
Der Köhler ist hier auch Schmied. Er schmiedet den Holzleuten im Edelwalde ihre Aexte, Beile, schärfte ihre Steigeisen und Sägen – er ist der Geschicktesten, Fleißigsten und Wichtigsten einer im Walde. Auch ist ihm was dafür geworden.
Hinter seiner Werkstatt und Küche – das ist Eins – hat er eine recht geräumige Stube, da drin steht ein halb Dutzend Lehnstühle um einen langen Tisch herum. An der Wand sind Reh- und Hirschgeweihe, von denen des Köhlers Töchterlein seiner Tage meinte, sie wären aus dem Holze herausgewachsen. In der Tischecke ist das übliche Heiligthum – ein rauhgeschnitztes und hellbemaltes Muttergottesbild. Darüber ist allweg ein Kranz von Tannenzweigen oder Preißelbeersträuchern gewunden, im Frühjahre auch von Eriken, im Sommer von Farrnkräutern und Alpenrosen, im Herbst[S. 6] aus Enzianen und Edelweiß – im Winter schmiegt sich ein kunstvolles Gewebe von farbigen Moosen um des Hauses Heiligthum.
In dieser Stube treibt Kilian ein drittes Gewerbe. Dort im rauchgeschwärzten, aber reichgeschnitzten Kasten – der ist aus alten Tagen, heute schnitzt man weder in den Städten, geschweige im Walde so kunstreiche Möbel – stehen große volle Flaschen und ringsumher, wie durstige Zicklein um die Mutter, kleine Trinkgläschen.
Agnes, des Köhlers Töchterlein, ist in den Herbsttagen durch Gehege und Geschläge gegangen, hat Vogelbeeren und andere Beeren und Steinobst und Gewurzel gesammelt, und der Vater hat neben den Meilern einen kleinen Ofen gebaut, einen Thonkessel mit langem Rohre darüber eingemauert und in diesen Kessel die Waldfrüchte gethan, hat Alles fest verklebt und verschlossen, darunter Feuer gemacht, vor das Rohr eine Flasche gestellt und gerufen: „Jetzt, wenn ein guter Geist drinnen ist, so komme er heraus, ich beschwöre ihn!“ –
Also ein Geisterbeschwörer? Nein, ein Branntweinbrenner. Aus dem langen Rohre begann es vorerst zu dunsten, dann zu tropfen und endlich floß ein helles Brünnlein in die Flasche. Das war Kilian’s drittes Gewerbe.
Und wenn dann die Holzer, die Pecher, die Hirten, die Wurzner und Kräuterer, die Jäger und auch die Wilderer kamen, so setzten sie sich an den Tisch und redeten von Dem und Dem, was da im Walde war und nicht sein sollte, oder nicht war und sein könnte, oder auch was recht war, daß es war, oder recht war, daß es nicht war. Kam dann allemal der Kilian herbei und fragte: „Mögt’s Einen?“ Und sie darauf: „Gieb her Einen.“
Dann schlugen sie für das funkelnde Gläschen auf den Tisch die Münze hin, so fest, als wollten sie dieselbe vor dem Weggehen noch in Holz abprägen. Und das Wirthsgeschäft war Kilian’s viertes Gewerbe.
In der Köhlerhütte, Schmiede, Branntweinbrennerei und Schenke ging’s denn auch immer recht lebhaft zu. Da saßen sie stundenlang, nächte-, ja oft tagelang zusammen, die rauhen wildbärtigen Wäldler; jeder hatte sein Griesbeil neben sich lehnen und in der rechten Hosentasche ein langes, blitzendes Messer stecken. Manchem davon wäre auf entlegenem Waldweg nicht gut begegnen, sagen die Jäger. Der rechte Waldmensch mag unter allen Raubthieren den Jäger am wenigsten leiden. Der schießt ihnen den Braten vor der Nase weg und läßt, wenn er kann, die so Benachtheilten noch einsperren. Der Wäldler beichtet und betet, arbeitet und fastet, ist ein guter Kerl, aber dem Jäger trotzt er bis auf’s Messer. Gegenseitig mögen sie sich aus purem Jähzorn erschlagen, aber den Jäger morden sie mit Vorsatz. Wildschützen sind sie, und ginge es um Erd’ und Himmel.
Jetzt, da Kilian den Hans in die Stube führte, war sie leer. Der Köhler nahm dem Gast die Flinte ab und verbarg sie unter einer Diele des Fußbodens.
„Magst Einen, Hans?“
„Hast einen rechten Beißer, so gieb ihn her.“
Der Köhler steckte einen brennenden Span in den dazu bereiteten Wandhaken, brachte Schnaps und sagte: „Ich glaube schier, Du hast Dir heute keinen verdient.“
„Wesweg meinst das?“ fragte der Andere.
„Weil Du nichts, als wie den Wettergeier bei Dir hast.“
„Glaubst Du,“ sagte der Hans, „man fängt die Rehböcke und Gemsen so unter den Steinen heraus, als wie die[S. 8] Regenwürmer? Ei ja, wenn diese kreuzverfluchten Jäger nicht wären! Aber heut’ sind sie Dir wieder den ganzen Tag im Wald herumgestreift wie räudige Füchse. Und wenn Einer einmal sechzehn Jahr’ im Kotter sitzt, wie ich, nachher fährt er nicht mehr so hitzig drein. Probir’s nur selber. Wär’ Dir heute recht gut zu Schuß gekommen. Steht so etlich sechzig Schritt vor mir ein Vierzehnender, ein sakrisch Thier! Ich mich gleich hinter den Busch niederlassen und zur Wange fahren, ist das Erste. Paff! schnalzt es auf der anderen Seite und der Bock stürzt hin. Vermaledeit! denk’ ich – grad daß ich nicht geflucht hab’ – muß ein Jäger da sein. Sehe ich auch schon den Franzinger, wie er dem Thiere zuläuft. Jetzt, Franzinger, jetzt kommst mir zurecht, denk’ ich, jetzt zahl’ ich, daß Du mich in den Arrest hast geschickt! – und leg’ den Finger an den Hahn. Weiß der Teufel, wie mir gäh sein Kathel einfällt und die Kinder, zittert mir der Finger am Hahn. – Kathel, denk ich, Dich hab ich einmal gern gehabt, und ist Dir auch der flott’ Jägerbursch’ lieber gewest wie der arme Hans, ich trag Dir’s nicht nach, ich hab Dich einmal gern gehabt. – Und schieße nicht. Bin durch den Anwachs gefahren, als hätte ich das wilde G’jaid hinter mir. Was schieß’ ich heut’, daß mir die Kugel im Rohr nicht faul wird? Da seh’ ich den Geier und brenn’ ihn herab. Sollt’ eigentlich der Franzinger sein. Magst ihn haben, Kilian, nagle ihn auf Deine Hauswand, wenn Du willst, nur die paar Federn behalte ich mir, und noch was.“
„Ein sauberer Vogel,“ meinte der Köhler und wendete das Thier über und über, „ich mag ihn schon; mein Hühnervolk wird sich freuen, wenn es den Geier einmal auf die Wand genagelt sieht. Dank Dir Gott, Hans.“
Als der Köhler hinaus zu den Meilern nachsehen ging und der Hans allein in der Stube war, zog er sein Messer aus der Tasche, stach dem Habicht die Augen aus und verzehrte sie.
„Hast auch den Glauben,“ sagte später Kilian, „daß gegessene Geieraugen dem Schützen einen recht scharfen Blick machen?“
„Ich habe gar keinen Glauben,“ versetzte der Hans, „ich weiß es; Geieraugen sind allemal ein sicheres Mittel für so was, aber gut müssen sie sein.“ Er führte die Sache nicht weiter aus, er warf den Vogel unter die Bank; dann zündete er die Pfeife an, ließ sie aber wieder ausgehen. Er starrt finster auf den Tisch. Die Spanflamme schüttelte sich hin und her, als sei sie nicht recht einverstanden mit dem, was der Wilderer denkt.
Draußen braust der Wettersturm. Man hört die Bäume rauschen und die Wipfel krachen – die Wände des Hauses ächzen; der Bach rauscht und bei dem Leuchten der Blitze sieht man sein wachsendes Fluthen und Anprallen an die Steine und Ueberquellen aus dem Ufer. Die Donnerschläge mögen bald verhallen, die Regen versiegen, die Wetter vergehen – als Herr bleibt der Wildbach. Wer hat dem Köhler erlaubt, hier seine Hütte aufzustellen? Fort damit! Eine Felswand nimmt sich noch der armen Köhlerei an; der Rasende zerschellt an ihr und schäumt wüthend dahin, hier einen Baumstrunk, dort ein Stück Erde mit sich reißend.
„Der Mensch wird rauschig, wenn er zu viel Branntwein trinkt, der Bach, wenn er zu viel Regen trinkt,“ sagt der Kilian. Er weiß es, morgen ist das Bächlein wieder klar und klein und hilft ihm die Kohlen löschen und den Schnaps kühlen und leugnet Alles, was es heute gethan.
Der Kienspan verlosch, aber im Herzen des Hans brannte es fort.
Draußen wurden mehrere Stimmen vernehmbar. Der Kilian ging, um zu sehen, und rief: „Seid Ihr endlich da, Ihr verdankten Leut’ Ihr! Gott Lob und Dank, daß Ihr da seid.“
Ein junges, heiteres, erwachsenes Mädchen und ein eben solcher Bursche kamen in triefenden Wettermänteln hereingestolpert.
„Na, heut’ wohl, Agnes!“ rief der Kilian, „heut’ hat’s Dir den Brautkranz wohl aufgefrischt. Was hab’ ich denn gesagt zu Mittag? Hab’ ich nicht gesagt, es kommt was? Es sind die Gelsen so in’s Feuer geflogen. Jetzt macht Euch zurecht, Ihr Lotterer Ihr! Die Dirn’ weiß Bescheid; und Du, Baldl, häng’ da Deinen Wettermantel über den Herd; wie Deine Haut trocken wird, sieh’ selber zu.“
„Aber nein,“ rief das Mädchen, „aber so was, da ich bin ganz zusammengeschlagen vor Schreck!“
„Was hast denn Du wieder für einen Schreck gehabt?“ fragte der Vater.
„Geistern thut’s schon wieder oben bei der Huberts-Kapelle. Daß ich Euch nur sag’! ’s ist die Nacht und der Regen da, wie wir vorbeigehen. Stehen wir unter’s Dach, sagt der Baldl. Ist mir nicht lieb, sage ich, bei der Kapelle thut’s gern einschlagen. Hat der Uebermuth d’rauf noch gesagt, ein bissel Feuer wär ihm lieber, wie so viel Wasser – so eine Sündhaftigkeit sagen! Und wie wir unter das Dach springen wollen, sag’ ich: bleib’ stehen, Baldl! Hab’ ich so ein Summen und Klingen gehört in der Kapelle, gerade wie wenn von weitem Posaunen thäten blasen. Hab’ den Baldl zu mir gerissen und sind durch’s Wetter herabgefahren wie nicht gescheidt. Und jetzt verspür’ ich erst den Schreck.“
„Ihr seid’s zwei Kinder und wollt’s schon heiraten,“ sagte der Köhler, „wo habt Ihr aber den Pechhacker gelassen?“
„Der ist zu seinem Mardereisen nachschauen gegangen, muß bald da sein.“
Die zwei Leutchen, die hier so naß geworden waren, hatten heute einen sehr schönen Feiertag gehabt. Sie waren in Begleitung des Pechhackers drüben in der Feichtau beim Pfarrer gewesen. Der Baldl ist unter den Holzleuten im Edelwald der Meisterknecht oder Vorarbeiter. Er ist im Holz geboren und kennt sich in demselben aus, wie ein Borkenkäfer. Wie er Vorarbeiter wird, fällt’s ihm auf einmal ein, er will auch eine Vorarbeiterin haben, und geht in die Köhlerhütte und schürt Kohlen, und geht in die Schmiede und schmiedet das Eisen, so lange es warm ist. Da ist lange hin und her geredet worden, haben etliche Gläschen Branntwein dabei getrunken und der alte Pechhacker, des Kilian Gevatter, hat bei diesem Reden und Rathen vor lauter Sinnen und Grübeln ein neues Pfeifenrohr zerbissen.
Endlich ist Alles richtig worden; in einer Woche ist der Ehrentag in der Feichtau beim Wirth, da, verhoff’ ich, wird der Gevatter wieder zu einem neuen Pfeifenrohr kommen.
In der Luft war es endlich wieder still geworden, nur von den Bäumen rieselte es nieder. Die Meiler draußen, die waren nach dem Regen schwarz, wie vor demselben. Nur der aufsteigende Rauch ist jetzt in der Nacht schier weißer als sonst.
Endlich kam der Pecher heim. Aber er kam nicht allein, hinter ihm humpelten ein Mann und ein Weib in fast fremdartiger Kleidung; mit den seltsamen Päcken, die sie mit sich schleppten, stießen sie an die Thürpfosten, daß es klirrte.
„Holla ho, Hochzeitsleut’!“ rief der lange, hagere Pechhacker, „lustig sein, ich bring’ die Musikanten mit!“ Damit warf er einen breiten Filzhut auf die Bank, daß es spritzte.
„Was hast denn Du für zwei Fledermäuse bei Dir?“ fragte ihn der Hans, auf die abenteuerlich aussehenden Fremden deutend.
„Die hab ich’ da oben in der Kapelle aufgestöbert – über und über naß, unter und unter schier erfroren. Haben im Gebirg’ den Weg verloren, sagen sie, und in der Kapelle übernachten wollen. Das geht nicht, hab’ ich gesagt, ich hab’ ein großes Vertrau zu dem heiligen Hubertus, aber ich glaub’, bei Menschenkindern thut Euch diese Nacht besser. Es geht ein eiskalter Wind, weil es auf der Scharnhöh’ gehagelt hat, und das Weibel, sag’ ich, schaut ohnehin schier einer kranken Henn’ gleich. Der Kilian da unten, sag’ ich, nimmt Euch über die Nacht schon in sein Haus und kocht Euch eine warme Suppe – wird keine Schwierigkeit setzen.“
„Eine warme Suppe können sie schon haben,“ meinte der Kilian, „aber mit der Liegerstatt wird’s heut’ schlecht ausschauen.“
„Nein, nein,“ murmelte jetzt der Mann in fremder Kleidung – er war betagt und hatte eine heisere Stimme – „für mich ist Alles gut, auch auf dem Fußboden da schlaf’ ich; aber die Meinige da, die ist mir krank worden, für sie thät ich wohl um ein warmes Nestlein bitten, wenn es sein könnte.“
„Wohl um Gotteswillen!“ flehte das Weib und faltete ihre bebenden Hände.
Das war schon durch und durch ein nasser Abend, auch in den schönen veilchenblauen Augen der Agnes gab’s jetzt Wasser. „Das ist ja leicht,“ sagte hierauf das Mädchen,[S. 13] „die Frau schlaft oben auf dem Dachboden in meinem Bett, und den Bärenpelz drauf; dafür bleibt der Mann bei uns in der Stube und zieht dem Ding da die Pfaid ab.“
Sie hatte bemerkt, daß der Alte in seinem Sack eine Harfe stecken hatte. Der Baldl sah seinen Vortheil und unterstützte den Antrag des Mädchens. Und so wurde es. Das fröstelnde Weib trank aus der hölzernen Schale warme Ziegenmilch, dann barg es mit Sorgfalt sein Instrument, es war eine zweite Harfe, in die Ecke, sagte Allen eine gute Nacht, ließ sich auf den finsteren Dachboden führen und legte sich in’s Bett unter den Bärenpelz. Der Alte hatte seinem Weibe noch nachgeschaut und dann gesagt: „Was ich froh bin, daß sie zum Schlafen kommt; ich thue, was Ihr wollt.“
Für’s Erste wollten sie, daß er sich in ein trockenes Gewand stecke, dann, daß er ein Glas Branntwein trinke. Dann zündeten sie einen frischen Span an und setzten sich um den Tisch.
„Na, Hans, was ist’s mit Dir?“ polterte plötzlich der Pecher den finsteren Gesellen an, der wortkarg in seiner Ecke kauerte, „was meinst, wann erwürgen wir den Franzinger? Mir hat der Scherg’ das Mardereisen ausgehoben. Will er Einem auch das Raubthierfangen nicht mehr vergunnen. Der giebt nicht Ruh, so lang’ er nicht die Bohne im Leib hat.“
Der Hans ließ unter der tief in die Stirne gedrückten Hutkrempe hervor einen Blick schießen. „Ja,“ murmelte er, „’s ist Einem verteufelt langweilig am Abend, wenn man nichts geschossen hat.“
Mittlerweile war Agnes in Unterhandlung mit dem fremden Mann – der Harfe wegen. Es war ihr so wunderlich[S. 14] in den Füßen, just als hätte sie auf jeder Zehe ein loses Rädchen. Und kaum legte der Mann die Finger an die Saiten, haschte Agnes nach ihrem Baldl. Aber – die Saiten wollten nicht klingen. Der Regen hatte sie heiser gemacht.
„Sie werden schon trocken, derweil trink’ Branntwein,“ sagte Kilian zum Fremden, „mit Verlaub zu fragen, von wo seid Ihr denn her?“
„Wo wir hin wollen, meint Ihr,“ versetzte der Mann, „wir sind alt, wir kommen aus der Fremde und gehen der Heimat zu. Im Böhmerland sind wir daheim, nach dort sind wir jungerweise aus Preußen eingewandert. Jetzt ziehen wir schon über vier Jahr’ in der Welt herum und musiciren den Leuten was vor, weil uns von Heim der Jammer vertrieben hat. Wo es lustig zugeht, da bleiben wir; wollen sie tanzen, so spielen wir; wollen sie hören, so singen wir – die Meinige hat eine gute Stimme gehabt, letzt’ Zeit freilich, da ist ihr der Stimmstock umgefallen. Jetzt geht’s nicht mehr recht, und wenn wir singen, so geben uns die Leute Geld, daß wir aufhören sollten. Ist auch recht, sag’ ich, so brauchen wir keine Saiten zu stimmen; aber der Meinigen hat’s das Herz abdrücken wollen – das Singen ist ihr noch der Trost gewesen, seit der Junge todt ist.“
„Trinkt wacker,“ sagte der Köhler, „ich füll’ nach. Ihr müßt auch harte Sach’ durchgemacht haben.“
„Ja, das glaube ich!“ lachte der Musikant überlaut auf.
Dann schwieg er. Dem Kilian that’s leid, daß die Erzählung des Mannes verstummen wollte, er sagte denn nach einer Weile: „Böhmen soll ja ein schönes Land sein.“
„Ein schönes Land,“ antwortete der Fremde.
„Was giebt’s denn Neues dort?“ fragte der Köhler äußerst ungeschickt.
„Ich bin schon lang’ nicht mehr dort gewest. Dazumal hat’s Neues genug gegeben. Sind unsere Landsleut, die Preußen gekommen, haben uns das Haus niedergebrannt und unsern Sohn todtgeschossen. D’rauf sind wir fort. Gehen wir vor den deutschen Leuten nicht mehr sicher, sag’ ich zu der Meinigen, so müssen wir halt in’s fremde Land! und sind über das Gebirge in’s Wellische hinein.“
„Jetzt soll ja schon lang’ wieder Alles gut sein,“ sagte der Köhler.
„Das haben wir auch gehört und so reisen wir wieder heimwärts.“
„Und was hört man sonst Neues?“ fragte nun der Pecher und stopfte sich aus einem Blasenbeutel Tabak in die Pfeife.
„Die Franzosen sollen wieder anrücken,“ sagte der Harfner.
Ueber dieses Wort richteten Alle ihre Köpfe auf; auch der finstere Hans den seinen.
„Die Franzosen wieder anrücken?“ meinte der Köhler, „das ist ’leicht doch eine Lug, Vetter!“
„Wird hübsch wahr sein, der Napoleon will uns wieder haben.“
Jetzt hörte man nichts, als den Wildbach draußen. Plötzlich aber schlug der Pecher mit seiner knochigen Faust auf den Tisch, daß die Gläser emporsprangen. „Sakra,“ fluchte er, „wenn sie wieder kommen, so setzt’s was! Sie sind schon dagewest und unsere Vatersleut haben sich treten lassen, daß es schon ganz hündisch ist gewest. Aber wir raiten anders, wir! Mit Hacken und Messern fahren wir drein und klieben ihnen die Schädel auseinand. Edelwaldleut, wir sind keine Hundsfötter, wir sind freie Leut. Kreuzsakerment!“
Der Mann war aufgesprungen und hatte sein langes Messer mit einem schweren Fluch in den Tisch gestoßen.
„Was hat er denn,“ fragte der Baldl.
„Er wird allemal so wild, wenn von den Franzosen die Rede ist,“ sagte Kilian, „sie haben seinen Großvater erwürgt.“
„So haben sie ihn erwürgt in des Teufelsnamen!“ rief der Pecher, „sie sind Feinde gewest. Aber daß sich hernach mein Vater von ihnen zu einem Knecht hat brauchen lassen, zu einem Spion und Schurken, das verzeih’ ich ihnen nimmer, und wenn’s mir den Himmel kostet!“
So redeten und schrien sie hin und her, es war ja zur Zeit des deutsch-französischen Krieges, wo auch die Waldleute tief im Gebirge aufgeschreckt worden sind, wo sie alles Weh, das sie vier Jahre früher erfahren, vergessen hatten und nur vom Franzosen-Erschlagen die Rede war. – Zur solchen Zeit that eine gemüthliche Musik wohl. Und in diesem Augenblick, da die verwilderten Gemüther entbrannten zum Vergelten und Schlachten, legte der alte Harfner seine Finger in die Saiten....
Sie klangen noch ein wenig trüb, aber sie klangen und spielten ein fröhlich Lied. Agnes legte den Arm um den jungen Bräutigam – es begann der Reigen.
Und als das Paar anmuthsvoll und geschmeidig durch die Stube walzte, da pfiff Kilian die lustige Weise mit und schnalzte mit den Fingern den Takt dazu und trillerte in seiner bäuerlichen Art:
[1] Stoansteirisch = ursteirisch.
Die beiden Anderen schlugen dazu mit ihren knochigen Fäusten auf dem Tisch die Trommel.
Der Harfner brach sein Spiel ab und sagte: „Es thut mir doch das Brautpaar leid, daß man ihm eine solche Kriegsmusik macht.“
„Möglicherweise fangt ihnen jetzt der dreißigjährige Krieg an,“ lachte Kilian.
„Hätte ich hier was d’reinzureden,“ versetzte der Harfner und schüttelte seinen grauen Kopf, „so wollte ich sagen: So ein Spaß gehört sich nicht. Wenn man jungen Eheleuten allemal das Schlechte voraussagt, so meinen sie nachher, es muß so sein, und suchen und finden überall Schlechtes. Wie ich vor zweiunddreißig Jahren die Meinige genommen, ist auch Gefahr gewesen, aber ihre Mutter hat frisch gesagt: Ihr mögt thun, was Ihr wollt, Ihr Zwei gehört zusammen; Ihr mögt voneinander fliehen und Euch verfolgen und Leid anthun, es wird vergebens sein, Ihr werdet Euch lieb haben. Ihr werdet auswendig Elend und Kümmerniß haben, Ihr werdet miteinander weinen, aber Ihr werdet glücklich sein. – So hat sie gesagt, so ist es geworden und so will ich es auch Euch wünschen.“
Dieser Worte wegen schauten sie mit Wohlgefallen auf den alten Harfner; nur der Hans nicht, der lugte durch das kleine Fenster hinaus. Draußen über den finsteren Tannen standen jetzt die Sterne des Himmels; ihretwegen blickte der Mann wohl nicht hinaus. Ob er nicht an das Weib des Jägers[S. 18] Franzinger dachte? Er möchte sie fliehen, verfolgen, möchte ihr Leid anthun und muß doch an sie denken...
Jetzt zog der Hans ein Horn aus der Tasche, ließ daraus Pulver in seine Hand rinnen, that dasselbe in das Rohr seiner wieder aus dem Verstecke geholten Flinte, ließ dann eine Bleikugel hineinrollen und verstopfte das Rohr mit Papier, das er mit dem Ladestock hineinstieß. Dann prüfte er den Hahn und starrte wieder zum Fenster hinaus.
„Jetzt sollt Ihr uns aber auch Eins singen,“ sagte Kilian zum Harfner.
Der Alte schaute besorgt drein und that hernach die Frage: „Nicht wahr, Ihr guten Leute, die Meinige hat eine warme Decke?“
„Den Bärenpelz, der inwendig mit Schafspelz gefüttert ist,“ antwortete der Köhler. „Unter solchen Thierhäuten kann Keiner erfrieren.“
„Dann singe ich gern und sing’ Eins für die liebe Jugend,“ sagte der Alte, griff in die Saiten und begann zu singen:
Jetzt schrillte die Harfe und war still. Was ist das? Drei Saiten auf einmal gesprungen....
Dem Alten war die Stimme auf den Lippen erstorben. Der Pecher meinte, das hätte was zu bedeuten.
„Der Nässe wegen,“ sagte Kilian, „nasserweise angespannt, dann trocknen sie zusammen und springen. Gießen wir noch zu guterletzt Eins nach!“ Und er füllte das Gläschen des Harfners wieder voll.
Der Baldl, dem eigentlich noch nicht genug getanzt war, versuchte die Saiten zu knüpfen.
„Laß’ es sein,“ sagte der Alte lächelnd, „was hin ist, ist hin.“
Kilian ging zu seinen Kohlstätten, um etwaige Gluthausbrüche zu dämpfen. Der Pecher meinte, für ihn wäre es Zeit, daß er seine Klause aufsuche, sie stand oben am Waldhang, wo morgen Früh wieder die Pechbrennerei angehen sollte.
„Da, Vetter,“ sagte er, „da habt Ihr was für’s Aufspielen,“ und warf für den Musikanten ein Silbergröschlein auf den Tisch hin.
Und der Hans? Der hatte während des Gesanges sein Gewehr unter die Jacke genommen und still und finster die Hütte verlassen.
So wollte sich auch der Sänger anschicken, auf den Dachboden zu seinem Weibe zu gehen.
„Nachher wären wir doch ganz allein,“ sagte das Mädchen besorgt.
„Das macht nichts,“ meinte der Baldl.
„Die Kinder sollen auf dem Stroh liegen,“ befahl hernach der Köhler.
„Nein,“ rief Agnes, „das thu’ ich nicht.“
„Wo willst denn also schlafen?“
„Da gehe ich lieber zur fremden Frau hinauf,“ versetzte sie und war roth im Gesicht.
„Ist auch recht,“ meinte Kilian, „so mag der Herr Musikant beim Baldl auf dem Stroh liegen.“
So geschah es. Der grauhaarige Harfner und der junge braunlockige Meisterknecht legten sich in die Stube auf das Bettstroh und der Baldl sagte: „Ja, Vetter, wir Zwei sind auch noch niemalen beisammen gelegen.“
„Und werden vielleicht auch niemalen mehr beisammen liegen,“ entgegnete der Alte, „gute Nacht, jetzt!“
Beide rückten manierlich in sich zusammen, Keiner wollte den Andern drücken. Ist es das erste- und letztemal, so soll Keiner über den Andern zu klagen haben. Der Alte schlummerte bald ein; der Baldl dachte: nächst’ Wochen lieg’ ich schon bequemer.
Agnes war über die Leiter in den Dachraum hinaufgeklettert. Kilian arbeitete mit seiner Schaufel an den kohlenden Meilern. Es heißt wachsam sein.
Wenn die Flamme aus der schwarzen Decke des Kohlenmeilers schlägt, so brennt sie dem Köhler in den Geldbeutel hinein. Was lichterloh brennt, das wird zu Asche, was still und im Innern glüht, das ist das Rechte. Es soll ja auch beim Menschen so sein.
Nachdem die Arbeit geschlichtet ist und der weiße Rauch still zu den Wipfeln aufsteigt, stützt sich Kilian auf den Schaufelstiel und schaut vor sich hin. Es ist jetzt Alles so[S. 21] still, selbst das Rauschen des Baches ist feierlich – dem Mann ist wie zum Einschlafen.
Da geht leise die Thüre der Hütte auf. Eine weiße Gestalt huscht heraus – Agnes im puren Nachthemdchen.
„O Kind,“ sagte Kilian, „was laufst Du herum in der kalten Nacht?“
„Vater,“ flüsterte das Mädchen, „es ist was geschehen. Ich getraue mich nicht mehr hinein.“
„Er soll Dir Ruh’ geben!“ sagte der Vater strenge.
„Mir nicht,“ schluchzte sie, „mir thut kein Mensch was, aber – das fremde Weib wird gestorben sein. Es liegt ganz kalt und starr im Bett und ist nicht aufzuwecken.“
Jesus und Maria! denkt sich der Köhler, jetzt ist diese Frau gestorben.
Er eilt mit seiner Tochter auf den Dachboden – ganz still machen sie es, daß Niemand aufwacht. Dann schlägt er mit Schwamm und Stein Feuer, und bei diesem matten Glimmen sieht er’s, mit seinen zitternden Händen fühlt er’s – die Harfenspielerin ist todt. –
Jetzt saßen sie lange am Bett, der schwarze Köhler und sein weißes Töchterlein, und beriethen, was zu machen sei.
„Wenn ich an den armen Mann denke, will mir das Herz abspringen,“ sagte das Mädchen.
„Jetzt lassen wir ihn schlafen,“ sagte Kilian, „er mag sich ausruhen und stärken. Wenn er des Morgens wach wird, da müssen wir ihn halt in Gottesnamen vorbereiten. Kannst mir’s glauben, Agnes, ich weiß wie das thut! Lieber einen Finger von meiner Hand, als ihm das sagen! Es ist ein hartes Kreuz!“
Sie hüllten eine Leinwanddecke über den Leichnam, wie es sonst ist, wenn der Mensch schläft. Dann stiegen sie vor[S. 22]sichtig über die Leiter und dann gingen sie hinaus zu den Meilern und arbeiteten. Sie sagten kein Wort und arbeiteten.
Und als allmählich ein kühlerer Lufthauch wehte, und als es nach und nach lebendig wurde in den Bäumen und der Morgenstern aufging, trat der Baldl aus dem Hause, ging zum Bach und wusch sein Gesicht. Und als dieses Gesicht recht frisch und heiter war, ging er hin zu den Arbeitenden und sagte: „Was giebt’s denn da in aller Früh zu thun, daß Ihr den Hahn um den Weckerlohn bringt?“
Agnes eilte zu ihm heran, als wollte sie seinen Mund verhalten: „Sei still, Baldrian, es ist heute Nacht ein Unglück geschehen in unserem Haus. Da oben unter dem Dach liegt eine Leiche.“
„Die Musikantenfrau?“
„Ist gestorben. Geh’ jetzt hinauf auf den Steinkogel, und mach’ ein großes Feuer, damit die Holzleute und die Almer wissen, daß wir einen Todten haben.“
Der Bursche schüttelte den Kopf, als könne er die Sache nicht sobald fassen.
„Ja, mein Sohn, so sterben sie wieder auseinander,“ sagte Kilian. „Geh’ und bete unterwegs Dein Morgengebet.“
Der Baldl ging auf den Steinkogel, wo man über die Wälder hinaussieht in das weite Thal und auf die Berge und Almen. Dort trug er Reiser zusammen, und als die Morgenröthe aufging, brannte auf der Höhe ein großes Feuer.
Die Menschen, die es von ferne sahen, sagten zu einander: „Dort brennt ein Todtenlicht!“ und beteten für die abgeschiedene Seele.
Agnes und ihr Vater arbeiteten noch immer auf der Kohlstätte, da gab es stets zu thun, und wäre das nicht ge[S. 23]wesen, so hätten sie sich heute zu thun gemacht. Sie wollten nicht in das Haus gehen, damit der alte Mann nicht in seiner Ruhe gestört werde. „Er soll schlafen, so lange es ihn freut,“ sagte Kilian, „es kommt für ihn ein schwerer Tag.“
Aber als die Sonne aufging, steckte der Harfner sein graues Haupt zum Fenster heraus und rief: „Guten Morgen!“
„Guten Morgen,“ sagte der Köhler.
„Ihr seid schon so fleißig und ich faullenze in den Tag hinein. Aber es ist gut schlafen in Eurem Haus.“
Sie gingen zu ihm in die Stube. Agnes machte auf dem Herd Feuer und kochte das Frühstück. Kilian nahm die Harfe in die Hand und sagte: „Das wird sich schwer machen lassen, drei Saiten auf einmal.“
„Mein Weib hat neue,“ antwortete der Musikant. „Aber das gottlos lange Schlafen von ihr! Sie ist doch recht müde geworden auf dem weiten Weg.“
„Jetzt esset mit uns eine gute warme Suppe,“ sagte Kilian und theilte die Holzlöffel aus.
Der Harfner blickte durch das Fenster und fragte: „Sind das die Hirten, die da oben auf dem Berg das Feuer gemacht haben?“
„Das Feuer habe ich auch schon gesehen,“ meinte der Köhler, „Hirten sind es nicht, es ist ein Todtenfeuer.“
„Ein Todtenfeuer, wie ist denn das?“ fragte der Musikant.
„Wenn in unserem Walde wer stirbt, so zündet man da oben ein großes Feuer an, damit es die Leute wissen. Es geschieht nicht selten; im Wald ist oft ein Unglück; Alte und Junge trifft’s, der Mensch muß d’rauf gefaßt sein.“
So sagte Kilian und jetzt erst bemerkte der Harfner das ernste Gehaben des gestern so fröhlichen Kohlenbrenners und die verweinten Augen des Mädchens.
„Wo ist der junge Mann?“ fragte der Musikant, „der Bräutigam?“
Der wäre eben auf den Berg gestiegen, um das Feuer zu machen, sagten sie.
Der Harfner hatte den Löffel schon in der Hand gehabt, jetzt legte er ihn langsam weg, stand auf und tastete unsicher nach der Thürklinke.
„Wo wollt Ihr hin, Vetter?“ fragte Kilian, aber der Mann stolperte, ohne Antwort zu geben, über die Schwelle, und mit dem Rufe: „Susanna!“ kletterte er hastig die Leiter hinan.
Kilian eilte ihm nach. „Susanna!“ rief der Harfner oben in der finsteren Dachkammer.
„Müßt nicht zu sehr erschrecken, es ist des lieben Gottes Willen so!“ sagte Kilian, nahm den Musiker bei der Hand und führte ihn zur stillen Bettstatt.
Ein Blick in’s starre, fahle Antlitz, dann sank der verwaiste Greis zu Boden.
Wenige Fuß darüber, auf dem sonnigen Dachgiebel jubelten die Schwalben....
O du schöner, frischer, fröhlicher Wald! O du klingender Vogelsang, du duftiges, thauiges Blumenleuchten! Du sonnige Himmelsrunde, du erquickender Schattenschoß mit deinem unendlichen Leben, wie bist du gräßlich! Gräßlich, wenn durch dich der Weg zum Todtengräber führt.
Das ist der Weg, den der alte Harfenspieler wandelte.
Der Todtengräber zu Feichtau saß in seiner dumpfigen Stube und klopfte mit einem Hammer verbogene und verrostete Sargnägel zurecht und nagelte dann damit für seinen Kleinen einen Kinderwagen zusammen.
„Braucht Ihr was?“ fragte er murrend den eintretenden Musiker.
„Ein Grab,“ antwortete dieser, „mir ist mein Weib gestorben.“
„Ist schon recht, werden es wohl machen. Seid Ihr beim Pfarrer gewest? Nicht, dann geht jetzt zu ihm. Ich krieg’ nachher meinen Gulden.“
Der Harfenspieler ging zum Pfarrer, der in seinem Garten mit dem Spaten ein Blumenbeet umstach, und klagte ihm sein schweres Anliegen.
„Sie sind wohl fremd in der hiesigen Gegend?“ fragte der Pfarrer.
„Freilich wohl, Hochwürden, und so wollt’ ich höflich gebeten haben –“
„Es war Euer angetrautes Weib?“
„Mein Gott, ja.“
„Und katholischer Religion?“
„Ja, sonst schon,“ meinte der Alte, „aber wir sind von Preußen in’s Böhmerland eingewandert und sind dem Glauben unserer Eltern treu geblieben.“
„Also protestantisch?“
„Evangelisch, ja.“
„Das ist schlimm,“ sagte der Priester, lehnte seinen Spaten an einen Kirschbaum und ging neben dem Alten her mit verschränkten Armen durch den Garten.
„Das ist sehr hart, lieber Mann,“ versetzte er dann und blieb stehen, „ich als Mensch, das mögt Ihr mir glauben, mache keinen Unterschied; wenn ich Euch dienen kann, ich thue es gern. Aber – wir in Feichtau haben keinen evangelischen Friedhof, und Personen von nicht katholischer Confession auf dem katholischen Kirchhofe zu beerdigen, ist mir strenge[S. 26] verboten. Eben in dieser Zeit, wo der Kampf zwischen Kirche und Staat wieder heftig entbrannt ist, hat das Consistorium die Satzung verschärft und ich als katholischer Priester muß danach handeln.“
Der alte Mann stand rathlos da. Und fast ebenso rathlos stand der Pfarrer neben ihm.
„Wenn Ihr heute schon vom Edelwald herauskommt,“ sagte jetzt der Priester, „so werdet Ihr einer kleinen Stärkung bedürfen. Ich darf Euch wohl ein Glas Wein vorsetzen?“
„O, vergelt’s Gott!“ rief der Harfner, „wie könnt’ ich trinken, wenn für mein Weib keine Raststatt ist. Weit und breit kein evangelischer Friedhof. Soll ich sie denn im Wald vergraben?“
„Und wenn es darauf ankäme!“ versetzte der Pfarrer, „die Erde ist überall Gottes. Kann ich zu Eurem Troste kommen und beten? Ich thue es gern.“
Der alte Mann wankte wortlos davon.
Er ging durch das grüne Thal den Wäldern zu, er stieg über den Berg in die Schlucht hinab, wo das Haus des Kilian steht. Und als er dort in die Stube trat, stand er vor einem Heiligthum.
Es war nicht mehr die Zechstube, wie in der vorigen Nacht, wo hier im Tisch das lange Messer stak und auf dem Fußboden die derben Schuhe des jungen Paares reigten – es war anders. An der vorderen Wand der Stube, von zwei Oellichtlein milde bestrahlt, lag sein Weib aufgebahrt zwischen Waldblumen und wilden Rosen. Zu Haupten stand ein kleines, hölzernes Kreuzbild und ein Weihwassergefäß mit einem Sprengzweiglein. Auf der Brust der Leiche lagen papierne Heiligenbildchen und zwischen den Fingern stak[S. 27] ein Vergißmeinnichtsträußchen und eine Wachskerze. Die Stirne war mit einem grünen Lärchenzweig umwunden. Der Körper war bedeckt mit einem weißen Tuche und zu Füßen der Bahre lehnte die Harfe.
„Susanna,“ sagte der Harfner und legte seine Hände an ihr Haupt, „wie sie es herzensgut mit Dir meinen. Schau herab vom Himmel auf dieses Haus. Sie haben Dich zwischen Rosen gelegt – schau herab.“
Hinter dem Hause war der Köhler beschäftigt, mit Erlstrauchbändern zwei Stangen zu einer Bahrtrage aneinander zu binden.
Der Harfenspieler fiel ihm um den Hals und weinte.
„Ist recht,“ sagte der Köhler, „weint Euch aus, dann wird Euch leichter.“
„Eurer Gutheit wegen,“ schluchzte der Musikant, „Eure Gutheit schlägt mir so an’s Herz. Aber die Tragbahre, lieber Mann, die haben wir nicht vonnöthen.“
„Den Sarg wird uns der Zimmersepp morgen Früh bringen.“
„Wenn ich bei Kraft wäre, wie ich einstmals bin gewesen,“ sagte der Harfner, „ich wollt’ mein Weib hernehmen wie ein kleines Kind und sie so weit tragen, bis ich einen evangelischen Friedhof fände.“
„Seid Ihr ’leicht evangelische Leut?“ fragte der Köhler.
„Gottswegen, ja, und deswegen kann sie der Pfarrer auf dem Feichtauer Kirchhof nicht begraben.“
Der Kilian stand eine Weile sprachlos da, dann machte er mit der Hand einen Schlag in die Luft und rief: „Das sind Dummheiten! – Nein, Vetter, laßt Euch das nicht anliegen. In unserm Wald hat Euch das Unglück getroffen, wir Waldleute verlassen Euch nicht. Bleibt jetzt da und[S. 28] hütet mir das Haus. Ich gehe zu meinen Nachbarn, Euer Weib wird mit Ehr’ und Lieb’ bestattet werden.“
Der Harfenspieler ging in die Stube, setzte sich an die Bahre und sah in das blasse, ernste Antlitz seines Weibes. Und er träumte hier bei den Rosen und Todtenlichtern die liebe Lebenszeit, die er mit ihr zugebracht....
Der Köhler ging hinan durch den Wald gegen die Hütte des Pechers, und dann ging er in den hinteren Edelwald zu den Holzarbeitern und ging auf die Alm zu den Wurzelstechern und Hirten.
Auf seiner Rückkehr unterwegs sah er hinter dem Moosstein im Gebüsche einen Mann kauern.
„Wer ist es?“ rief Kilian.
Ein unverständliches Gebrumme. Er erkannte den Hans.
„Was machst Du da, Stromer?“ fragte ihn der Köhler.
„Ich,“ murmelte der Andere, „hin werde ich. Es haben mich die Jäger erschlagen wollen.“
„Und warum haben sie es nicht gethan?“
„Weil ich mich zu früh todt gestellt hab’.“
„Und warum hast Du sie nicht niedergeschossen?“
„Schieß’ nur, schieß’, wenn sie Dir das Brenscheit (Gewehr) stehlen, während Du den Rehbock ausdärmst! – Fett ist er, denk’ ich, und heut’ hat’s gerathen. Stehen sie Dir auf einmal da, ihrer Drei, und hauen mit dem Griesbeil auf’s Messer, bis es entzweispringt. Mit was wehrst Dich? Kaum daß ich dem Einen noch die Faust in’s Gesicht werfen kann, fangen die andern Zwei schon an, loszudreschen. Ein Schaft ist in Scherben gegangen – da schau Dir die Trümmer an – bis sie mich zu Boden gebracht haben. Der Franzinger ist auch dabei gewesen. Halt, denk’ ich mir, für[S. 29] Dich muß ich mich noch aufheben, und hab’ die Zung’ herausgereckt und mich nicht mehr gerührt. Der steht nimmer auf, haben sie gesagt, nachher sind sie fort mit meinem Gewehr und dem Thier. Aber aufsteh’ ich noch! Schau mich an, Kilian, aufsteh’ ich noch, und ehevor ich noch einmal auf den Erdboden fall’, ehevor fällt ein Anderer!“
Der Wilderer war etwas arg zugerichtet. Er bewegte sich mühsam weiter. Der Köhler wollte ihn stützen, aber er schlug es trotzig aus; er brauche keine Krücke.
„So komm’ in mein Haus, wir legen Hasenschmalz auf Deine Wunden.“
Der Verwundete hinkte neben dem Köhler her und knirschte. Plötzlich rauschte es im Gebüsch. „Wildtauben!“ zischelte der Hans, hob einen Stein auf und schleuderte ihn in’s Dickicht. Etliche flogen davon, eine flatterte auf und stürzte wieder zu Boden. Ohne Gewehr hatte der verwundete Wilderer ein Thier erlegt. Dann schlug er sich mit der Beute seitab.
Als der Köhler zurück in sein Haus kam, saß der Harfner noch an der Bahre und sah in das blasse, ernste Antlitz seines Weibes.
Langsam und still verging der Tag. Am Abende, als Agnes vom Walde heimkam, machte sie auf dem Herd ein lebhaftes Feuer, holte aus den Schränken Mehl und Fett und begann zu kochen und zu backen. Und in der Nacht kamen der Pecher und sein Weib im Sonntagsstaate, es kam der Zimmersepp mit dem Sarge und es kamen andere Leute, wilde, narbige Bursche, struppige und gutmüthige Greise, Weiber und Kinder. Jedes kniete, als es in die Stube kam, vor der Bahre nieder und betete still, dann stand es auf und sprengte mit dem Tannenzweige Weihwasser auf den[S. 30] Leib der Todten. Dann blickten sie theilnehmend auf den fremden Mann hin, der im Winkel saß, und Einer oder der Andere suchte ihn mit Worten zu trösten: man müsse es nehmen, wie es Gott schicke, sterben müßten wir Alle einmal, Keiner bleibe übrig, und die Abgestorbene hätte es überstanden, für sie sei es so am besten, sie hätte gewiß nicht viel Gutes gehabt auf dieser Welt. Gott tröste ihre Seele.
Sie wachten die ganze Nacht, und dann kam Agnes und trug Krapfen auf den Tisch, und Kilian, der sich heute allen Ruß vom Leibe gewaschen und in seinen Sonntagsanzug gesteckt hatte, lud die Leute ein, sich an den Tisch zu setzen und zu essen, wie es Gott gesegne.
Sie setzten sich hin und aßen. Der Harfner blieb in seinem Winkel und aß nicht.
Nach dem Mahle gab der Köhler Jedem eine Wachskerze in die Hand. Dann machte er die Thür auf und sie trugen den Sarg herein. Derselbe war aus neu geschnittenen Brettern gezimmert und zu Haupten lagen Hobelspäne als Kopfkissen.
Nun kamen Alle zum Sarge heran und besprengten ihn. Dann hoben drei Männer die Leiche und legten sie hinein. Das geschah, indem Alle schwiegen. Jetzt trat ein Mütterlein zum Harfner und sagte: „Wollt Ihr sie noch einmal anschauen, so kommt. Ihr seht sie dann nicht mehr, bis zum jüngsten Tage.“
Der Greis sank hin über den Sarg. An der Wand schellte die Harfe.
Jetzt erhoben sie ihre Stimme und sangen den Grabgesang:
Nach diesem Liede legten sie den Deckel auf den Sarg und nagelten ihn fest. Da zitterten die Herzen. Es giebt keinen Schall auf Erden, der das Menschenherz so eigen erschüttert, als der Hammerschlag auf den Sargnagel.
Agnes legte einen Kranz aus Weißdornzweigen auf den Sarg, dann wurde er gehoben. Die Menschen hatten ihre Kerzen angezündet und so trat der Zug nun aus dem Waldhause. Er ging den Weg entlang, der am Waldbache aufwärts führt. Die Bäume säuselten, auf den kahlen Höhen glühte das Morgenroth. Voran, hochgehoben, schwankte der Sarg, hinter demselben ging Kilian, der ein hölzernes Kreuz trug. Dann gingen Agnes und ihr Baldrian, das bräutliche Paar. Dann folgten alle Anderen und beteten laut.
Ganz zuletzt ging der Pecher und an seinem Arm, die Harfe schleppend, der alte Sänger.
So gingen sie aufwärts durch das Gebüsche, zwischen Wildfarrn und Haidekraut. Und sie gingen am Felshange hin und kamen auf eine stille, thauige Wiese; sie gingen über graues, moosiges Gestein, sie gingen über eine klangvolle Höhe und sie gingen durch einen schattigen Tann. Die Sonne war aufgestiegen und spann ihre goldigen Fäden durch den grünen Wald. Da war’s, als zittere in der Luft der Klang eines Glöckleins.
Da sie tiefer in den Hochwald kamen, war kein Sonnenstrahl und die Luft wehte sehr kühl. Vernehmlicher wurde das weiche Klingen des Glöckleins. Und endlich in der Wildniß, durch welche nur ein schmaler Steig über den Berg[S. 32] gegen die Feichtau führt, eingefriedet von Felsen und alten Bäumen, auf einem Anger stand das Kirchlein des heiligen Hubertus. Es war aus Holz gezimmert, roth angestrichen und auf seinem Bretterdache wucherte das Moos. Ueber dem Eingange, aus welchem brennende Lichter des Altars schimmerten, erhob sich ein Thürmchen und aus diesem klang es milde und ruhevoll, als klänge es aus der Ewigkeit herüber.
Aus der Ewigkeit mit einem Gruße an die Menschen auf Erden, und dann wieder in die Ewigkeit verzitternd. – Am Kirchlein wuchs der Schlehdorn und die Hagebutte und anderes Gesträuche mit rothen und weißen Rosen. Daneben war braunes Erdreich aufgeworfen, und hier war das Grab.
Der Zug stand still und bildete einen weiten Kreis. Die Träger setzten die Bahre ab, lösten den Sarg von den Stangen los und ließen ihn langsam hinabgleiten in die Tiefe.
Und als er hinabrollte, sangen sie den Grabgesang:
– – Das Lied verscholl, das Glöcklein schwieg. Der Harfenspieler saß in tiefer Traurigkeit auf dem Erdhügel.
Die Kerzen loschen aus und nur die blauen Bändchen des Rauches an den Dochten wehten hin wie Trauerfahnen. Die Erde rollte auf den Sarg; Kilian nahm den armen[S. 33] Witwer an der Hand und sagte: „Nun wißt Ihr, wo sie ruhen wird. Ihr werdet mit Eurem Saitenspiel wieder zu frohen Menschen gehen, Gott giebt Euch auch selber noch manchen heiteren Tag. So will ich Eins sagen: So lange Einer von Allen, die heute beisammen sind, im Edelwald lebt, wird dieses Grab in Ehren gehalten werden. Hier auf den Hügel pflanze ich dieses Kreuz. Der liebe Herr Jesus sei mit ihr und mit Euch und mit uns Allen.“
So hat er gesprochen, der schlichte, wackere Mann. Dann gingen sie auseinander nach verschiedenen Richtungen. Der alte Harfner gab Kilian noch einen Händedruck: „An Deinen Kindern wird’s vergolten – gewiß, gewiß!“ Noch einen kurzen Blick auf das Grab – dann ging er davon, dem Thale zu, wo die Landstraße war.
An der Kapelle war es wieder still geworden, nur ein leises Lüftchen wehte, säuselte in den Zweigen und summte in den Saiten der zerbrochenen Harfe, die an einem Baume lehnen geblieben war.
Gegen Abend desselben Tages kam der Wilderer Hans, schlich hinter die Kapelle, steckte sein Gewehr zusammen, lud, untersuchte es und lauerte. Bald darauf schritt den Fußsteig, langsam und gemächlich, der Jäger Franzinger heran. Er war in schmucker Tracht mit grünem Federhut, war ausgerüstet mit Waidtasche, Pulverhorn, dem Hirschfänger und dem Doppelstutzen, der lässig über seiner linken Achsel hing. Jetzt stand er still und zündete sich eine Pfeife an.
Hans legte den Lauf seiner Büchse an einen Baumast, da er die linke Hand in der Binde trug, und zielte gegen den Jäger. Dieser hatte eine kleine Mühe, der Wind löschte ihm immer die Streichhölzchen aus. Nun griff er zu Schwamm und Feuerstein.
„Mein lieber Franzinger,“ murmelte der Wilderer bei sich, „Dein Feuermachen ist umsonst, Du mußt jetzt sterben.“ Er tastete mit dem Finger nach dem Hahn – da hört er ganz nahe neben sich etwas, wie Harfenspiel. Hans fuhr zusammen, da fiel das Gewehr auf den Boden und entlud sich in die Luft. Der Jäger stieß einen Fluch aus, sah den Wildschützen und verfolgte ihn. Beide verloren sich in den Dickichten des Waldes.
Nach einigen Tagen, als Baldrian, der junge Meisterknecht, und seine anmuthsvolle Braut auf ihrem Hochzeitsgange an der Kapelle vorüberkamen, lehnte am Baume neben dem Grabe noch die Harfe und ein niederhängender Zweig, der im Windhauche sich bewegte, spielte sacht’ in den Saiten.
Im nächsten Frühjahre wucherte es neu und üppig um die Kapelle und wob das Grab in ein reiches, dichtes Geranke von immergrünen Blättern. Die alte Harfe mit den drei zerrissenen Saiten hing im Kirchlein an der Wand und hängt noch heute dort. Ueber derselben hat Jemand folgende Inschrift anbringen lassen:
Drei Jahre nach dieser Begebenheit hat sich Folgendes zugetragen:
Kam an einem stillen, friedlichen Herbstabende der alte Kilian spät vom Walde heim in sein Haus, nahm sein[S. 35] Enkelein auf den Arm, herzte es, küßte es, sah es an und immer wieder an und hatte Wasser in den Augen. Von diesem Tage an war er ernst und in sich gekehrt, aber noch milder und gütiger gegen die Seinen als sonst.
So fragte ihn Agnes einmal, warum er nicht mehr so lustig sei wie sonst, ob ihm was fehle?
„Ich weiß mich gesund,“ sagte der Kilian, „aber einmal wird’s wohl auch für uns zum Urlaubnehmen sein.“
„Vater, wie kommt Ihr auf solche Gedanken?“
„Ich will Dir’s wohl sagen, Kind. Wie ich das letztemal oben an der Hubertskapelle vorbeigehe, denke ich, sollst einen Augenblick weilen und ein Vaterunser beten für Deine Verstorbenen. Und wie ich in der Kapelle niederkniee – es dunkelt schon, ’s ist recht still und ich bin der einzige Mensch weit und breit – und wie ich bete, da hebt auf einmal ganz von selber die Harfe an zu spielen. Sie spielt ganz voll, spielt auch mit den drei zerrissenen Saiten, spielt ein Lied, wie ich es meiner Tage nicht gehört hab’. – In Gottesnamen, denke ich, das ist mein Zeichen. Ich habe nämlich dazumal, wie wir die Harfnerin begraben, bei mir den Gedanken gehabt: Wenn ich mir für den Christendienst Eins könnte wünschen, so wäre es das, es möchte mir einige Zeit vor meinem Sterben eine Weisung zukommen, daß ich nicht so unverhofft fort müßte, wie die arme Frau. Das Zeichen habe ich vernommen. Jetzt, mein liebes Kind, weißt Du es.“
Darauf stand es noch an sechs Wochen lang, und der gute Mann war eingegangen in das Reich, wo die Seligen den Harfenklängen des gesalbten Sängers David lauschen.


Weinles’jubel im Land!
Sang und Klang, Schwänke und Späße, Springen und Eilen. Die Sonne als die Festgeberin legt Goldschein über die Gegend; der Himmel hat sein Sonntagsgewand an, den schönen blauen Mantel, der durchsichtig ist wie Glas und dennoch die Geheimnisse der Unendlichkeit verdeckt. Wer auch frägt danach, was oben, so lang’ die Erde Trauben beut!
Alle Schornsteine der Höfe, der Winzerhäuser hingegen plaudern in bläulichem Athemhauch das Geheimniß des Herdes aus und andere Umstände lassen vermuthen, daß in den Kellern alle Spundlöcher und Pippen offen sind.
„Jetzt giebt’s wieder was zu trinken für ein ganzes Jahr!“ so jauchzt die Welt auf und deswegen das heitere Treiben und der Weinles’jubel im Lande.
In den Reben der Hügel und Hänge an der Seim ist’s alllebendig. Weißärmelige Burschen, knappgeschürzte Mädchen mit krummen Messern, mit Körben und Kübeln schlüpfen herum, schier zu sehen, wie ein gegenseitiges Verstecken und Fangen in den Büschen. Und die Dorfmusikanten[S. 37] versuchen in hellen Stößen ihre Trompeten oder kochen erst ihre heiser gewordenen Clarinetten in Rindsfett aus, damit diese Pfeifen für den Abend glatte, weiche Stimme kriegen. Und die Schäker der Gegend sinnen heimlich auf Possen und Schabernack, sinnen auf Vermuthungen und tolles Gespiel; den Mädchen rieselt schon das leichtlebige Blut in den Füßen um; – nimmer mögen sie es von Astronomen gehört haben, daß Alles in der Welt tanzt und kreist – es leuchtet ihnen selber ein und sie besonders halten gerne mit, bei dieser trefflichen Weltordnung.
Die Seim, die aus dem Gebirge und den finsteren Wäldern kommt, thut weit ihr blaues Auge auf über ein so fröhliches Land. Aber dieses Völklein schert sich um das schöne klare Wasser nicht – es hat ja den Wein.
Hei! Zwei Rößlein traben die Straße von oben heran.
Zwei Rößlein und ein Wagen dran. Der Wagen ist gut lackirt und hat einen prächtigen Polstersitz für Zweie. Sitzt aber nur Eines drauf. Thut nichts, der Mensch ist ein bevorzugtes Wesen, kann sich behelfen, dehnen und breiten, zumal, wenn es die genügende Anzahl gut gestärkter Röcke am Leibe hat.
Im Wagen sitzt eine wohlbehäbige und doch wieder rührsame Frau und ihr Angesicht blüht wie eine Pfingstrose im Juli. Wohl, auch im Juli kann eine solche Rose noch sehr schön sein; ein paar Mückenstiche in den Blüthenblättern, ein paar Runzelchen, so fein wie ein Spinnwebfaden – ei, wer wird so genau gucken! – Goldfarbiges Haar ferner – ich meine die Frau im Wagen – und goldfarbige Brauen über den kecken Aeuglein sind nicht zu verachten, und der Wohlduft – ich spreche wieder von der Rose – kann im Juli ganz bestrickend sein. Sie hat – es handelt sich um[S. 38] die Frau – ein schwarzseidenes Kopftuch über, aber nicht am Nacken geknüpft, wie es die Weiber der oberen Gegend tragen, sondern unter dem runden Kinn leicht zusammengebunden, so daß über der glänzenden Stirne das Goldhaar und am Halse die Silberkette mit der vornehm gearbeiteten Schnalle noch zu sehen ist. Ein flammend-rothseidenes Schultertuch mit fliegenden Fransen geht in Form eines ungeheueren Herzens nieder über den ausgebreiteten Busen – ein sinniger Schild vielleicht dessen, was drinnen lebt und webt. –
Wir würden es zwischen den gestauten Kleidern durch kaum bemerken, daß die Frau ein Paar sehr feingestickte, aber fingerlose Handschuhe trägt, wenn sie mit den Händen jetzt nicht auf dem Rücken des alten Kutschers zu trommeln anfinge: „Sind sie denn gar zu nichts nutz, Deine großen Ohren! Aber Michel! Michel! hörst! langsam fahren sollst! Das beutelt Einem ja gottswahrlich die Seel aus dem Leib!“
„Die Seel’?!“ wiederholt der Alte gedehnt, „die Seel’ meinst, Bäuerin? – Ja so, geschlachter fahren soll ich.“
Und es ging langsam.
Da konnte die Frau im Wagen die Arbeiten in den Weinbergen bequemer betrachten. Mancher heiteren Gruppe von Winzern, die nahe der Straße war, grüßte sie mit leutseligem Kopfnicken zu, und wenn Einer seine Mütze schwang, winkte sie sogar mit den Händen.
Jetzt kam glatt neben dem Weg und nahe dem schönen Flusse ein Häuschen mit weißer Mauer und grünen Fensterbalken. Durch die enge Thür eilte Groß und Klein geschäftig aus und ein, wie Bienen bei ihrem Korb. Mit Butten und Plutzern gingen die Erwachsenen die Kellerstiege auf und ab und die Kinder nippten und naschten aus kleinen Töpfchen den trüben, süßen Most der Traube. Unter einem[S. 39] Dachvorsprung des Häuschens ächzte der Preßbaum und man hörte das Rieseln des Saftes. Daneben in einer riesigen Kufe sprang und hüpfte ein Bursche um. Es war ein hübscher Junge voll Leben und Lust. Das dunkle Gelocke seines munter gehobenen Hauptes, der helle Blick – die Farbe des Auges kann für’s erstemal nicht so genau besehen werden – die frischen Wangen, der zarte Flaum an der Oberlippe und die milchweißen Zähne spielten gut zusammen. Nur mit Hemd und Leinenhose war er bekleidet; das Hemd war bis über die Ellbogen, das Beinkleid bis über die Kniee aufgeschlagen.
Die schlanke Gestalt paarte Kraft und Geschmeidigkeit in sich, man sah’s an den kecken und anmuthigen Bewegungen, die der Bursche tanzend und schwingend in der Kufe ausführte. – ’s hat aber auch nicht jeder den Tanzboden so wie dieser Jüngling – er tanzte auf schwellenden Trauben und hochauf spritzte bisweilen ein Tropfen zu dem behendigen Körper.
Aus dem Hause kam ein betagter Mann mit gebeugtem Nacken und grauenden Locken; „Felix,“ brummte er, „das darf nicht sein!“
Das Hupfen und Springen verwies er dem Burschen. Bedachtsam und vorsichtig müssen die Trauben zertreten, zerquetscht werden, ehe sie in die Presse kommen. Das war aber nicht die Sache des lustigen Jungen, der sich lieber in eitel Wein gebadet hätte, als mit den Zehen träge die vollen Beeren zu zerdrücken.
An diesem Winzerhäuschen war’s, wo die aus oberen Gegenden heranfahrende Frau ihre ganze, gar nicht schwache Stimme zusammennahm, um dem Kutscher zu bedeuten, er möge die Pferde anhalten. Erst hatte sie dem Keltern und besonders dem Traubentreter mit Wohlgefallen zugesehen, war dann mit Hilfe des alten Michel aus dem Wagen gestiegen,[S. 40] hatte freundliche Worte an die Kinder gerichtet und war hernach rauschend in das Haus getreten.
„Wie heißt’s bei Euch?“ hatte sie gefragt.
„Im unteren Viertel.“
„Das weiß ich gleichwohl,“ sagte sie, „das ist die Gegend; wie es da bei Eurem Hause heißt, möchte ich wissen.“
„Beim Froschreiter,“ war die Antwort.
„Beim Froschreiter? Aber na, das ist schon gar!“ kicherte sie, „na, macht nichts. Ich höre, der Froschreiter hätt’ Wein zu verkaufen.“
„So!“ versetzte der Alte mit dem gebeugten Nacken, „da hört die Frau nicht gut. Ich kann keinen Wein verkaufen.“
„Warum denn nicht?“
„Weil ich keinen habe.“
„Ich höre aber doch dort unter der Presse den Brunnen rinnen.“
„Den höre ich auch,“ sagte der Alte, „’s ist der Wein meines Herrn in Zollau.“
„Wer ist denn Euer Herr?“
„Der Herr Baron, der auf dem Schlosse wohnt.“
„Ist schön,“ versetzte die Frau, „und da am Flusse habt Ihr für den Most das Wasser nicht weit zu holen.“
„Diesen Spaß haben mir schon Viele gesagt“, entgegnete der Winzer, „wer meint, daß man ohne Wasser Wein machen sollt’, der weiß nichts.“
„Aber schade, daß der Wein nicht Euer ist,“ sagte sie im Tone des Bedauerns.
„Gehört halt dem Herrn Baron,“ antwortete der Alte.
„Ei, und die vielen herzigen Kinder hier!“
„Gehören mir.“
„Gehören Euch; wie viel sind ihrer denn?“
„Du, Franz!“ rief der Winzer hinaus, „bring’ der Frau einen Stuhl zum Sitzen. Guido, schieb’ dieweilen die Kellerthür vor, daß die Kleine nicht hinabrutscht. Und Du, Bärbel, sag’s der Hanne, sie soll gehen das Fritzel locken, es schreit ja wie ein Zahnbrecher; der Anton hat’s wachgejohlt mit seinem lauten Maul. – Wie viel ihrer sind?“ – Er zählte die Namen an den Fingern ab. „Daheim hab’ ich bislang nur achte. Die anderen sind im Dienst herum.“
„Segen Gottes!“ lachte die fremde Frau.
„Und Jedes hat ein Schock gesunder Zähne! Das muß man nehmen. Und jeder Zahn will was zu beißen haben.“
„Der da draußen,“ fuhr die Frau fort und ließ sich knisternd auf den gebotenen Sitz nieder, „der da in der Kufe, ist das auch Euer Sohn?“
„Denk wohl,“ antwortete der Winzer.
„Ein netter Bursch’.“
„In soweit just nit übel. Werden ihn bald einspannen jetzt.“
„Einspannen? Wieso?“
„Auf’s Jahr ist er bei der Stellung (Assentirung),“ murmelte der Alte, und nach einer Weile setzte er bei: „Den räumen sie mir.“
Die Frau verstand wohl den Ausdruck, entgegnete aber nichts darauf, sondern sagte zu einem der kleinen Mädchen: „Wie heißest Du? Bärble heißt – schau, da hast einen Groschen. Und willst mir dem Fuhrmann da draußen sagen gehen, er sollt’ die Rösser in den Schatten führen und ihnen Heu geben. Mußt ihm’s aber recht in’s Ohr schreien – verstehst!“ Dann zum alten Froschreiter: „Na, ich hätt’ doch gemeint, Ihr gäbet der Ländhoferin vom oberen Viertel ein Fäßlein Heurigen.“
Jetzt lugte der Alte die Frau eine Weile an, kraute dann in seinen dünnen Haaren: „Und das wäre die Ländhoferin? Die groß’ Bäuerin von der grünen Länd? Ist mir eine rechte Ehr’, das.“
„Freilich,“ sagte die Frau und fühlte sich recht behaglich im Stübchen, „bin die Bäuerin von der Länd’, fahr’ Wein kaufen aus; wisset, im Haus braucht man für’s Jahr so sein Tröpfel. Seit mein Alter – Gott tröst’ seine Seel’ – todt ist, muß ich halt selber fahren. ’s ist viel Gescher für eine Frau.“
Von der Küche kam die Winzerin herein, sie breitete für das Mittagsmahl eine blaue Schürze über den Tisch. „’s ist gar zum schämen,“ murmelte sie für sich, aber so laut, daß es die Fremde wohl hören konnte, „hell zum schämen – das Tischtuch liegt im Waschtrog.“
„Nein,“ erinnerte der kleine Anton treuherzig, „Mutter, in’s Tischtuch hast Du ja den Fritzel eingewickelt!“
Eine große Schüssel mit dampfenden Erdäpfeln kam auf den Tisch; da polterte schon zu allen Löchern der Kinderschwarm herein. Unter diesen in Holzschuhen jetzt, aber immer noch mit aufgestrecktem Beinkleid der lustige Traubentreter, der Felix. Er bot der Frau kurz einen guten Tag und wollte sich des Weiteren nicht um sie kümmern, aber der Alte sagte: „Du, das ist die Ländhoferin. Dem Bärbel hat sie schon Geld gegeben.“
Da lächelte der Bursche ein wenig gegen die Frau hin und das war die ganze Ehrenbezeigung.
„Meinetweg’, Leut’, setzt Euch nur zusamm’, wie’s bei Euch der Brauch, und esset!“ rief leutselig die Großbäuerin und blickte mit wachsendem Wohlgefallen auf den jungen Mann, Felix geheißen, der jetzt in seiner feinen und kecken[S. 43] Gestalt mitten unter den Kleinen stand und das Tischgebet sprach. War ihm leicht anzusehen, daß er dabei an alles Andere eher denken mochte, als an den Sinn des Gebetes. Auch schnitt er während des Gemurmels Schwarzbrot auf, vertheilte die Beinlöffel und zog einigen Erdäpfeln die Haut ab.
„Wart’ nur, Du!“ verwies ihn hernach seine Mutter, die Winzerin, „hast zum Beten nicht Zeit zur rechten Stund’, so wird der Herrgott auch nicht Zeit haben, wenn Du ihn brauchst!“
Felix saß schon am Tische und schlug seine Erdäpfel mit der Faust zu Trümmern, daß sie gehörig ausdampfen konnten.
„Wenn wir halt unsere Einladung machen dürften!“ sagte der alte Winzer und schob einen Löffel gegen die Großbäuerin, „viel haben wir nicht aufzuwarten, aber ein warmer Bissen ist gut für einen Reisenden.“
Die Ländhoferin nahm die Einladung an.
„Ruck’, Felix, daß sie Platz hat!“ gebot der Alte.
Da rückte der Bursche in den Tischwinkel hinein, die Bäuerin setzte sich an seine Stelle und lachte: „Das ist mir schon recht, ist die Bank noch warm, krieg’ ich Deine Kraft.“
Auf dieses Sprichwort lachten sie Alle und die Kinder wurden bald bekannt mit den Seidenfransen der Gastin.
Nach den Kartoffeln und einem Suppengerichte kam gebratenes Fleisch mit Kreenmus. Da machten sie einmal Augen und Mund auf; und selbst dem Alten zuckten die dürren Finger nach der Gabel, doch war er so höflich, der Großbäuerin den Vortritt zu lassen.
Als dann jedes sein Stück Braten auf dem Teller kleinschneiden wollte, war nur ein einzig Messer bei Tisch; dieses – das Brotschneidmesser – machte die Runde. Den[S. 44] Kindern wurde beim Zuwarten die Zeit zu lang und sie zerrissen ihre Stücke mit den Zähnen. Der Felix klappte sein Taschenmesser auf und machte des Weiteren nicht viel Umstände mit dem Schweinernen, das heute vom Zollauer Schloß gekommen war.
„Na, schmeckt’s?“ fragte die Ländhoferin ihren Beisitzer.
Dieser gab die Antwort durch die That; ’s ist nicht Schwätzenszeit, ’s ist Essenszeit – so aß er.
„Alle Jahre vier- oder fünfmal, daß wir Fleisch essen,“ bemerkte der Alte.
„Wirst jeden Tag Dein Stück haben, bei den Soldaten,“ meinte die große Bäuerin und sah auf den Burschen hin.
„Brauch’ es nicht,“ war die Antwort.
„Das glaub’ ich schon,“ sagte sie, „Soldatenfleisch wär’ auch mein letztes.“
„’s wird Keinem darnach lüsten.“
„Eine harte Sach’, Soldatenleben,“ versetzte die Großbäuerin, „auskaufen!“
„Ja – ha – ha!“ lachte der Alte auf, „mit Haselnussen.“
„Oder auf Haus und Hof heiraten,“ schlug die Ländhoferin vor.
Diese Geschichte trug sich nämlich noch zur Zeit der alten Einrichtung zu, unter welcher der Jüngling durch Erlegung einer gewissen Geldsumme, oder durch den Besitz eines steuerbaren Hofes vom Wehrdienste entpflichtet werden konnte.
Als vom Heiraten die Rede war, nagte Felix mit seinen frischen Zähnen an einem Knochen, daß es scharrte.
„Schade,“ sagte die Großbäuerin fröhlich lachend, „wär’ ich ein etlich Jährchen älter, thät’ Dich gleich zum Sohne[S. 45] annehmen, Felix, und Dir den Ländhof verschreiben. Hab’ ohnedies kein Kind.“
„Na, wär’ gut gemeint,“ versetzte der alte Froschreiter.
„Bedank’ Dich, Bub’,“ mahnte die Mutter.
„Was bedanken, wenn die Ländhoferin noch zu jung ist,“ murmelte der Bursche in seinen Knochen hinein.
Dieses Wort schien auf die Großbäuerin einen durchaus angenehmen Eindruck zu machen.
„Freilich,“ sagte sie, „was ich zu jung bin zur Mutter, bist Du zu alt zum Kind. Da wollt’ ’leicht der Sohn heiraten und die Mutter möcht’ etwan auch noch Hausfrau sein – wie das schon geht.“
Der kleine Anton, der bisher, mit hellen Aeuglein lugend, ernsthaft dem Gespräche zugehört hatte, machte nun plötzlich den noch von Schweinsfett glänzenden Mund auf und that den Vorschlag: „So sollen die Ländhoferin und der Felix zusammenheiraten.“
Ein überlauter Auflacher, ein Rippenstoß von Seite der Mutter dem kleinen Antragsteller – dann Alles still.
Der kleine Anton war hoch erröthet. Seinem älteren Bruder, dem Felix, ging’s nicht besser; der saugte mit aller Macht aus seinem Knochen das Mark. Dann wischte er die Finger an dem Schürzentischtuch, den Mund am Hemdärmel ab und noch vor dem Dankgebet ging er hinaus zu seinen Trauben.
Er war ärgerlich. Er hatte sich so lange schon auf den heutigen Braten gefreut – und nun ist es sehr ungemüthlich dabei zugegangen.
Die Kinder waren auch bald davon. Die Großbäuerin jedoch war, da sie gerade so bequem saß, bei dem alten Froschreiter noch am Tische sitzen geblieben.
„Na, wahrlich, ich bin sonst nicht so,“ sprach sie, „aber da bei Euch ist mir schon ganz heimisch geworden. Ihr lebt recht zufrieden mitsammen.“
„Dasselb’ wohl, dasselb’,“ versetzte der Alte, „aber halt die Sorgen, die Sorgen. Alleweil schickt mir der Herr Baron keinen Braten, Ländhoferin, das ist nur zur Weinles’. Sind froh bei unseren Erdäpfeln und beim Kukuruzbrot, ei ja wohl, sind häufig froh dabei! Wär’ nur das fort genug, Ländhoferin, wär’ nur das genug!“
„Na, im Spaß und im Ernst,“ sagte jetzt die Bäuerin, „Winzer, gebt mir den Felix auf meinen Hof. Mit dem Dienstvolk ist’s ein Kreuz; man braucht Einen, auf den man sich verlassen kann.“
„Wär’ schon recht,“ wendete der Alte ein, „aber die Ländhoferin kann ja nicht wissen, ob auf meinen Buben auch ein Verlaß’ ist.“
„Ei ja,“ versetzte sie lebhaft, „das merkt man Einem gleich an.“
„Und nachher –“ sagte der Froschreiter kleinlaut, „nachher hätt’ ich noch erst den Großen weg, der mir ohnehin auch daheim sein Essen verdient. Und auf’s Jahr zur Stellung müßt’ ihn die Ländhoferin doch wieder fortlassen.“
„Davon red’ ich ja,“ rief sie, „und deswegen geht er auf den Hof, daß er nicht zu den Soldaten müßt’, das bring’ ich zuweg; wisset, Froschreiter, Unsereins weiß da schon aus.“
„Ja!“ seufzte der Winzer wie erleichtert auf, „da thät der Bub’ freilich sein Glück machen!“
„Thut Euch’s überlegen,“ sagte die Großbäuerin, „ich fahr’ heut’ nach Zollau hinaus und vielleicht noch weiter in’s untere Viertel hinein, bin dort daheim und will was Rechtes suchen. Wisset, Froschreiter, in meinem Hause muß[S. 47] fort ein guter Tropfen sein. Ah na, abgehen lassen wir uns nichts auf der Länd’, das hat’s bei mir nicht noth. – Nu, in ein paar Tagen mag ich von unten zurück sein, da frag’ ich bei Euch zu und der Felix kunnt gleich mitfahren. Thut Euch’s überlegen.“
Als sie dann ging, reichte sie jedem von den Kleinen, die sich herandrängten, um ihr nach der Eltern Weisung die Hand zu küssen, eine Kupfermünze. Nur der kleine Anton nahm wahr, daß sein Geschenk ein glänzendes Silbergröschlein war.
„Der Felix, der kriegt nichts, weil er so stolz ist!“ rief sie gegen die Kufe hin. Das Lächeln aber, mit dem sie die Worte sprach, schätzt der Erzähler dieser Ereignisse gut über einen Silbergroschen.
Der alte Michel hatte sich, nachdem er den Pferden das Ihre gegeben – unter einem Birnbaum an drei großen Aepfeln und einer Traube geatzt, die ihm vom Felix zugekommen waren.
Als er mit seiner Herrin wieder auf dem Wagen saß und die Pferde fröhlich hintrabten, wendete er sich auf dem Bock nach rückwärts und sagte:
„Das ist ein recht kamod’s Bürschel, der Traubentreter.“
„Gelt, Michel!“ rief die Großbäuerin leuchtenden Auges, „was meinst, wenn wir statt jungem Wein einen jungen Winzer mit auf den Ländhof brächten!“
„Jungen, sagst?“ entgegnete der Kutscher unsicher, „ist damit um diese Zeit noch nichts anzufangen; zersprengt die Fässer.“
Die Bäuerin lachte; der schwerhörige Fuhrmann hatte sie wieder einmal mißverstanden.
Unter dem Birnbaum, auf dem Rasen, wo zur Mittagszeit der alte Michel geruht hatte, saß am Abend der hohe Rath des Froschreiterhauses.
Der Felix hatte sich schon einen gewaltigen schafwollenen Schnurrbart zubereitet gehabt, gesinnt, denselben an diesem Abende an seine Oberlippe zu kleben, sich dergestalt bei den Weinlesefesten der Nachbarschaft einzufinden und den schönsten Mädchen der Gegend beim Tanze keck das Ding an die Wangen zu reiben. Nun überließ er den bereits scharf gewichsten Bart dem kleinen Anton, der sich damit sofort auch ein ganz martialisches Aussehen beilegte.
Felix hatte an Anderes zu denken. Lag er denn unter dem Birnbaum auf dem Bauch, stützte die Ellbogen in den Erdboden und sein Haupt auf die Fäuste und starrte in’s Gras hinein.
„Sollten es uns überlegen,“ meinte der Alte, welcher ebenfalls auf dem Rasen lag und seinen krummen Nacken streckte, „sollten es uns überlegen, hat sie gesagt.“
„Hab’ nichts zu überlegen,“ antwortete Felix, „ich fahr’ mit auf die Länd’!“
Da brach die Mutter in Schluchzen aus. „Jetzt verlangst auf einmal weg. Sag’ es, Felix, was Dir daheim nicht recht ist.“
Auf dieses Wort kugelte sich der Bursche über und sagte: „So nicht, Mutter, so müßt Ihr Euch nicht denken. Mich gefreut’s ja daheim, aber wenn man sich’s besser machen kann – Jeder thut’s.“
„Und wenn sie ihn vom Soldatenleben sicher macht,“ versetzte der Froschreiter, „das wär’ ja ein ewiges Glück!“
„Ja freilich wär’ das ein Glück,“ gab die Mutter bei und trocknete mit der Schürze die Augen.
„Mutter,“ rief der kleine Anton jetzt, „das ist so ein Räthsel: geht er fort, so bleibt er daheim, und bleibt er daheim, so muß er fort, was ist das? Das ist der Felix.“
„Du Schlingel, Du kleiner,“ schmunzelte der Vater. „Du mußt schon ein Doctor werden. Dann muß aber der Schnurrbart weg. Den Schnurrbart lassen sich nur die Starken stehen, die Gescheidten den Backenbart.“
„Und wie weit wird’s denn sein bis auf die grüne Länd’?“ warf Felix ein, „in Einem Tag kommt ein guter Geher leicht hin und zurück.“
„Du nicht, Du kommst mir nicht in Einem Tag zurück!“ schluchzte die Mutter.
„Aber zu den heiligen Zeiten kann ich doch heimgehen. Das will ich mir ausdingen.“
Und als der Vollmond aufging über den Weinbergen und als in der Seim das Zickzack seines Widerscheins zitterte, war es beschlossen unter dem Birnbaum: der Felix geht mit der Großbäuerin auf die grüne Länd’.
Der kleine Anton drehte zur Feier dieses Beschlusses den schafwollenen Schnurrbart auf.
„Wenn’s nur nicht gefehlt ist!“ sagte des anderen Tages die Froschreiterin, „mich deucht allerweil, es soll nicht sein.“
„Geh, geh,“ rief der Alte, „Ihr Weiber habt fortweg so Flausen. – Auch mir geschieht nicht leicht, daß ich den Buben weggeb’; ja, wenn sich Eins immer nachgeben wollt! – Junge Leute müssen hinaus in die Welt, müssen was probiren. Das leidig’ Soldatenleben nehm’ ich aus, aber das muß ich sagen: wär’ ich weiter gekommen, als vom Tisch bis zum Ofen, ’leicht ging’s mir besser. – Und die[S. 50] Ländhoferin,“ setzte er bei, „die Großbäuerin, scheint mir, ist eine brave, respectirliche Frau.“
Einen Tag später trabten die zwei Rößlein wieder heran und – einen Stich im Herzen gab’s dem Burschen – er glaubte schon, der Wagen wollte nicht halten. Der Wagen hielt aber. Die Großbäuerin stieg aus und that noch freundlicher gegen Alle und sie war in ihrer Rührsamkeit und Heiterkeit fast jung.
An den rothgeweinten Augen der Mutter sah sie’s gleich: der Felix geht mit ihr. Sofort machte sich die Ländhoferin an das betrübte Weib und sprach über die Kinder, über den Garten, über die Hühner und Alles, woran eine rechte Hauswirthin Freude hat. Da wurde die Froschreiterin ganz zutraulich und band unter neuerlichem Schluchzen ihren Aeltesten, ihren liebsten Buben, der Großbäuerin recht an’s Herz....
Und nach einer Weile kam der Felix aus seiner Dachkammer herabgestiegen. Der Felix im Staate! Die Tuchkleider waren just nicht zu geschlacht, aber nett und nach gutem Geschmacke geformt. Alles hübsch schlicht, nur das hellrothe Halstuch flatterte vor dem breitüberschlagenen Hemdkragen wie ein keckes Kirchweih-Doppelfähnchen. Der Hut war etwas in die Stirne gedrückt, nur ließ er noch die beiden Haarbüschel sehen, die an den Schläfen herunterstanden.
Eines der kleinen Mädchen bringt einen Strauß von Rosmarin und Vergißmeinnicht: „Felix, den Wanderbuschen geb’ ich Dir mit!“ Jedes will dem scheidenden Bruder etwas geben; der kleine Anton nur sagt: „Felix, ich habe gar nichts als das schwarze Lämmchen, aber das gehört dem Vater.“
Die Mutter hatte das Bündel gebunden – es war nicht groß.
„Das macht nichts,“ sagte die Ländhoferin, „auf meinem Hof wird ihm nichts abgehen. – Kannst das auch noch daheim lassen, Felix, meinetweg gar Deinen Rock. Der liebe Gott – hat mein Vater fort gesagt – schaut nicht auf die Kleider, schaut nur auf’s Herz. Der Ländhof macht’s auch so.“
Wird wohl rechtschaffen gut auszukommen sein mit der Bäuerin, dachte sich der alte Froschreiter.
„Bleib mir nur brav, Bub’,“ sagte er, „und mach’ uns und Deiner Dienstfrau keine Schand’. Thu’ fleißig arbeiten und kriegst was, so sei dankbar und allerweil sparsam. Denk’ auf den Bettelstab, Felix!“
„Was nicht noch!“ rief die Bäuerin, „Bettelstäbe wachsen nicht auf der grünen Länd’.“
„Und vergiß nicht auf’s Beten,“ fiel die Mutter ein, „da hast einen Rosenkranz mit, ist noch von meiner Mutter selig.“
„Ja, ja, Samstags – Samstags wird auf dem Ländhof Rosenkranz gebetet,“ unterbrach die Großbäuerin ein bischen gereizt, „und zur Christenlehr’ kann er Sonntags gehen.“
Dann setzten sie sich zu einem kleinen Mahle. Aber es wurde nicht viel gegessen.
Der eigentliche Abschied war kurz. Die Ländhoferin hatte plötzlich anspannen lassen und die Pferde waren ungeduldig. Noch hatte die Bäuerin der Winzerin ein Papier in die Hand gedrückt: „Seh’, seh’, nicht fallen lassen!“ noch hatte sie dem Froschreiter versichert: „Wird Euch nicht reuen, daß er mitgeht, wird Euch nicht reuen!“ Dann saß sie mit Felix schon auf dem Wagen.
Einen Händedruck dem Sohne, noch ein väterliches Wort – und das Zeug rasselte davon.
Der Bursche winkte mit der Hand, mit dem Hut noch zurück, die Eltern und Geschwister winkten, weinten ihm nach.[S. 52] Da war der Wagen auch schon um die Reide und sie sahen von dem Gefährte nichts mehr als den aufgewirbelten Staub.
Nach einer Weile, da es im Winzerhäuschen wieder still geworden und Jegliches bei seiner Beschäftigung war, nur die eine Lücke, wo der älteste Sohn gewaltet, unausgefüllt – stand die Winzerin am Herd, um die Pfanne auszuscheuern, in der sie vorhin das Abschiedsmahl gekocht hatte. Sie hielt noch das Papier in der Hand, welches ihr die Ländhoferin zugesteckt. Sie entfaltete es – eine Geldnote. Da war ihr zu Muth, als hätte sie ihr Kind verkauft. Rüstige Arbeit half ihr über den argen Gedanken hinweg. Plötzlich hielt sie ein und sagte laut zu sich selber: „Na, Jesu Christi, vergessen hab’ ich doch was. Eins hätt’ ich ihm noch sagen mögen. – – Es ist ein gutherziger Bub. Mein Gott, das Kinderweggeben thut weh. Und man kennt die Leut’ nicht –“
„Mutter,“ sagte der kleine Anton, der ihr heute fortweg an der Kittelfalte hing, „Mutter, der Felix wehrt sich schon, wenn es gilt, o, der ist stark! Ich hab’s gesehen, es wachst ihm schon ein wenig der Schnurrbart.“
Sie küßte den Knaben – ei ja, sie hatte noch liebe Kinder daheim.
Und wie ging’s auf dem Wagen zu?
„So, mein lieber Unterviertler,“ sagte die Ländhoferin zu Felix, „jetzt sitzen wir Zwei beisammen. Mach’ Dich nur bequem. Wir haben eigentlich noch gar nichts miteinander gesprochen.“
„Ich schwätz’ nicht gern viel,“ gab der Bursche zur Antwort, „mir wird die Zeit lang werden, bis wir auf die Länd’ kommen.“
„Geh!“ rief die Großbäuerin, „das ist nicht fein. So ein properer junger Mann muß sich die Zeit überall zu vertreiben wissen.“
„Wenn ich’s gerad’ sagen wollt’,“ versetzte Felix nach einer Weile, „am liebsten wär’ mir’s schon, ich dürft’ da vorn beim Kutscher sitzen.“
„Auf des Michel’s Schoß ’leicht, Du Lapp!“ lachte das Weib ärgerlich, „siehst doch, daß sonst kein Platz ist.“
„So kann sich der Michel zur Ländhoferin setzen und ich kutschir’. Versteh auch was bei den Rössern.“
„So! Dann will ich Dich auf dem Hofe zu den Pferden stellen, Felix – ei, der Kukuk hinein, jetzt muß ich Dir gleich was sagen. Felix, der gefällt mir, ist ein schöner Name, aber den Froschreiter laß’ im Unterviertel. Auf der grünen Länd’ giebt’s keine Frösche, da reitet man auf hohem Roß – verstehst?“
Für’s Erste ist ihr mein Name nicht recht, dachte sich der Bursche, es mag ein schwerer Dienst werden.
„Na, so strecke doch einmal die Beine ordentlich aus, Felix,“ rief die Bäuerin, „Du hockst ja da wie eine Eichkatz’.“
Da dehnte sich der Bursche und rieb dabei unversehens an ihren bauschigen Kleidern.
„Das macht nichts,“ bedeutete die Bäuerin, „das wird Alles wieder gebügelt.“
Gar nicht zu bestreiten, die Ländhoferin ist eine leutselige Frau. Haben bislang noch lauter Schönes von ihr vernommen. Sie ist in den besten Jahren, hat eine große[S. 54] Wirthschaft auf der Länd’ und will dem jungen kerngesunden Burschen über das Soldatenleben hinweghelfen.
Felix, da magst Du Dir bisweilen schon Einiges gefallen lassen. Und Deine Herrin ist sie jetzt! Darum, so oft sie’s haben wollte, rückte er, streckte sich und gab nicht Acht auf ihr Kleid.
„Und meinst, ich bin nicht auch von unten herauf?“ sagte die Bäuerin plötzlich, „Felix, so wie ich Dich heute auf dieser Straße in’s obere Viertel fahre, so hat mich vor elf Jahren – was sag’ ich denn, es ist nicht so lang’ – der alte Ländhofer auf dieser Straßen heimgeführt. Ist Witwer gewesen – ein rechter Hascher. In Weißenbach unten, da bin ich daheim, und da ist er einmal im Pferdehandel hingekommen und hat mich kennen gelernt. Bin nicht reich gewesen von Heim aus, Felix, hätt’ aber der Liebhaber genug gefunden. Aus reiner Barmherzigkeit, das kann ich wohl sagen, bin ich mit dem Großbauer gefahren und hab’ ihn geheiratet. Wenn’s Dich zu stark schüttelt, so halt’ Dich mit der Hand an dem eisernen Ring; der ist dazu da.“
Fand’s nicht praktisch, der Bursche, der eiserne Ring war so, daß er, um denselben zu fassen, seinen Arm über die Schultern der Beisitzerin hätte legen müssen.
„Finde es,“ fuhr sie fort, „bei einer Heirat gar nicht einmal nöthig, daß der Mann älter ist als die Frau; ich weiß Fälle, wo es gerade umgekehrt war und doch die beste Ehe ist gewesen. Ja – und daß ich’s erzähl’, mein Mann ist Dir um vierunddreißig Jahr’ älter gewesen als ich; wie ich’s gesagt: aus reiner Barmherzigkeit hab’ ich ihn gepflegt. Vor etlichen Monaten erst ist er gestorben – tröst’ Gott sein’ Seel’. Ich hab’ groß’ Haus und Hof am Hals und dazu ist sich oft die tüchtigste Frau völlig zu wenig. Was[S. 55] hast denn Du für eine Schramme an Deinem Finger?“ Sie faßte prüfend seine Hand.
„Im Auswärts beim Rebenschneiden ist das Messer hineingesprungen,“ berichtete der Winzerssohn. Sie ließ aber die Hand nicht mehr los, tändelte mit derselben und fuhr fort zu reden: „Mein Gott, man wehrt sich lang’, aber das Haus muß einen Herrn haben, man kann’s wenden wie man will. Die Mannsleut’ im oberen Viertel, das kannst mir glauben, ich hab’ meine Noth, wie sie sich bei mir einspinnen wollen. Aber ich hab’ kein Zusammensehen mit ihnen; sind lauter so ungeschlachte, langweilige Gesellen und hätten bei den Nachbarleuten auch nicht den Respect, den ein Ländhofer wohl haben muß. Ich will einen aus dem Weinland, von wo ich selber bin. Rauchst Du nicht Tabak, Felix?“
„Wüßt’ nicht warum,“ versetzte der Bursche.
„Sonst hätt’ ich Dir gern eine silberbeschlagene Pfeife von meinem Seligen spendirt zum Andenken. Lieber Gott, ich kann ihn hart vergessen; ist ein gutes altes Kind gewesen. Das aber sag’ ich, nach einem Reichen und Vornehmen lug’ ich nicht; g’rad zu alt darf er mir nicht sein und frisches Blut muß er haben, daß eine Schneid’ in’s Haus kommt.“
Jetzt machte Felix große Augen. – „Die heiratet mich!“ – Just, daß er’s nicht laut hinausrief in den Herbstnachmittag. Und daran spann er folgende Gedanken: Wenn sie mich heiratet, dann ist’s freilich aus mit dem Soldatenleben, dann bin ich der Ländhofer, der reiche Ländhofer, und kann mir gut geschehen lassen und kann meine Eltern in’s Haus nehmen und die Geschwister versorgen und den kleinen Anton studiren lassen. Das macht sich ja fein – „juch!“
Er jauchzte wirklich laut auf, der gute Junge, und er glaubte, nun wäre er mit sich und Allem in Richtigkeit.
„Das ist recht!“ rief die Bäuerin nach seinem Juchschrei, „nur lustig wohlauf und keck d’ran, mein lieber Landsmann! jungen Männern gehört die Weltkugel und der Sack dazu. Ich bitt’ Dich, Felix, jetzt ist mir die Haarnadel in den Nacken gerutscht!“
Das war nun eine heikle Sache; je mehr der Bursche ihr seidenes Halstuch lockerte, desto tiefer rollte das Drahthäkchen hinab und schließlich verschwand es in den Tiefen. Blieb demnach diese Aufgabe einstweilen ungelöst und deß’ schämte sich Felix insgeheim. Ihm, dem die Weltkugel gehört, soll eine Haarnadel entgehen?
Zwecklos ist nichts auf der Welt; zwecklos war auch dieser kleine Zwischenfall nicht gewesen. Als Felix’ Finger den Nacken der Bäuerin berührte, hatte diese ein Gefühl, das sie höher anschlug, als die hinabgeglittene Nadel.
Für die Gegend, die sie durchfuhren, können wir unter solchen Umständen kein Auge haben. Im Allgemeinen nahm die Landschaft allmählich einen ernsteren Charakter an; das Hügelgelände wurde zum Bergland, die Wein- und Obstgärten verschwanden, die Nadelwälder begannen. Zur Linken hatten die Reisenden ein sich allgemach höher bauendes Gebirge, über dessen Häuptern schon die Abendnebel des Herbstes lagen. Zur Rechten war stets der schöne Fluß mit den grünen oder felsigen Ufern. Hie und da stand ein Dorf; die Einzelnhöfe wurden immer seltener.
„Schau, dort ist wieder einmal ein Wirthshaus,“ sagte Felix plötzlich.
„Da im Wagen auch,“ entgegnete die Großbäuerin und zog einen gutgeräucherten Schinken und einen erdenen Plutzer hervor. Sie aßen vom Geräucherten und sie tranken Beide aus dem Plutzer. Trank sie, so hielt er ihr das Gefäß zu[S. 57]recht; sie erwies ihm denselben Dienst, nur hielt sie den Krug stets so, daß dem Burschen jedesmal viel mehr durch die Gurgel rann, als er eigentlich beansprucht hätte. Es wäre ihm aber ein Trunk auf bequemer Wirthsbank lieber gewesen. Nichtsdestoweniger fand er sich aufgelegt zum Singen und jetzt hielt er sich auch wacker am Eisenring, der jenseits seiner Genossin an der Wagenwand angebracht war. Das Weib hinwiederum war genöthigt, sich an dem Burschen festzuhalten, denn das Schütteln des Wagens wurde auf der Bergstraße immer ärger.
So weit kam’s, daß der gutmüthige Winzerssohn die Worte sagte: „Ich krieg’ keinen Athem mehr, Bäuerin!“
Als ob es ihr viel besser ergangen wäre! Ein arges Fieber war in ihr, ein Zucken in den Gliedern, ein Pochen im Herzen.
Die Erdenwege sind so herbe; der arme Pilger muß leiden und entbehren, kein Mensch kann’s glauben, was mitunter Eins in den Dreißigern aussteht!
Zum Glücke waren sie, als die Sonne unterging, auf der letzten Anhöhe. Da rief die Großbäuerin dem alten Michel „Halt!“ zu und raffte sich zusammen.
„So, Felix,“ sagte sie, „jetzt schau einmal hinab in dieses Thal, das ist die grüne Länd.“
„Wie heißt denn das Dorf dort mitten in den Bäumen?“ fragte der Bursche.
„Ein Dorf, meinst Du?“ lächelte die Bäuerin, „mein Lieber, das ist kein Dorf. Die Gebäude gehören alle zusammen, es ist der Ländhof!“
„Der ist groß!“ rief Felix aus.
„Ich denk’, wir werden Platz darin haben. Nicht wahr? Na, gelt!“
„Der ist groß!“ wiederholte Felix, „da kenn’ ich mich rein gar nicht aus.“
„Nu, paß’ einmal auf, Junge,“ sagte sie selbstgefällig, „dort das weiße Gebäude mit den zwei Fensterreihen ist das Wohnhaus. Unter den Bäumen hin rechts sind die Stallungen und Scheunen. Weiter rückwärts – man sieht ja die Funken aus dem Schornstein – ist die Schmiede und daneben mit dem Schindeldach die Mühle; sind drei Laufer; ich mahl’ für das halbe Oberviertel. Links vom Wohnhaus siehst Du die Dächer von einem zweiten Hause; in demselben sind die Vorrathskammern und die Gesindestuben. Das untermauerte Gebäude dahinter ist der Pferdestall; stehen fortweg sechs Rösser d’rin. Dann fangen die Obstgärten an, bis zum großen Anger hin, wo die Leinwandbleiche ist. Das Häusel daneben ist die Flachsbrechstube.“
Felix staunte und schwieg.
„Die grünen Wiesen,“ fuhr die Bäuerin fort, „die dort bis zum Wasser hingehen, geben dem Thal den Namen: die grüne Länd. Sie gehören alle zum Hof. Und dort der Birkenschach – die Schafweide – und die Felder bis hinauf zum Wald und die ganze Waldung, die dorthin liegt – und hinter ihr sind wieder Wiesen und Felder und Viehweiden und weiter hinauf die Alm – Alles gehört zum Ländhof. Ich hab’ achtzig Stück Rindvieh und über hundert Schafe, ich hab’ die Pferde und das Kleinvieh – im Ganzen wie viel – aufrichtig muß ich’s sagen – ich weiß es selber nicht. Nachher dort über dem Hof ist die Ueberfuhr über die Seim – kannst Du den gespannten Strang noch sehen? – Hast gute Augen. Und wenn Du mit der Plätten hinüberfährst an’s andere Ufer, so bist immer noch auf meinem Grund, Bis über den Bergschlag hin – Alles gehört zum Ländhof!“
Felix that einen Pfiff; das war ein Zeichen seines großen Staunens.
„Und dort,“ sagte er hierauf, „neben dem Schachen steht noch ein kleines Haus, das wird wohl nimmer dazu gehören.“
„Gehört Alles dazu!“ rief die Bäuerin, „ist aber nicht der Müh’ werth, ist das Ausnahmsstübel für die alten Leut’.“
„So wie in Zollau das Spital?“
„Auf ein Gleiches. Die alten Leut’, das sind die alten Besitzersleut’ vom Hof, welche die Wirthschaft den Jungen übergeben haben. Na, die haben im Häuserl dort ihr Ableben.“
„Nachher kommt die Ländhoferin auch einmal hinein,“ bemerkte der Winzerssohn, um zu beweisen, daß er die Sache begriff.
Darauf schwieg sie eine Weile.
Die Pferde trabten weiter.
Ein paar Bauersleute kamen des Weges und grüßten die Großbäuerin.
„Ja, ist schon recht,“ gab diese als Gegengruß, des Weiteren blickte sie gar nicht seitab.
Die Ländhoferin war überhaupt, je näher sie dem Gehöfte gekommen, desto gemessener, ernsthafter, ja fast herrisch geworden. Der Hirt, der eben die große Heerde vom Felde trieb und gerade noch lustig seine Schalmei geblasen hatte, machte ein mißmuthiges Gesicht, als er Roß und Wagen der heimkehrenden Bäuerin sah.
Felix grüßte ihm freundlich zu, als wollte er sagen: „Ich komm’ zu Euch und wir werden jetzt mitsammen leben und uns schon vertragen; ich bin ein lustiger Bursch!“
Als sie hernach in die Hofgasse einbogen und an der Leinwandbleiche vorüberrasselten, wo an einer Stange Garnsträhne zum Trocknen hingen, kam ein erwachsenes, aber[S. 60] zart gebautes, blasses Mädchen auf den Wagen zu und sagte in bescheidenem Tone: „Grüß’ Gott, Mutter!“
Die Bäuerin zerrte am Rockschoß des Kutschers: „Halten!“ Dann wendete sie sich gegen das anmuthige, helläugige Mädchen und rief: „Was, Du bist schon aus dem Nest, Du dalkete Dirn’! Und laufst um die Zeit auf der Gassen um? Du fragst einen Klenkas danach, was mir der Doctor kostet, wenn Dich wieder Dein Schönheitsfieber überkommt, Du unbesinntes Ding, Du! Und bist schon wieder so wohl und toll, so arbeit’ was! Siehst nicht, daß die Garnsträhne noch auf der Stang’ hängen? Sollen sie verfaulen?“
Tief erröthend und niedergesenkten Hauptes wendete sich das Mädchen und ging den Strähnen zu. Der Wagen rasselte in den Hof.
Da Felix nach solchem Auftritte die Bäuerin fragend angesehen hatte, so murmelte diese: „Ein einfältig Wesen das. Na ja, just, daß man sie nicht fortschaffen will, weil sie das Kind von meinem ersten Mann ist.“
Von meinem ersten Mann – so rutschte es ihr von der Zunge; war ihr doch, sie sitze eng neben dem zweiten.
Als der Wagen auf dem Standplatze vor dem großen Wohnhause still stand, kamen ein paar Weiber herangerannt, um die Herrin zu bedienen.
Einige Knechte, die abseits am Scheunenthor standen, glotzten nur so herüber und waren baß verwundert über den jungen Menschen, der mit der Bäuerin aus dem Wagen stieg.
Ein alter, einäugiger Kerl war unter ihnen, der knackte mit der Zunge, blinzelte mit dem einen Aeuglein und schnürfelte: „Hab’ ich’s nicht gesagt?! Hab’ ich’s nicht oft gesagt, der Alte dazumal hat die Birn nicht vom Baum brockt, sie ist schon auf der Erden gelegen. Heut’ bringt sie[S. 61] ihren ältesten Sohn; ’leicht hat sie noch etlich im unteren Viertel.“
„Mag wohl sein, das,“ gab ein Anderer bei, „im oberen Viertel kann sie keinen haben.“
Sie blinzelten gegenseitig, als ob sie sich verstünden.
„Wie viel Röck’ mag sie heut wieder am Leib tragen?“ warf der Einäugige aus, als die Bäuerin mit dem Burschen gegen den Eingang rauschte.
„Mag’s ein Anderer zählen.“
„Ist ein ganz prächtiger Kerl, der Junge. Schau wie fein! Jetzt läßt sie ihm gar den Vortritt in’s Haus.“
„Du, ihr Sohn, der kommt erst nach!“ bemerkte ein Anderer.
Da sahen sie sich vor dem Scheunenthor groß an und darauf murmelte der Einäugige: „Unsere Bäuerin ist gescheidt! – Das heißt Wein kaufen gehen!“
Es war gut, daß die Glocke zum Abendessen rief, da wurden die losen Mäuler mit Klößen gestopft.
Und erst das Weibervolk! Das war heute nachgerade verwirrt.
„Für mich und den Herrn das Essen auf’s Zimmer!“ hatte die Bäuerin befohlen.
„Der da,“ sagten sie in der Küche zu einander, „der mit dem geflickten Spenser-Ellbogen soll ein Herr sein? Zerrissen ist herrisch, geht das Sprichwort, aber geflickt ist bäuerisch.“
„Laß’ Zeit, laß’ Zeit,“ sagte eine Andere, „vielleicht hat er zerrissene Socken.“
„Ihr redet Alle wie nicht gescheidt,“ versetzte eine Dritte, „das muß man schon anders nehmen. Das ist nicht ein Herr, das ist der Herr! Versteht’s mich?“
Es wurde im Hofe die Suppe versalzen am selbigen Abend – so sehr war das Küchengesinde in Gedanken.
„Mir hat er gefallen,“ vertraute die Abwaschdirn’ der Köchin und rieb mit aller Macht an dem Milchzuber; – der Zuber wurde blank, aber das Wort war nicht mehr wegzulöschen.
Mittlerweile saß Felix, der junge Winzer, in der Stube der Bäuerin auf einem Ding, das wie eine gepolsterte Lehnbank war. Er saß sehr unbehaglich, denn das Polster gab keine Ruhe, schwoll auf und sank ein, schnellte hin und schnellte her, so oft sich der Bursche nur ein wenig bewegte.
Die Stube war hübsch ausgetäfelt, hatte einige Schränke mit uralten Verzierungen, mehrere Heiligenbilder und einen großen Spiegel mit vergoldetem Rahmen. Verschiedene andere Gegenstände zierten das geräumige Gemach, auf der Thüre waren die Zeichen der heiligen drei Könige geschrieben, die gar so segensvoll sind und sonderlich in keinem Frauengemache fehlen sollten. Der Bursche hatte noch selten eine so vornehme Wohnung gesehen.
Die Bäuerin commandirte mit der Stubenmagd und Allen, die sie ansichtig wurde, wie ein Wachtmeister herum; that dazwischen gefällige Blicke gegen Felix: ob er’s wohl merke, wer sie ist und wie ihr Alles hier dienet!
Auf dem Tische wurden zwei Kerzen angezündet; aufgetragen Braten mit Salat und Wein.
„Und jetzt troll’ Dich in Dein Nest; morgen heißt’s bei Zeiten auf’s Rübenfeld!“ Das war der letzte Befehl, den die Herrin der Aufwärterin gab.
Rübenfeld statt Weingarten! – Felix merkte, daß er nicht daheim. War es ihm aber im Weingarten jemals so gut geschehen als hier? Daheim zum Trank nur Apfelmost, den Wein verkaufen die Leute zumeist in’s obere Viertel. Im oberen Viertel wird er getrunken zum Braten. Zum Braten, der gemacht wird aus den Erdäpfeln und Rüben, die man den Schweinen in den Trog schüttet. Es kommt nicht darauf an, wie es der Boden giebt, sondern wie es der Mensch nimmt. – Das waren jetzt die Gedanken des jungen Winzers.
„So, mein Freund,“ sagte nun die Bäuerin zum Burschen. „So, jetzt pack’ an, da Dein Messer und Gabel. Nur allerweil flink und frisch, das mag ich leiden. Bist jetzt daheim. Aber so wirf doch Deine Joppe weg!“
Ist wahr, dachte sich Felix, wenn sie mir’s schon so gut meint, warum soll ich’s nicht vorwärtsgehen lassen!
Den Braten aß er ohne Salat, für den Durst vermißte er den Obstmost. Die Bäuerin, die an seiner Seite saß, schenkte ihm das Weinglas voll.
„Siehst Du,“ rief sie heiter, „ich selber trink’ aus Deinem Glas, wir wollen recht gut Freund werden!“
Werden? Dachte der Bursche doch, sie wären es schon; viel dicker läßt sich’s nicht mehr auftragen. Sie machte einen langen Zug – bewies es gründlich, daß ihr an seiner großen Freundschaft gelegen sei.
Des Weiteren – sie war ja auch daheim – lockerte sie die Kleider in etwas und löste ihr Haar, das schön und reich war, und strich mit zarter Hand seine Locken zurück.
„Ihr seid aber recht verschwenderische Leut’ im oberen Viertel,“ bemerkte Felix, „zwei Kerzen auf einmal brennen lassen – grad’ wie beim Altar.“
„Ist auch wahr,“ rief die Bäuerin und blies ein Licht aus.
Vielleicht war die Stube geheizt – im oberen Viertel ist das niemals sehr überflüssig – dem Burschen wurde warm, er knöpfte seine Weste auf, es macht nichts, er hat heute ja ein weißes Hemd am Leibe.
Die Bäuerin hatte in der Stube Einiges zu ordnen; ’s ist doch der Brauch, daß zur Nacht die Fenstertücher vorgezogen sind. Sie strich am Ofen, strich an der sittig verhüllten Bettstatt, strich an der Thür vorüber. Mit dem Ellbogen schob sie unversehens den Riegel vor und sagte: „Weißt, Felix, die heiligen drei Könige da mußt Du mir auch einmal frisch aufzeichnen.“
„Ja,“ sagte der Junge, „wenn ich’s nur kann, wie es die Ländhoferin haben will.“
Die Ländhoferin strich am Kasten hin und betastete ein erst kürzlich in der Webstube fertig gewordenes Leinwandfach. „Nein,“ sagte sie ärgerlich, „gar Schad’! nicht einmal webern können sie im oberen Viertel! Da habt Ihr daheim eine andere Leinwand! Jetzt schau einmal den Unterschied an!“ – Sie betrachtete das Fach und wollte dann auch den Brustlatz am Hemde des Burschen befühlen.
„Oha!“ lachte Felix abwehrend.
„Warum denn, Du närrischer Bub, wenn ich wissen will, was Du für eine Leinwand trägst!“
Je nun, wenn sie’s wissen will, was ich für eine Leinwand trage... warum soll sie’s nicht wissen?
„So trink’ was, Felix, Du nippest ja wie eine schwindsüchtige Jungfrau!“ sie schenkte ihm aber das Glas schon zum drittenmal voll.
„Oho, Ländhoferin,“ sagte der junge Winzer, „zwischen mir und einer Jungfrau ist ein Unterschied im Trinken.“
„Das möcht’ ich doch wissen, ob Du’s zuweg’ bringst und das Glas auf einen Zug leerst!“
Dabei trat sie ihm neckisch auf die Schuhspitze. Er faßte frisch das Glas und führte es zum Munde. – In demselben Augenblicke klang unten im Hofe ein Glöcklein.
„Was ist denn das?“ fragte Felix mit gehobenem Glase.
„Du Närrchen, wirst Dich doch vor dem Abendläuten nicht schrecken?“
„Ist das Abendläuten, so muß man beten,“ sagte der Bursche und stellte das volle Glas auf den Tisch zurück.
„Geh’, Du langweiliger Klosterbruder!“ flüsterte das Weib und hastig hob sie ihm den Becher zu.
„Nein,“ sagte Felix, „ich will das Mutterwort nicht gleich am ersten Tage schon vergessen.“
Er stand auf, trat an ein Fenster, zog den Vorhang ein wenig beiseite, sah in’s Freie hinaus und betete still.
Der Mond schien ihm in’s Gesicht.
Die Ländhoferin blickte hin und erschrak wirklich.
Vor Jahren, etliche Tage nach der Hochzeit hatte sie ihr Mann in die Residenz geführt. Sie hatten Alles besucht, was ihnen als merkwürdig bezeichnet worden war. Die Bäuerin erinnerte sich besonders noch an jenen hüllenlosen Jüngling aus schneeweißem Stein gehauen – eine einzig schöne Gestalt. Man hatte ihr gesagt, es sei das Bild von Gott Apollo. Sie hatte danach viele Nächte lang von diesem Bilde geträumt.
Und nun, da sie gegen das mondhelle Fenster hinblickte, wo der Jüngling stand, sah sie dasselbe blasse, einzig schöne Antlitz.
Wie ein kühler Lufthauch wehte es plötzlich durch die Stube. Die Bäuerin erhob sich langsam vom Sofa, stand still und sann.
Er will das Mutterwort nicht gleich am ersten Tage brechen! – Recht schön. – Es kommen der Tage noch mehrere. – Auch giebt es Leute, denen der erjagte Hase besser schmeckt, als der geschenkte. – Wollen es danach einrichten .....
„Na, Junge!“ rief die Bäuerin in entschiedenem Tone, „ich denk’, ’s ist Schlafenszeit!“
Da kehrte sich der junge Unterviertler um und sagte: „Mir ist’s recht, Bäuerin. Und morgen – was hab’ ich denn zu thun?“
„Der Altknecht wird Dich weisen,“ beschied sie kurz.
Hierauf brannte sie die zweite Kerze wieder an und öffnete eine Seitenthür. Diese führte in eine Stube, die fast so schön und bequem eingerichtet war und auch ein so hochgeschichtetes Bett enthielt als das Zimmer der Bäuerin.
„Die heutige Nacht schlafst im Zimmer von meinem seligen Mann,“ sagte sie, „in der Knechtestube ist noch kein Bett gerichtet.“
„Ja, gute Nacht, Bäuerin,“ sagte Felix und trat in sein Gemach.
Sie blickte ihn noch einmal an. „Und gieb Acht, was Dir die erste Nacht träumt – ’s ist bedeutsam. Gute Nacht, Froschreiter.“
Sie zog die Thüre zu, er war allein in der Stube.
Eine Weile stand er völlig unbeweglich da und starrte d’rein. „Ist seltsam, das!“
Es ist nicht sein Dachkämmerlein im Winzerhause. Das ist die Wohnung des Großbauers auf dem weit berühmten Hof, genannt die grüne Länd. Wie oft hatte Felix davon gehört. Im Ländhof dienen, das war eine Ehr’. Im Ländhof werden die Thaler nach Scheffeln gezählt! ging der Spruch.[S. 67] Vor einem Ländhofer wird sogar der Amtmann höflich. Einen Rinderschlag giebt’s im Land: mattbraun, mit kurzen Hörnern und gar feinfleischig – er wird die Ländhofer-Race geheißen. Der Schullehrer in Zollau hat eine Landkarte, darauf ist auch die grüne Länd verzeichnet.
Und nun, der Felix, der arme Winzerssohn – er stand mitten in der Herrnstube des Ländhofes, er sollte im Bette des Großbauers schlafen und im Hofe verbleiben und –
– Und –?
Und sie wollt’ ihm über das Soldatenleben hinaushelfen. Und anstatt ein gemeiner Soldat der Ländhofer sein.... Sapperlot! – Na, für heut’ legen wir uns schlafen.
Flink warf er seine Kleider von sich, löschte das Licht aus und sprang in das Bett. Schier einen Hilferuf ließ er fahren, denn er meinte, er versinke auf der Stelle in den hochgeblähten Polstern.
Ein feines Bett ist nicht immer ein gutes Bett. Daheim im Winzerhause legte sich Felix auf’s Maisstroh und schlief. Hier nach diesem vielbewegten Tage sank er in die Federn und wachte; wälzte sich hin, wälzte sich her, zog die weiche Decke über die Achseln, warf sie wieder zurück – und wachte.
Wohl wahr, das sanfte Ruhekissen eines guten Gewissens lag ihm unter dem Haupte – aber wenn allerlei Gedanken tanzen im Kopf – Gedanken von Macht, von Reichthum – so ist’s mit dem Schlafe vorbei. Der Gedanke daran allein schon kann das Glück eines süßen Schlummers zerstören.
Zum Ueberflusse fing auch das Herz zu sprechen an; doch hatte es keinen anderen Wunsch als den: wäre ich lieber[S. 68] daheim! – Wie es nur so öde sein kann in einem so großen Hof! – Sonst hörte er vom Schlafkämmerlein aus das leise Rauschen der Seim, das Schnarchen des Vaters und dann wieder das Wimmern der kleinen Geschwister. Hier Alles so still – auch die Stockuhr rastet, wer weiß, wie lange schon. Und nur die Begierden und hochmüthigen Wünsche sollen ruhlos sein in diesem Hause?
Fast unheimlich wurde dem Burschen. Er richtete sich im Bette auf und sah nichts als die mondhellen Fenster, und hörte nichts als das Pochen in seinen Schläfen. Endlich stand er auf, ging an’s Fenster und blickte hinaus in den Baumgarten, auf dessen Büschen der Reif des Mondlichtes lag. Dann schlich er in der Stube umher und suchte ein Wassergefäß; ihn dürstete. Doch fand er keinen Krug, keine Lobe. In einem Hause mit solchem Ueberfluß vergessen sie auf das liebe Wasser nicht bedenkend, daß Alles, was der Wein entzündet, nur das Wasser wieder löschen kann.
Was blieb ihm übrig, als in den Hof hinabzugehen, wo er bei seiner Ankunft den sprudelnden Brunnen sah. Leise – mit großer Vorsicht, daß er die in der nachbarlichen Stube ruhende Bäuerin nicht wecke – kleidete er sich an. Als er nun aber das Zimmer verlassen wollte, fand er die Thür, die in den Vorgang zu führen schien, fest verschlossen.
Er versuchte den Eisenriegel mit der freien Hand zurückzuschieben – nicht möglich, das starre Federschloß hatte einen Blechmantel über.
Felix machte vor Ueberraschung einen gedämpften Pfiff, dann murmelte er: „Jetzt hat sie mich eingesperrt.“
Er suchte lange nach einem Schlüssel und fand keinen. Rathlos stand er da. Der Durst wäre schließlich noch zu[S. 69] verwinden, aber eingesperrt will er nicht sein. – Was hat sie ihn einzusperren!
Die Fenster sind groß genug, um durch dieselben hinauszusteigen, haben aber Gitter. Es ist ja begreiflich, daß sich der Ländhof gegen außen hin absperrt, doch, die redlichen Bewohner einschließen? Das ist keine Mode. – Traut man ihm nicht, dem Unterviertler? Oder will man ihm zeigen, daß er unter Herrschaft ist? Seine Herrschaft ist der Kaiser.
Dem Burschen kam der Trotz. „Weiß noch einen andern Weg in’s Freie,“ sagte er zu sich, „und ehvor ich mich gefangen halten laß’ wie ein erhaschter Vogel –! Wenn nur nicht etwa auch diese Thür –“
Er legte die Hand an die Klinke der Thür, durch die er gekommen war. Sie gab nach – Felix stand im Schlafgemache der Ländhoferin. – Der Mond schien auf die weißen Linnen ihres Bettes. Sie ruhte in einer anmuthigen Stellung. Nur einen kurzen, aber seltsamen Blick warf Felix auf sie hin, um dann auf Zehenspitzen der gegenüberliegenden Thüre zuzueilen. Diese öffnete er mit leichter Müh’ und schlüpfte in den finsteren Vorgang.
Es dauerte lange, bis er sich über die Stiege hinabgriff. Das Hausthor war ungesperrt.
Vor dem Brunnen kniete er hin und trank. Die Nacht war so schön und mild. Er schritt weiter hinaus zwischen den Stallungen, hörte hier ein Rind blöken, dort eine Ziege meckern, oder ein Pferd wiehern, oder einen alten noch wachen Knecht poltern. Vielleicht schritt der gute Junge auch an Geheimnissen vorüber. Ein solcher Hof ist reich an nächtlichen Thaten und Begebenheiten; denn nur die Nacht gehört dem Gesinde für sein eigen Leben, am Tage muß es[S. 70] dienen. In der Nacht hat manche Magd die Pfaid ihres Freundes auszubessern; in der Nacht muß der Knecht die schadhaften Schuhe seiner Liebsten besohlen; denn das Nähen versteht sie und das Schuhflicken er, und so ist auch im Bauernhofe die Theilung der Arbeit eingeführt.
Auf die grüne Länd schien derselbe Mond, wie daheim über die Weinberge – so ging Felix zur stillen nächtlichen Weile ein wenig spazieren. Er wendete um den Hof und ging am Ufer der Seim entlang. Der Fluß war auch hier nicht viel kleiner als im unteren Viertel. – Diese Wellen, in welchen der Mond schimmert, wann können sie am Winzerhause vorbeifließen? Ja, bishin wird die Sonne schon hoch am Himmel sein und da steht vielleicht der kleine Anton am Ufer und wirft Steinchen in das Wasser. „Warum gehen keine Schiffe auf dir, du liebe Seim?“
Auf dem Rückweg schritt Felix durch den Baumgarten. Manch’ schwarzen Balken, wie sie auf dem thaunassen Boden umherlagen, überstieg er mit vorsichtigem Fuße, und lachte sich selbst aus, wenn es schließlich kein Balken war, sondern blos der Schatten eines Baumstammes. Ueber den Laden der Kugelbahn, den er für einen Schatten gehalten hatte, stolperte er. Eine Kugelbahn und daneben in der Rinne die Kugel! besser könnte sich doch gar nichts schicken, um die Grillen zu vertreiben. „Wenn’s auch Nacht ist, probiren wir’s einmal! Stehen Kegel auf dem Kreuz, so werden sie wohl fallen.“
Mit frischem Knabenmuth hob er die Kugel, wog sie in der Hand, schupfte sie kunstgerecht mehrmals aus der Lage, um sie sicher zu fassen, stellte sich an, schwang etlichemale den Arm – auf dem schmalen Laden glatt und scharf rollte die Kugel hinaus, und in der Laube stürzten klingend die Kegel.
In demselben Augenblicke huschte eine Gestalt aus der Kegellaube und wollte abseits eilen.
„Oho!“ rief Felix munter, „hat sich ein Schelm versteckt gehalten?“ Er verfolgte das Wesen und erjagte es.
„Laß’ mich weg!“ hauchte die Gestalt und brach in Schluchzen aus. Er sah ihr in’s Angesicht; jenes blasse Mädchen war’s, das bei der Heimkehr der Bäuerin das treuherzige: „Grüß Gott, Mutter!“ gerufen hatte.
„Du Närrle, Du, was ist Dir denn geschehen?“ fragte der Bursche theilnehmend. Sie weinte noch mehr, und ihr Bestreben, aus seinem Arm zu entkommen, war fruchtlos.
„Jetzt will ich’s just wissen!“ fuhr er fort, „und jetzt komm’ und setze Dich da mit mir in die Laube. – Siehst Du, alle Acht’ hab’ ich getroffen – nur Einer steht noch. Und jetzt mußt Du mir’s redlich erzählen, was Dir geschehen ist.“
„’leicht hast es selber gesehen,“ antwortete sie leise, „gelt, Du bist ja der junge Unterviertler, den die Mutter mitgebracht hat?“
„Auf’s Haar derselbe.“
„Und gerade Deinetweg – daß sie es so vor einem fremden Menschen gesagt – hat mir’s noch zu allermeist weh gethan.“
„Ich bin kein fremder Mensch, Dirndl, ich gehör’ jetzt auch zum Ländhof. Felix heiß’ ich, und wie heißest denn Du?“
„Seit mein Vater todt ist,“ entgegnete das Mädchen, „hat mich kein Mensch noch so gutherzig gefragt, was mir weh thut, als Du. Und weil Du die grobe Red’ von der Mutter schon gehört hast, und Du Dich doch noch nach mir umschaust, so vertraue ich Dir. – Ich heiße Constanze und bin das Kind vom Hause.“
„Von diesem Hause da! vom Ländhof?“
„Das einzige Kind.“
„Und die Bäuerin, die ist gewiß Deine Stiefmutter, Constanze?“
„Als meine Mutter gestorben ist,“ sagte das Mädchen, „bin ich sechs, und als mein Vater die Unterviertlerin geheiratet hat, bin ich sieben Jahr’ alt gewesen.“
„I, dann freilich,“ versetzte der Bursche, „eine Stiefmutter ist des Teufels Unterfutter.“
„Das darfst nicht sagen,“ verwies sie, „die Mutter hat auch ihr Gutes. Ich könnte sie gewiß recht lieb haben – ich mag keinem Menschen böse sein – aber sie peinigt mich.“
Die letzten Worte wollten fast ersticken. „Und jetzt,“ fuhr sie unter Schluchzen mühsam fort zu sprechen, „jetzt, da ich vom Krankenbett aufgestanden bin, wird es ’leicht noch ärger.“
„Bist krank gewesen, Constanze?“ fragte der Bursche in gar mildem Tone und legte seine Hand auf ihre Achsel.
„Es hat mich wer in den Keller eingesperrt,“ sagte das Mädchen, „sie hat mich hinausgeschickt in’s Kellerhaus, daß ich von den Sauerkrautkübeln das Wasser abschöpfe. Wie ich damit fertig bin und davon will, ist die Thür im Schloß. – Wenn Du einmal in den Keller gehst, so wirst es sehen, selber kann die Thür nicht zufallen. – Gerufen hab’ ich, bis mir die Stimm’ ist gebrochen. Kein Mensch hat mich gehört; das Kellerhaus steht ja oben beim Schachen. Die ganze Nacht bin ich im Gefängniß gewesen, erst am Morgen haben sie mich erlöst. Die Mutter ist am selben Tag nach Breitenschlag gefahren; die Leut’ haben gemeint, ich wär’ mit ihr. Ganz zufällig haben sie mich gefunden. Ja, und da habe ich mich so verkältet, daß ich in eine Krankheit gefallen bin.“
„Jetzt, wer hat Dich denn eingesperrt?“ rief der Winzer.
„Ja, dasselb’ wollt’ ich –“ sie unterbrach sich und flüsterte: „ich kann gar nichts sagen.“
„Du!“ sagte Felix, „vielleicht ergründ’ ich’s, wer im Ländhofe die Leut’ einsperrt. – Und jetzt, Constanze, bist wohl wieder brav gesund?“
„Wie vor etlichen Tagen die Mutter in’s Weinland gefahren ist,“ erzählte das Mädchen, „da bin ich noch im Bette gelegen, arg krank. Ist darauf aber schleunig besser geworden; und jetzt, wie die Mutter heimkommt – denk’ ich mir – da will ich ihr eine Freud’ machen, und daß sie gleich sieht, ich bin schon wohlauf, laufe ich ihr entgegen. – Wie groß ihre Freude über mein Gesundwerden gewesen ist, hast Du selber gesehen.“
„Thät man ihr’s ansehen?“ entgegnete Felix nach einem Weilchen, „gewiß nicht. – So möcht’ ich doch wissen, Constanze, was hat sie denn gegen Dich?“
Das Mädchen neigte traurig das Haupt.
„Und von Dir ist’s auch nicht recht,“ sagte der Bursche, „daß Du, kaum erst aus dem Krankenbett, jetzt in der kühlen Nacht da auf der Kugelbahn hockest!“
Felix selber war überrascht, daß er jetzt so gescheidt gesprochen hatte. Sein Vater und seine Mutter zusammen konnten kaum vernünftiger reden, als er es heute vor diesem Mädchen that. Und dabei fühlte er sich so gesetzt und bereit zum Beistand, er hatte selbst nicht gewußt, daß er so sein konnte.
„Das ist freilich wahr,“ entgegnete Constanze auf obigen Vorwurf, „aber ich hab’ mir nicht zu helfen gewußt, ’s ist mir so um’s Weinen gewesen, und da habe ich mich aus der Mägdekammer davon gemacht. In der Kammer spotten sie mich aus, wenn ich traurig bin. Sie haben es besser als[S. 74] ich; sie können davon gehen, wenn das Jahr aus ist, ich muß bleiben.“
„Ruck nur recht glatt an mich, daß Dir nicht kalt wird,“ sagte der Bursche. – „Aber die Bäuerin! So möcht’ ich doch wissen, was sie gegen Dich hat.“ – Völlig aufbrauste er.
Constanze schwieg. Sie hätte gern gesprochen, ihr ganzes schweres Herz ausgesprochen vor diesem guten Menschen. Aber die Klugheit gebot ihr Zurückhaltung; bislang wußte sie doch nicht, wer er eigentlich war und in welchem Verhältnisse er zur Bäuerin stand.
„Jetzt muß ich wohl in’s Haus,“ flüsterte sie und machte sich allmählich los von seinen Armen, die sie – sie wußte nicht wie – umgarnt hatten.
Felix hatte nicht mehr Lust weiterzukegeln. Er ging mit dem Mädchen bis zum Hause. Am Thore, wo sie sich trennten, gab er ihr das Wort: „Wenn ich eine Zeit lang im Ländhof verbleibe, Constanze, an mir sollst einen guten Freund haben.“
Dann schlich er die Stiege hinan, den Vorgang entlang, drückte alle möglichen Thürklinken nieder, bis endlich eine nachgab.
Unabwendbar durch das Gemach der Bäuerin ging sein Weg; behend huschte er an aller Anmuth vorbei und in seine Stube.
Er mußte sich gestehen, die Ländhoferin war ihm nun nicht mehr ganz gleichgiltig.
Bald schnarchte er in seinen Federn – und sie?
Sie seufzte im Traume.
Am nächsten Morgen sprach die Bäuerin zum Altknecht: „Jetzt will ich Dir eins sagen, wenn ich Dir nicht zwei sag’.“
„Ja,“ antwortete der Knecht.
„Der Bub’, den ich vom Unterviertel mitgebracht hab’, ist ein Geschwisterkind von mir. Der wird dableiben, und wenn er sich heut’ die Wirthschaft ansehen will, so geh’ ihm zu Handen. – Jetzt weißt es, und jetzt rühr’ Dich wieder vom Fleck, Du alter Scherben.“
Der Knecht aber blieb vor ihr noch stehen, pfusterte mit der Nase und sagte dann mit ganz gutmüthiger Stimme die Worte:
„Bäuerin, zu Neujahr hab’ ich gesagt, wenn ich mir die Grobheiten gefallen lassen muß, die seit des Bauers Tod im Hof herumfliegen wie die Gelsen, so verlang’ ich um zehn Gulden mehr Jahrlohn. Heut’ sag’ ich, um zehn Gulden thu’ ich’s nicht und die Bäuerin soll sich für nächst Jahr um einen andern Altknecht schauen.“
Dann ging er langsam davon und war schier um ein paar Zoll länger als sonst.
Die Ländhoferin war nicht einmal erbost. Sie dachte an einen jungen Altknecht.
Felix ging am selben Tag zu seiner eigenen Ueberraschung auf der grünen Länd’ um, wie der Gutsherr selber. Die Arbeiter grüßten ihn höflich, munkelten aber allerlei Ungereimtes, sobald er wieder davon war.
Er ging in den Wald, sah dem Baumfällen, Brennholzbereiten und Streusammeln zu. Er ging auf die Wiesen,[S. 76] wo Herbstmahd war; er ging auf die Felder, in die Gärten, wo die Spätfrüchte eingethan wurden. Er ließ sich über den Fluß führen, um die jenseitigen Flachsarbeiten zu sehen. Dort wurde der auf freier Au gebleichte Flachs gehoben und in Büschel zusammengebunden.
Felix verstand von Allem nichts – er verstand nur, wie man die Reben zieht und die Trauben preßt. Eine Magd aber war doch so dienstbar, ihn zu fragen: „Bauer, wird der Haar (Flachs) auch heuer wieder mit Strohbändern gebunden?“
„Ja freilich,“ gab der Winzerssohn zur Antwort; er sah nicht ein, warum gerade heuer die Regel unterbrochen werden sollte.
Das Mißliche war, daß – wenn man ihn so hoch hielt – er den Würdevollen spielen mußte und nicht in seiner kecken, lustigen Weise jauchzen und singen durfte. Er ließ es gar so hart. Die Lustigkeit steckte in seinem Blute, wie der Geist im Weine. Aber wenn es schon ist oder werden wird, wie es aussieht, so –
Kurz, der Ländhofer muß ein gesetzter, ernsthafter Mann sein. Beim hellen Tag sah ja Alles anders aus, als in der Nacht – wer wollt’ nicht Großbauer sein!
Als Felix von seinen Besichtigungsgängen in den Hof zurückkehrte, harrte seiner der Schneider. Für den jungen Mann ein neuer Anzug war bestellt. Die Bäuerin stand dabei und leitete das Beginnen, als der Meister das Maß nahm. Das Maß um den Oberkörper des Burschen, die Breite der Brust, der Achseln, die Länge der Arme; dann die Weite der Hüfte, die Höhe vom Stiefelabsatz bis zur ersten Rippe und die Höhe der Schenkel.
„Ist mir nicht bald Einer vorgekommen, so bildsauber gewachsen, als der da!“ murmelte der Schneider in den Maß[S. 77]faden hinein, den er zwischen die Zähne genommen hatte. Die schönheitssinnige Ländhoferin nicht minder freute sich der Wohlgestalt.
Am Nachmittage nahm die Bäuerin den jungen Günstling in die Vorrathskammer mit. Korn und Obst, Gemüse und Fleisch, Speck und Fett in unerhörter Fülle. Der Sohn des armen Winzers that den Mund auf – aber nicht vor Hunger heute, sondern vor Staunen. Die Bäuerin hielt ihn fest am Arm und zerrte ihn weiter und jener Kammer zu, wo riesige Ballen von Flachs und Leinwand, Wolle und Lodentuch aufgeschichtet waren.
„Da such’ Dir einmal Eins aus,“ sagte die Ländhoferin, „’s ist lauter Winterstoff; ich denk’, Du nimmst dunkelgrau, das wird mit grün fein ausgeschlagen und steht gut! – Ei, setzen wir uns ein wenig nieder, da können wir’s bequemer überlegen.“
Sie setzten sich auf ein braunes Lodenbündel.
„Nun,“ fragte sie hierauf lächelnd, „Felix, was sagst Du zum Ländhof?“
„Da kann man gar nichts sagen, als: den möcht’ ich haben,“ versetzte der Bursche.
Die Bäuerin wartete eine Weile auf ein weiteres Wort, aber Felix befühlte das grobe Schafwollentuch, wie dick es sei und wie weich und dachte: Das wär’ mir schon recht für den Winter.
„Mit dem Ländhofe wärst zufrieden?“ fragte die Bäuerin lauernd.
„Wollt schier mit ihm zufrieden sein.“
„Und – die Ländhoferin, meinst, wär’ nicht vonnöthen?“
„Gehört freilich auch dazu,“ versetzte der Bursche und zupfte am Lodentuch.
Dann schwiegen sie Beide – schwiegen so lange, daß sich ein Mäuschen versucht fand, aus seinem Versteck zu lugen. Hastig schreckte das Thierchen zurück, denn es hatte plötzlich die glühenden Augen des Weibes gesehen.
„Felix,“ sagte nun die Ländhoferin unter einem seltsam schweren Athem, „Felix – Felix, weißt Du, daß ich Dich unbändig gern hab’?“
Der Unterviertler sah sie an mit großem, klarem Auge. Ohne ein Lächeln und ohne ein Erröthen sah er ihr in’s Antlitz und – schwieg.
Da haschte sie nach seinen Händen, zog dieselben hastig an sich: „Herzensbub! Du bist mir angethan, und bei meiner Seel’, ich mach’ Dich zum Ländhofer! Du lieber Bub, Du Herzensbub!“
Beide Arme schlang sie um seinen Nacken, mit heißer Leidenschaft küßte sie seine Stirne, seine Locken, seine Augen, seinen Mund.
Er ließ es geschehen, bis sie vor Liebkosung wie erschöpft war. Dann zog er sein rothes Sacktuch hervor und wischte sich damit das Angesicht ab. Sie meinte, es wäre ihm so heiß.
Wieder ein Weilchen verstrich.
„So rede auch Du was!“ rief plötzlich die Bäuerin fast zu laut, „Du sitzest da wie ein hölzerner Heiliger, gerade, daß Du noch keinen Schein hast. Weißt nicht, daß ich Dich um was gefragt hab’?“
„Gefragt hat mich die Bäuerin um was?“ entgegnete verwundert der junge Unterviertler.
„Magst denn nicht der Ländhofer sein?“
„Wohl, wohl,“ sagte er, „wenn’s Euer Ernst ist, Bäuerin.“
„So sag’ doch Du zu mir, Du langweiliger Mensch.[S. 79] Und muß ich Dich denn geradeaus fragen, Felix: magst mich?“
„Ei – wohl, wohl, Bäuerin,“ entgegnete der Bursche zerstreut, „aber schau doch, wie sie sich plagen muß.“
Er blickte durch das nahe Fenster hinab in den Hof, wo Constanze bei einem Obstwagen bemüht war, einen vollen Aepfelsack abzuladen. Die Kraftanstrengung des Mädchens schien vergeblich. Da sprang Felix vom Lodenballen auf, schrie: „Wart’, ich helf’ Dir!“ schwang sich zum Fenster hinaus und sprang auf die Erde hinab. Mit einem kräftigen Ruck warf er den Sack auf seine Schulter: „Wohin damit?“
Constanze ging voraus auf die Obstschütte; Felix folgte ihr mit den Aepfeln.
Und die Bäuerin in der dunklen Kammer schleuderte wüthend die Wollen- und Leinwandbündel durcheinander.
Und dem Mäuschen war beklommen in seinem Neste.
Mit in die Seiten gespreizten Armen stand die Ländhoferin vor Constanze: „Dirn’, es ist aus der Weis mit Dir, Du gehst vom Hof!“
„Warum soll ich denn vom Hof gehen, Mutter?“ sagte das Mädchen, die Bäuerin traurig anblickend.
„Weißt Dich nicht schuldig? Natürlich nicht,“ höhnte die Herrin, „bist allerweil die brave, fromme, folgsame Dirn’, Du – Schau, wie Du Dich verstellen kannst, Du Schlange! Heimtückisch bist! Stiftest die Leut’ auf! Der Altknecht geht! Weißt es schon, daß er geht? Deinetweg’ geht er! Den Anderen ist die Kost zu schlecht. Bist ’leicht Du die Erst’, die ihnen in die Ohren pfeift, früherer Zeit wär’ sie besser gewesen? Beim Tisch flink und bei der Arbeit faul,[S. 80] das ist Dein Gaul! Und andere Leut’ ziehst damit von ihren Geschäften und Pflichten weg!“
„Ich, Mutter?“ wagte Constanze einzuwenden.
„Wer denn staßt (stolzirt) leer voraus, wie eine Prinzessin und läßt sich die etlichen Aepfel nach in den Schüttboden tragen? – Und nachher noch ein Wörtel, meine Gnädige!“ Die Bäuerin that einen Schritt vor und stemmte die Arme noch fester in die Seiten: „Wer stiehlt sich denn des Nachts aus dem Hause und läßt den Dieben das Thor offen und streicht in den Büschen um und macht Zusammverlaß mit lüderlichen Lottern –?“
„Mutter!“ schrie Constanze auf.
„Leugnen willst!“ rief die Bäuerin, „bist gesehen worden, Du Saubere, mit dem Liebsten in der Kugelbahnlauben. Möcht’ ich ihn gern kennen, den Lumpen!“
Der Felix, der zufällig des Weges gekommen – es war in dem Hausflur – und ein wenig abseits stehen geblieben war, um nicht durch sein Erscheinen die Verlegenheit des Mädchens noch zu steigern, trat jetzt, da der „Lump“ aufmarschirt kam, vor und sagte: „Bäuerin, da red’ ich auch was mit.“
„Du!? – weißt was? Geht Dir heut’ einmal der Mund auf?“
„Auf der Kugelbahn – Unrechtes ist nichts geschehen.“
„Wer kann’s denn sagen, bist etwa dabeigestanden, Felix?“
„Freilich, Bäuerin,“ lachte der Bursche, „ich bin ja der Lump selber gewesen! – Na, Bäuerin, meinetweg’ macht’s nichts. Mag nur über die Constanze nichts aufkommen lassen.“
„Was kümmert denn Dich die Dirn’?“ fuhr ihn die Ländhoferin an, „Du sei still! – und die Dirn’ geht!“
Constanze schlich weinend davon. Felix ging seiner Wege. Er ging dem Schachen zu und sang ein Vierzeiliges:
Und bald darauf folgendes:
Und lebendig, alllebendig war’s in ihm. Es war ihm heiß – und doch war der Sommer schon vorbei; es war ihm kalt – und doch der Winter noch nicht da. Wo kommt das Fieber her?
Jetzt wußte er’s gewiß, der Unterviertler, die Ländhoferin war ihm nicht gleichgiltig. Sein Puls ging rascher, wenn er an sie dachte. Er haßte sie. – Und sie will ihn[S. 82] in die Schürze fangen wie einen jungen Gimpel, der aus dem Nest gefallen ist?
„Oho, vornehme Ländhofbäuerin,“ trillerte er vor sich hin, „so gut soll’s Dir nicht gehen – Dir schon lange nicht. Du hast einen großen Hof, aber ich bin dafür nicht feil. Deinen Hof, den mag ich nicht – mag ihn nicht. Und bei Dir bleib’ ich nicht. Mit der Constanz’ geh’ ich weg und die laß’ ich nicht.“
Der Schneidermeister trippelte des Weges: „Je, schönen Tag, Bauer, morgen bring’ ich Hosen und Rock.“
„Brauch’ sie nicht!“ sagte Felix trotzig und schritt weiter und pfiff und sang und brummte, und lachte laut mit sich selber.
Das Lachen verging ihm bald.
Vom Walde heran schleppten zwei Landwächter einen gefesselten Bauernburschen. Dieser wehrte sich nach allen Kräften, stemmte sich, stieß und biß – und er war schon über und über blutig geschlagen.
„Na, mit Verlaub schön, der hat sicher wen umgebracht?“ fragte Felix einen am Feldraine stehenden Knecht.
„Bei Leib’ nicht,“ antwortete dieser, „umbringen thut der Keinen, das weiß ich. Ich kenn’ ihn. Ein Soldatenflüchtling ist es, hat Vater und Mutter daheim und ’leicht auch sein Mädel nicht vergessen mögen; ist dem Regiment durchgegangen. Nun, jetzt haben ihn die Sakra wieder in den Krallen. Ist verteufelt, so was! Dem geht’s nicht gut, der muß gassenlaufen. Wird geschlagen wie ein Hund. Dem hängt übermorgen das Fleisch vom Rücken. – Ist verteufelt, so was!“
Kein Wörtel sagte Felix. Er blickte noch lange der widerlichen Gruppe nach, dann schritt er weiter und hatte schwere Gedanken.
Winzerssohn, so wie diesem kann’s dir auch ergehen. Bleibst mit der Bäuerin nicht gut Freund, so bist auf’s Jahr um diese Zeit beim Soldatenleben, bist im fremden Land, mußt dich mißhandeln lassen von harten Menschen. Sollt’ ein Ehrendienst sein, der Soldatendienst; wolltest dich davor ja nicht fürchten. Das liebe Heimatsland muß seine Wächter haben – aber ’s ist ein Hundedienst. – Und Vater und Mutter daheim! Und thät dir gar der Gedanke an’s arme verlassene Mägdlein kommen! – Felix, so wie diesem kann’s Dir auch gehen.
„Meinetweg geht’s wie’s will!“ rief der Bursche laut, „die Ländhoferin mag ich nicht.“
Mag ich nicht! stimmte der Wald bei. Und zum Trotze einen hellen Juchschrei stieß Felix aus. Der Juchschrei gellte hin über die grüne Länd, hin über die blinkenden Dächer des Hofes und über die Seim.
Hinter dem Hofe, wo die weißen Steine lagen und die weißen Birken standen, war die Schaftränke. Constanze saß auf dem Kopf des Wassertroges und sprach in menschlichen Worten zu den Lämmern.
Nicht in allen Fällen ist es Einfalt, wenn der Mensch menschlich mit den Thieren redet. Dichter thun es in ihrer Art, und man nennt sie deswegen gerade nicht einfältig. Jäger unterhalten sich mit ihren Hunden; alte, oft sehr geistreiche Jungfrauen mit ihren Katzen. – Ah, hast angebissen, Kerlchen! ruft selbst der Angler der gefangenen Forelle zu, und er muß es doch wissen, daß sie stocktaub ist.
Um wie viel erklärlicher ist es, wenn ein armes, einsames Menschenkind seine Zuflucht nimmt zu irgend einem Wesen, das ihm nie etwas Böses zugefügt hat, das es – wenn auch durch kein Menschenauge – treuherzig anblickt zu jeder Stunde – recht ergeben und recht vertrauend! Was Wunder, wenn das von seinem Geschlechte verlassene Menschenkind, das mittheilsame, sein volles Herz aufthut und sich ausspricht, ausweint vor dem guten Thiere, das so theilnehmend, so verständnißvoll zuzuhören scheint und gerade dadurch richtig das zu geben im Stande ist, was der Mensch sucht: Erleichterung und Trost.
Und wie viele Lebenslagen giebt es nicht, in welchen das vernunftarme Thier uns gerade so wesentlich zu trösten weiß, als der vernunftstolze Mensch! Und wenn man keinen Freund zu haben glaubt unter dem „gottbegnadeten Geschlechte“ – dann wendet man sich nicht allzu selten an den treuen Hund, an die geschmeidige Katze, an das gute Schaf.
Constanze saß am Troge, hielt ein fünf Wochen altes schwarzes Lämmchen auf dem Schoße und sagte zu diesem: „Heut’ und morgen kann ich dich noch lieb haben – heut’ und morgen noch.“ Sie küßte das Thier auf das Schnäuzchen. „Uebermorgen geh’ ich davon. – Es schmerzt mich hart, daß ich vom Heimatshaus muß fort. Aber denk’ dir selber, was hilft mir das Heimatshaus, wenn keine Mutter und kein Vater darin ist, und kein Bruder und keine Schwester. – Die Obermagd giebt mir den Rath, ich sollt’ streiten um meine Sach’. Das mag ich nicht. Ehvor ich streit’, eh’ lass’ ich Alles. Gut und Geld macht nicht glücklich. Wie geht’s mit dir? Du hast keinen Groschen und wirst dein Lebtag keinen kriegen; Du hast kein eigen Dach, und wächst dir eine Wolle, wirst es sehen, so scheeren sie dir die Leute ab.[S. 85] Und schau, ich hab’ noch Keines so lustig und froh herumhüpfen gesehen auf der grünen Länd, als gerade dich. Das will ich mir fort bedenken und so wie du recht zufrieden sein. Das Wünschen hab’ ich schon lang’ verlernt auf dem Ländhof und bin froh, wenn mich die Leut’ nicht spotten und schmähen. – Dich möcht’ ich wohl gern’ mitnehmen, mein feines, gutes Lämmchen.“ Wieder küßte sie das traute Thier, und dieses leckte ihre zarten, rosig angehauchten Lippen. – „Dich, Lämmlein, und den jungen Buben auch; der ist gar lieb mit mir und kennt mich doch erst seit ein paar Tagen. Ja du, den hab’ ich gern – wollt’ ihn halsen wie dich.“ Und zärtlich schmiegte sie den Kopf des Lämmchens an ihre erglühenden Wangen und herzte und küßte es mit solcher Hast, daß ihr die Locken über die Stirne glitten und sie den Mann nicht sah, der ganz nahe am Brunnentroge stand.
Schon drei- oder viermal während der wenigen Tage auf der grünen Länd ist unser Felix ganz verdächtig genau zu rechter Zeit am Platz gestanden. Es könnte das uns, seine Freunde, gewissermaßen in Verlegenheit setzen. Aber die Bäuerin hatte dem Burschen doch förmlich aufgetragen, er solle fleißig Umschau halten in allen Weiten und Winkeln des Hofes und unter den Leuten, daß er die Dinge und Zustände baldigst kennen lerne. Und so war Felix denn auch hinter dem Hofe, wo die weißen Steine lagen und die weißen Birken standen und wo das Mädchen am Troge das schwarze Lämmchen koste.
Er hatte die letzten Worte vom „jungen Buben“ gehört. Nicht weiter überlegte er – über ihre Achsel neigte er sachte sein Lockenhaupt vor, und Constanze schmiegte und koste und herzte – und jählings, aber zu spät wurde sie gewahr, es[S. 86] war nicht mehr das Lämmlein allein, das sie geherzt – es war auch der schöne, lächelnde Kopf des „jungen Buben“ dabei gewesen.
Sofort wollte sie sich in den Wassertrog stürzen, aber Felix hielt sie fest umschlungen und sagte: „Constanze, jetzt ist alle Rederei nicht mehr vonnöthen, wir haben uns gern und wir gehören zusammen.“
Es brauchte aber Zeit, bis sie sich von ihrem Schreck erholt hatte. Es war gut, daß die Schaftränke so dicht mit Erlen und Birken umgeben war.
Schließlich – das Lämmchen war längst aus dem Arm gesprungen – ließ Constanze es gelten: sie hätten sich gern und gehörten zusammen.
„Und jetzt merk’ wohl, Mädel!“ sprach Felix mit Nachdruck, „jetzt wird Dir im Hof kein ungeschaffen Wörtel mehr gesagt, oder die Leut’ kriegen es mit mir zu thun! Auch die Bäuerin schreckt mich nicht! – Ich möcht’ nur wissen, was sie gegen Dich hat!“
„Das kann ich Dir jetzt wohl sagen, Felix,“ versetzte sie. „Da hab’ ich eine Schrift, die ist an Allem Schuld.“
„Das muß ein höllischer Wisch sein!“ rief der Bursche, „verbrennst ihn denn nicht?“
„Ja,“ entgegnete Constanze, „gottswahrhaftig, das thät ich am liebsten. Aber das Papier hat mein Vormund und mein Vormund ist in Breitenschlag drüben.“
„Jetzt möcht’ ich doch beim Himmelherrgottskreuz wissen, was auf dem Papier Sauberes steht!“
„Es ist das Testament von meinem seligen Vater,“ sprach das Mädchen traurig, „mein Vormund hat es mir einmal vorlesen wollen; ich kann’s nicht hören, ’s thut mir mein Herz weh, denk’ ich an den armen Vater.“
An Felix’ Brust brach sie in ein krampfiges Schluchzen aus.
„Constanze, mein lieb’ Dirndl,“ versetzte der junge Mann, „Du bist allzu weichherzig. Schau, das soll man nicht sein auf der Welt.“
„Den Vater hat sie so hart behandelt, auf dem Todbette noch. ’s ist nicht zu sagen, was er neben ihr hat leiden müssen.“
„Kann mir’s jetzt wohl denken,“ entgegnete Felix, „aber schau, Constanze, so weinen mußt nicht. Wenn Eins da auch noch einmal leiden wollt’, was Andere schon gelitten haben – Dirndl, wohin thät Eins da kommen! – Fest auf die Füß’ stellen muß man sich und der Welt die Zähn’ zeigen! – Mußt mit dem Vormund reden, Constanze.“
„Das will ich thun; in der Sonntagsfrüh will ich nach Breitenschlag hinübergehen.“
„Warum erst in der Sonntagsfrüh, warum nicht morgen?“
„Ja, der Vormund ist Waldmeister und Werktags selten daheim. Und morgen möcht’ ich noch den Flachs einbringen helfen.“
„Daß sie Dich vom Haus jagen kann, steht gewiß nicht im Testament!“ sagte der Unterviertler.
„Ganz was Anderes soll darin zu lesen sein, wie mir der Vormund zu verstehen gegeben hat,“ entgegnete das Mädchen, „was auch der Will’, es bleibt eine böse Sach’, weil so viel Unfried’ daraus wird. – Nur den lieben Frieden wünsch’ ich mir, und ein wenig gern haben sollten mich die braveren Leut’ – sonst brauch’ ich nichts.“
„Gern haben,“ sagte hierauf der Winzerssohn in frischer Schalkheit, „gern haben, Constanze, will ich Dich schon sakrisch; doch ob ich Dich immer in Fried’ laß’, das kann ich Dir nicht versprechen.“
Hierauf wollte das Mädchen sein Lämmlein wieder, da dieses aber nicht mehr zu erwischen war, so mußte es sich bescheiden und den Burschen kosen.
Das Bett in den Knechtestuben war immer noch nicht fertig. Felix schlief immer noch im Zimmer des seligen Ländhofers.
Heute am Samstagmorgen klopfte der Winzerssohn höflich an die Thüre der Bäuerin.
„Na freilich, die läppischen Geschichten wirst auch noch treiben,“ rief die Ländhoferin von innen, „weißt ja, daß es aufgeht, sei nur kein solcher Blödling.“
Drückte der Bursche keck an und stand in der Stube.
Die Bäuerin saß auf ihrem Bette und war mit dem Ankleiden zum geringen Theile erst fertig.
„Thut nichts,“ sagte sie in ihrer Leutseligkeit, „wird nicht so heikel sein – ’s selb’ denk’ ich.“
Felix blieb in einer dem Knechte anständigen Entfernung stehen und sprach: „Hätt’ mit der Bäuerin nur ein klein Wörtel zu reden.“
„Was hättest?“ fragte sie, obwohl sie die Worte recht gut verstanden hatte, „wenn Du’s nur so in den Bart hinein murmeln willst – hast gar keinen – so mußt näher kommen.“
Er trat um einen Schritt näher und sprach um einen Ton höher: „Bäuerin, ich hab’ keinen Leihkauf (Angeld) auf einen Dienst im Ländhof angenommen, hab’ auch noch nichts gearbeitet und könnt’ mich ’leicht nicht schicken in die große Wirthschaft. Bäuerin, ich möcht’ wieder weggehen.“
Auf die Mittheilung befliß sich die Ländhoferin, eine sehr gleichgiltige Miene zu machen, die ihr annähernd auch gelang, und dann entgegnete sie: „So, weggehen willst wieder? Ist auch recht. Ich häng’ Niemanden an, und wer sich’s anderswo besser zu machen weiß, als er’s auf dem Ländhof hat, dem steht die Hausthür gern offen.“ Mittlerweile jedoch wurde der innere Sturm so mächtig, daß sie folgendermaßen ausbrach: „Ist das der Dank, Du Hungerleiderbub, der Dank dafür, daß man’s Dir so gut meinen wollt’? – Ich denk’ mir’s wohl, Du Stromer, mit der lüderlichen Dirn’ willst fort!“
„Dasselb’ ist fehlgerathen, Ländhoferin,“ versetzte Felix gelassen, „mit der lüderlichen Dirn’ nicht, die kenn’ ich nicht; aber – daß ich’s recht sag’, mit der Constanze will ich morgen nach Breitenschlag hinüber.“
Jetzt war’s offen. Die Ländhoferin tastete mit einer Hand nach der Bettwand; sie empfand einen plötzlichen Schwindel, sie meinte, es treffe sie der Schlag. Doch sammelte sie sich bald wieder insoweit, daß sie den Rock überwerfen und aus dem Bette springen konnte.
Da war Felix schon davon.
Die Ländhoferin trank viel kaltes Wasser an demselbigen Morgen. Drei Brände hatte sie zu dämpfen: die Liebe, den Haß und die Eifersucht.
Gegen Mittag hin wurde sie der Ueberlegung fähig. – Er will mit der Dirn’ fort? – Nimmermehr. – Wer kann ihn halten? – Niemand. – Aber die Dirn’ bleibt im Hause. Na, so herumlungern, das leichtfertige Volk, das wär’ das Rechte! – dagegen ist noch ein Herr da. Man ist verantwortlich für die Dirn’. Unter die Zuchtruthe gehört sie. Sie bleibt im Hause. – Dann wird auch er bleiben. Er muß[S. 90] weg von dieser Schlange. Sie müssen auseinander gebracht werden. Er muß fort.
Er fort? ein heißer Stich im Herzen der Bäuerin.
„Nein!“ sagte sie, „so weit ist’s nicht gekommen. Er kann nicht vernarrt sein in dieses blöde Schulmädchen – vor mir, mir, dem mannbaren Weibe –“ Sie blickte in den Spiegel. Wie vortheilhaft sah sie aus im Vergleiche zu diesem „ödweiligen, bleichsüchtigen Geschöpfe!“ – Und war sie nicht die Hausfrau, die Befreierin aus dem Soldatenjoch – hatte sie nicht gleichsam eine Krone zu vergeben? – Der Bursche ist schlauer, als er aussehen mag; er will sie, die Bäuerin versuchen, auf daß er rascher zum Ziele komme. – Gut. Wenn’s schon anders nicht mit ihm zu schaffen ist – zu Martini soll die Hochzeit sein. – Die Froschreiterleut’ im Unterviertel, das sind arme Schlucker, denen schickt sie für Allerheiligen einen Wagen mit Lebensmitteln. Und ausgemacht wird’s heute Abend noch – dann ist er festgebunden und die Dirn’ muß doch fort. Sie ist die Unheilstifterin im Hof – um Haus und Bräutigam geht der Streit. Diese unselige Creatur – weit muß sie weg – auf immer muß sie fort, und das heute besser, wie morgen!
An diesem Samstage wurde der vor Kurzem am jenseitigen Ufer der Seim aus der Bleiche gehobene Flachs eingeheimst. Der Strang der Ueberfuhr ächzte, der Endring des Seiles rollte hin und her und die Plätte – eine schwimmende Holzbrücke – glitt über das Wasser bis an’s andere Ufer und stets mit voller Flachsladung wieder zurück. Die Arbeitsleute waren in guter Laune, beim Flachs giebt es ein lustiges Hantiren – jetzt kommt er in den Dörrofen und nach wenigen Tagen ist das Brecheln. Das Brecheln ist ein Hochfest für den Hof. Da muß sie gerngebig sein, die[S. 91] Bäuerin, sonst fährt ihr Name schlecht von Mund zu Mund in der ganzen Gemeinde um. Und der hübsche Unterviertler, da wird er wohl auch beim Tanzen mitthun, wird gewiß recht fein tanzen – so manches Mägdlein im Hofe denkt daran.
Auch die Bäuerin denkt an das Brechelfest. Da wird sie das erstemal mit Felix in den Reigen treten, und das soll die große, öffentliche Kundgebung sein: die Ländhoferin heiratet den jungen Unterviertler!
Nur Acht haben, daß der Flachs trocken unter Dach kommt! – Es will – scheint es – grob’ Wetter werden. Im Gebirg’ d’rin hatt’s tagelang schon gestürmt und geregnet, das merkt man am Wasser. Wird auch auf der Länd nicht lange warten lassen, der Himmel sticht in’s Bleigraue. Windstöße rütteln an den Bäumen und die gelben Blätter flattern zu Hunderten hin über den Hof, über die Wiesen und in den Fluß. Das sind die Schwalben des Spätherbstes.
Felix ging in den Wirthschaftsgebäuden um und war heiter. Heute war er noch der junge Herr auf dem großen Hof; heute konnte er noch – die Hände am Rücken – spazieren, in die Vorrathskammern und in die Keller gehen und mit den Leuten schaffen. Und er schaffte wirklich mit ihnen und ordnete an, wie man dies und das zu machen habe. Er wußte es gut genug, daß er von den Dingen bislang noch nichts verstehen konnte, aber die Leute thaten nach seinen Worten – das war ihre Schuld und dem Burschen machte es Spaß.
Die Bäuerin kam an ihm vorbei. Er grüßte sie besonders frisch und artig. Sie lächelte, klopfte ihm auf die Achsel: „Bist ja gescheidt, Felix!“ und eilte davon.
Sie hatte ein großes Küchenmesser in der Hand und ging damit dem Krautgarten zu, um den Kohlbeeten die letzten Köpfe abzuschlagen.
Hinter dem Gebäude begegnete ihr Constanze, welche, als die Einzige zu dieser Arbeit, emsig beschäftigt war, die letzte Ladung Flachs von der Plätte in die Dörrstube zu schaffen.
„Stanze!“ rief ihr die Bäuerin zu, „bleib’ stehen!“ – „Hab’ gehört, Du wolltest morgen nach Breitenschlag hinübergehen?“
„Die Mutter hat ja gesagt, daß ich fort soll,“ entgegnete das Mädchen.
„Du bleibst!“ rief die Ländhoferin scharf.
„Vielleicht kann ich wieder zurückkommen,“ sagte Constanze gutmüthig, „aber zum Vormund will ich morgen doch hinübergehen.“
„Dirn’, Du bleibst daheim!“
„Den Sonntag hab’ ich für mich, Mutter!“
„Freilich, ’leicht zum Umflankiren mit dem Lotter?“
„Daß ich zu meinem Vormund geh’, laß ich mir nicht wehren!“
„Und zerrst den Jungen mit!“
„Wenn der Felix morgen auch nach Breitenschlag gehen will, ich kann nichts dagegen haben.“
Constanze eilte der Plätte zu. Sie erschrak selbst über das trotzige Wort, das sie gesagt hatte. Es war das erste in ihrem Leben. Sie hatte eben an den Ausspruch des Unterviertlers gedacht: „Fest auf die Füß’ stellen muß man sich und der Welt die Zähne weisen.“ Aber sie bangte jetzt; ein Lamm hatte dem Wolfe die Zähne gewiesen. Sie stieg mit ihren Tragbändern hastig in die Plätte hinab, die auf den bewegten Wellen schaukelte.
Die Bäuerin stand ganz sprachlos da und zum erstenmal ohnmächtig fühlte sie sich diesem Geschöpfe gegenüber.[S. 93] – Mit dem Burschen zum Vormund will die Dirn’? Dabei schaut für die Ländhoferin nichts Gutes heraus. – Die Bäuerin war blaß, wie die Steine am Ufer. Haß und Wuth wogten in ihrer Brust mit voller Gewalt. Sie fieberte, sie klapperte mit den Zähnen. – Was soll sie der Dirn’ anthun?
In den Bäumen brauste der Sturmwind und die Wellen des Flusses wogten hoch und schlugen gischtend an die Ufer und an die schaukelnde Plätte, daß hoch an die Flachshaufen das Wasser spritzte.
Hinter den Schichten kauerte, schwindlig durch das mächtige Schaukeln, Constanze. Der Strang der Ueberfuhr dröhnte, das Seil, an dem das Fahrzeug hing, spannte sich stramm, dehnte sich und klang im Sturme wie eine Saite. – Die Bäuerin sah es, und in diesem Augenblicke zuckte der wilde Gedanke auf. – Einen kurzen, funkelnden Blick in die Runde warf sie. Hier die Bäume, die Büsche, hier die morschende Scheunenwand, hier das Wasser – kein Mensch zugegen. – Mit glühender Kraft schwang sie das lange Messer, das sie in der Hand hielt, und schleuderte es gegen das gespannte Seil. Knallend riß dieses entzwei, hoch auf wallte die Plätte und schoß davon. – –
Schon kauerte die Bäuerin im Gebüsche; von diesem aus starrte sie auf die hochgehende, trübe Seim, starrte dem rasch hinwogenden Fahrzeuge nach. – „Wirst morgen nicht mit ihm zum Vormund gehen....“
Sie hatte, als das Seil gerissen war, hinter den Flachsschichten den Schrei gehört; – auch sie – die Bäuerin hatte einen Laut ausgestoßen – doch war’s wie Jauchzen.
Und nun – nun war ihr kühl und wohl, das Seil zerrissen – wer kann dafür! Die Plätte zerschellt am Felsen[S. 94] – die Dirn’ ist hin. Der Streit um Hof und Bräutigam ist aus....
Nach einer Weile, als unten an der Biegung, wo die Klamm angeht, das schwimmende Brücklein verschwunden war, athmete die Ländhoferin noch einmal auf, ging dann in den Hof zurück und schaffte wie gewöhnlich, nur daß sie mit den Leuten etwas freundlicher that als sonst.
Nach und nach hieß es: „Wo steckt denn die Dirn’, die Constanze so lang’?“
Da kam eine Magd herangeschossen: „Jesus Maria! Die Plätten, die Plätten ist weg!“
„Jesus Maria!“ schrie die Bäuerin noch viel lauter und schlug die Hände zusammen.
„Das Seil ist ab! Die Plätten ist fort! Die Dirn’ ist hin!“
„So geht doch, so eilt doch um tausend Gotteswillen!“ jammerte die Bäuerin und lief scheinbar in großer Aufregung im Hofe herum. „So läutet um Hilfe! So spannt doch die Pferde ein! Kann denn Keiner schwimmen? Jesus, mein Kind, das liebe Kind! – Wo ist denn der Felix?“
„Der Felix nicht da?“ riefen sie in alle Stuben hinein.
„Der Felix nicht da?“ schrieen sie in den Scheunen um.
„Wo ist denn der Felix?“ lärmten sie durch das ganze Gehöfte.
„Felix!“
Nicht im Hause, nicht in den Wirthschaftsräumen, nicht im Baumgarten war der Felix. Da kam der Halterbub und berichtete, den Felix hätte er voreh auf die Plätte steigen gesehen.
Jetzt war die Ländhoferin still und blaß bis in den Mund hinein. Jetzt wankten ihre Kniee – am Antrittstein der Hausthür sank sie nieder.
Verspielt. Der Felix ist bei der Dirn’!
Ja, der Felix ist bei der Dirn’. Und wie ist er zu ihr gekommen?
Nichts leichter als das. Der Ursachen zum Stelldichein giebt es bei jungen Leuten, die sich gerne haben, übergenug. Der Flachs, der noch vor Abends von der Plätte geschafft werden muß, ist auch eine Ursache.
Felix, lange genug umhergeschlendert im Hofe, war gegangen, um dem Mädchen den Flachs abladen zu helfen. Constanze war dabei ja völlig allein und sollte noch vor dem Dunkeln fertig werden.
Doch ging die Arbeit auch zu Zweien nicht sonderlich von statten. Das Mädchen war gewiß fleißig und eilte mit den Bündeln flink in die Dörrstube und war um’s Handumdrehen auch wieder zurück auf der Plätte. Der Felix aber, das war heute ein fauler Schlingel, er legte sich hin zwischen die Flachsschichten und reckte alle Viere von sich. Dieses Bett schaukelte ja so prächtig, und Constanze hüpfte neben ihm hin und her. Und ihr waren die Flachsbündel so leicht, und ihr war so frisch zu Muthe, wie nie noch zuvor, und es that ihr jetzt fast wohl, nun der Stiefmutter einmal ein selbstbewußtes Gesicht gezeigt zu haben.
Constanze sprang auf die Plätte; Felix wollte sich aus dem Flachse erheben.
„Bleib’ liegen,“ flüsterte ihm das Mädchen zu, „dort hinten steht just die Bäuerin.“
„Was frag’ ich nach der Bäuerin!“ versetzte er, „von der laß’ ich mir das Aufstehen schon lang’ nicht verbieten.“
In demselben Augenblicke schwirrte das Seil, die Plätte schnellte empor und schoß davon.
„Heiliger Gott!“ schrie Constanze und taumelte zu Boden.
„Der vermaledeite Strick ist gerissen!“ sagte Felix, setzte aber sofort bei: „Macht nichts, jetzt fahren wir lustig in’s untere Viertel hinab.“
„Und ist es nicht gefährlich, Felix?“ fragte das Mädchen zitternd und hörte im Sausen und Brausen das eigene Wort kaum.
„Wie kann denn das gefährlich sein!“ rief er laut; „wenn man über das Meer mit Schiffen fahren kann, so wird sich’s wohl auf der Seim auch thun. Höchstens, daß dieses Wasser zu klein wäre, dann trägt’s uns ohnehin an’s Land.“
„So will ich ganz ruhig sein,“ entgegnete Constanze.
„Setz’ Dich nur da an den Flachs und halte Dich fest an mich, Constanze, es kann uns nichts geschehen.“
Mittlerweile flogen die Auen, Büsche und Bäume der grünen Länd rasch zurück, und die Wogen umbrandeten mit Gischten und Brausen das Brücklein, das wie ein Kartenblatt auf den Wellen dahinglitt.
Felix that sich nach einem Ruder um, es gelang ihm nur ein paar schwache Stänglein vom Geländer der Plätte loszumachen. Constanze schlang ihre beiden Arme um den Nacken des jungen Mannes und barg ihr Angesicht an seiner Brust. Da die Ruderarbeit mit den nichtigen Holzstücklein zu nichts dienen konnte, so saß Felix lehnend am Flachshaufen, von welchem das Wasser ganze Theile fortspülte. Fest stemmte er seine Beine, seine Arme an die Balken des Floßes; mit trotzig geschlossenen Lippen starrte er hinaus auf den brausenden Fluß, auf die Ufer, die immer steiler und wilder wurden, bis endlich an beiden Seiten die schroffen Wände dräuten. Zum Glücke war das Gefälle hier geringer und das Wasser[S. 97] floß langsamer. Felix aber wußte nicht, welche Stellen noch kommen würden, er ahnte auch nicht, wie groß die Gefahr war, in der sie schwebten. Und so hub er, als ihm die Lage vertraulicher war, in seinem Uebermuthe an, hi! und hott! zu rufen, als wären ein Paar Rößlein gespannt an das Fahrzeug, und als habe er dieser Rößlein Leitriemen in den Händen.
Da richtete auch das Mädchen allmählich das Auge gegen ihn auf und fragte: „Felix, was wird das werden?“
„Wenn die Schimmel so fortmachen, so sind wir in zwei Stunden daheim,“ versetzte der Bursche, „Die werden schauen, wenn wir angefahren kommen!“
„Und können wir halten?“
„Vor dem Haus steht immer Eins am Wasser, das wird uns schon sehen, und wenn wir nur wollen, überall kommen wir leicht an’s Land hinaus.“
„Ich bitte Dich, Felix,“ sagte Constanze, „wenn’s geht, fahren wir gleich an’s Land!“
„Je, was fällt Dir ein, Dirndl!“ rief er, „hier an’s Land! Ist ja kein Haus und kein Weg weit und breit; wie kämest denn heut’ noch in’s Unterviertel? Hier auf dem Wasser geht’s am geradesten. Hi, Schimmel!“
Waren freilich recht lebhafte Schimmelchen, die schäumenden Wellen zu allen Seiten – schwer zu bändigen.
„Wenn’s nur nicht Nacht wird!“ wendete Constanze ein.
„Nacht wird’s schon!“ sagte der Bursche.
Und thatsächlich begann es unter dem trüben Himmel bereits zu dämmern. Der Wind stieß von verschiedenen Richtungen her, bald schob er im Bunde mit den Wellen die Plätte nach vorwärts, bald prallte er von den Seiten an, dann wieder stemmte er sich dem Flusse und dem Fahrzeuge entgegen. Das Brücklein drehte und wendete sich, ging[S. 98] im Kreise um sich selbst, kam nicht von der Stelle, und dann wieder schwamm es sausend voran und bohrte – was immer noch das Gefährlichste war – wie ein wilder Stier die Hörner in die Erde, die Ecken in das zischende Wasser.
Felix mußte häufig seinen Platz wechseln, um möglichst das Gleichgewicht zu schaffen. Constanze zitterte, schluchzte und betete und sah in der Gefahr eine Strafe für die Unehrerbietung, die sie heute der Mutter entgegengesetzt hatte. In welcher Weise jedoch ihr kühnes Benehmen gegen die Bäuerin mit dem Losreißen der Plätte zusammenhing, konnte sie wohl nicht ahnen.
„Du sollst Dich in den Flachs hinein vergraben, Constanze,“ schlug der Bursche vor, „Du wirst sonst allzu naß.“
Es wäre ihm angenehm gewesen, ihr so die Gefahr zu verhüllen, die er wachsen sah. Das Mädchen aber richtete sich plötzlich auf und sagte gefaßt: „Bist Du so mannbar, Felix, so will ich auch nicht verzagt sein....“
Felix hatte, um dem Nahen seiner Gegend gewärtig zu sein, den Wechsel der Landschaften beobachtet. Waldberge, Felspartien, Wildniß zumeist. Nur einmal hatte er hoch an einem Hange die Straße gesehen, auf welcher er vor wenigen Tagen mit der eroberungssüchtigen Großbäuerin gegen das obere Viertel gefahren war. Gar bald lenkten ihn von diesem Gegenstande die Klippen ab, an welche die Plätte zuweilen prallte, um sofort wieder seithin geschnellt zu werden. Die Brücke hielt fest zusammen. Felix hatte mit den dünnen Stangen des Geländers wiederholt das Rudern versucht. Die Gewalten der Fluth spotteten eines solchen Werkzeuges.
Allmählich war es nun finster geworden. Und so saßen die zwei jungen, lebensdurstigen Wesen im Dunkel der Nacht, mitten im brandenden Elemente.
„Das ist ein unglücklicher Samstagabend!“ murmelte Constanze, und dankte andererseits insgeheim der heiligen Jungfrau Maria, daß nicht sie allein, oder nicht er allein auf der Brücke gewesen, als das Seil gebrochen war.
Felix spähte durch die Dunkelheit in die Gegend hinaus, die sich geweitet hatte und nun schier dem unteren Viertel glich. Es wuchs sein Hoffen und sein Bangen. Ihm war, als müsse seine Heimat Hilfe bieten, als könne es gar nicht sein, daß sie an dem Häuschen der Eltern vorübertrieben, und es streckten ihnen nicht Vater und Mutter die Arme rettend entgegen.
Er that nun manchen lauten Schrei. Aber an den Ufern blieb es öde; nur von der Ferne her glühten zuweilen Lichter eines Hofes, eines Dorfes.
Da die Plätte nahe am Ufer trieb, so dachte Felix auch an das Hinausspringen, oder an das Erfassen eines Strauches. Doch ging die Fahrt zu schnell.
Wenn nun aber kein Anker ist und sie müssen an der lieben Gegend vorbei – dann –
„Dann heißt’s Testament machen,“ murmelte Felix. Gut, daß in dem Rauschen und Rollen das Mädchen die Worte nicht gehört hatte. – Constanze soll es nicht wissen, daß eine halbe Stunde unter dem Heimatshäuschen des Winzers die große Wehr ist, die auch den Hammerbach nach Zollau ableitet, eine hohe Wehr, an der schon Mancher zugrunde gegangen und an der auch der Plan gescheitert war, den unteren Gegenden durch Floßfahrten das Waldholz des Gebirges zu vermitteln.
Viele Leute aus Nah und Fern kamen alljährlich zur „Zollauer Wehr“, um den großartigen Wasserfall zu sehen. Nicht Menschen hatten die Wehr gebaut; hier senkte sich[S. 100] plötzlich die Gegend tiefer und daher der Abgrund. Von all’ dem braucht Constanze nichts zu wissen.
Allmählich wurde der Lauf des Wassers sachter; die Gegend verflachte sich. Felix erkannte einzelne Hügelformen, einzelne Baumgruppen, einzelne schimmernde Häuschen – er nahte seinem Heim.
Wieder erhob er seine Stimme. Ein ferner Widerhall antwortete ihm – aber Niemand kam an’s Ufer und die Plätte glitt weiter und weiter. – Plötzlich stieß der Bursche ein „Ah!“ aus. Er sah das beleuchtete Fenster seines Hauses. Das rothe Scheibchen rückte näher – Felix schrie nach allen Kräften seiner Lunge – gar vergebens war’s, es kam Niemand an’s Ufer.
In Feierabendruhe stand das Winzerhäuschen da. Am beleuchteten Fensterchen glitten Schatten vorüber – die Schatten der Personen, die in der Stube hin- und herwandelten. Sie beteten vielleicht eben die Samstagandacht, wobei der Vater mit der Betschnur gerne langsam in der Stube auf- und abschritt. Und die Mutter kniete wohl vor dem schlichten Hausaltare und gedachte des Sohnes, der fort von Heim in einen reichen Hof gegangen war, um dort sein Brot und Glück zu suchen. Sie ahnte gewiß nicht, daß dieser Sohn in Todesnoth auf dem Flusse vorbeizog.
Und der Schiffer rief vergebens. Das traute Haus blieb zurück und das Brücklein schwamm nun ruhig auf der breiten Seim dahin. Dahin und geradewegs den Schrecken der Zollauer Wehr zu.
Im Haupte des Burschen flogen, schwirrten, stürzten in Verwirrung die Gedanken durcheinander. – Jetzt kommt kein Ort, kein Haus mehr bis zur Wehr – Schiffer, Du bist auf Dich selbst gestellt. – Die losgerissenen Stangen erfaßte[S. 101] er und band sie mit den Strohbändern der Flachsballen aneinander. Dann zwängte er auf der Plätte einen der langen Eisennägel locker und riß ihn in Ermanglung einer Zunge mit den Zähnen aus dem Holze. Diesen Nagel schlug er vermittelst eines losen Balkens in das eine Ende der aneinander gebundenen Stangen.
Constanze verfolgte mit steigender Angst das fieberartig hastige Arbeiten des Burschen.
Am Ufer ging ein Weg entlang. Auf diesem Wege flimmerte jetzt ein Lichtlein, klang ein Glöcklein. Beim Scheine zu sehen waren zwei Gestalten, wovon die eine ein Priester im Chorrock, an der Brust das Heiligste tragend. Ein Gang in tiefer Nacht zu einem Schwerkranken.
Felix schrie nicht mehr um Hilfe; vom Ufer aus zu retten, war alle Zeit vorbei. Aber zu dem Mädchen sagte er die Worte: „Constanze, dort tragen sie das hochwürdigste Gut. Sie gehen zu einem Sterbenden, ’leicht magst Du beten....“
Da ahnte sie, daß es sich um Leben und Sterben handle. Sie fiel auf ihre Kniee, und ihr blasses Antlitz matt beschienen von dem am Ufer vorbeizitternden Lichtlein, betete sie....
Felix fuhr, ohne weiter aufzublicken, in seiner Arbeit fort. Brachte er diese in den nächsten Minuten fertig, so konnte es vielleicht noch zum Guten sein – sonst Alles verloren. – Schon hatte er den Eisennagel durch das Holz getrieben, da barst die Stange, der Nagel war wieder locker. Keine Kleinmuth jedoch war in diesem bedeutsamen Augenblicke an dem Burschen bemerkbar. Rasch kehrte er die Stange um, schlug den Nagel am anderen Ende ein – da engte sich schon der Fluß – die letzte Enge vor der Wehr – die Plätte trieb ein wenig gegen das Strauchwerk des rechten[S. 102] Ufers. Der Nagel saß fest – sachte, daß er nicht breche – bog ihn Felix zu einem Haken um, und nun, mit bebender Gier, warf er diesen Anker gegen das Strauchwerk aus. Die Stange war zu kurz. Schon hub die Plätte an, sich wieder vom Ufer zu entfernen; da erfaßte Constanze einen der kurzen Balken, stieß ihn als Ruder in’s Wasser, lenkte so ein paar fußbreit das Fahrzeug nach rechts, und Felix hatte sich mit dem Anker festgehakt im Buschwerk.
Unschwer war nun auf dem hier fast ruhigen Wasser die Plätte an’s Ufer zu ziehen; Constanze und Felix sprangen oder wanden sich vielmehr durch das Gebüsche an’s Land. – Der Bursche stieß einen hellen Juchschrei aus; das Mädchen sank auf die liebe feste Erde hin und weinte Freudenthränen.
Genau um diese Zeit des späten Abends schimmerte im Gewölke, das über der weiten Ebene stand, ein matter Schein. Höher und höher strebte er auf in seiner milden Röthe, einen weiten rosigen Bogen beschrieb er in den Wolken des Himmels.
Es war der Mond.
Für die Froschreiterleut’ im Winzerhause war das eine seltsame Nacht.
Zuerst der geisterhafte Ruf beim Abendgebete. Dann ging der Priester mit dem Sterbesacramente vorbei. Ein alter Mann im Johannesthal lag auf den Tod. Man hatte vor dem Einschlafen für ihn noch etliche Vaterunser gebetet. Aber es war keine Ruhe. – Um Mitternacht kamen sie an.
Die Mutter hatte den Felix schon am Klopfen an die Thür erkannt. Der Vater hingegen hatte es nicht glauben wollen, daß dieser Mensch mit der jungen Genossin sein Sohn sei.
Zuerst hatten sie bei dem schlechten Schein des Oellämpleins die weibliche Gestalt für die Ländhoferin gehalten; und jetzt war es eine ganz andere und noch dazu eine blutjunge Person; und die Leutchen – man sah’s gleich – waren recht gut mitsammen bekannt.
Der alte Froschreiter schoß in die Nebenkammer, schlug dort die Hände über den Kopf zusammen und jammerte: „Sonst ein so braver Bub gewesen und jetzt auf einmal zerrt er mir die Weiber in’s Haus!“
„Wir können niemand Fremden über Nacht behalten!“ sagte die Mutter scharf, einen Blick auf Constanze werfend.
Der kleine Anton war auch aufgestanden, der bot der Fremden sein eigen Bett an; die gefiel ihm viel besser als die dicke Ländhoferin.
Constanze blickte verzagt zu Felix auf.
„Ja, regnet’s denn draußen?“ rief die Froschreiterin, „Ihr seid bigott allzwei waschnaß!“
Und nun erzählte Felix die schöne Fahrt auf der Seim und die Rettung vor der Zollauer Wehr. Da ging es bald aus einem andern Ton im Winzerhause. Die Mutter packte den Sohn am Halse: „Nicht umsonst hat mir die letzt’ Nacht so geträumt! Allerweil bin ich auf der Hochzeit gewesen – und das ist das sicherste Zeichen, daß wer stirbt.“
„Ist ja Niemand gestorben!“ sagte der Felix.
„Aber sein hätt’s können, Du Narr! – Ach, Du liebes Kind!“ und fiel ihm wieder um den Hals.
„Beim Flachsabladen, hast gesagt, beim Flachsabladen wär’s geschehen?“ fragte der alte Winzer mit tief vorge[S. 104]beugtem Haupte, und mit etwas unsicherer Stimme setzte er bei: „Was ist denn heut’ für ein Tag?“
„Heut’ ist gar kein Tag, heut’ ist die Nacht,“ erklärte der kleine Anton.
„Weil ich sagen will, wir müssen alle Jahr’ an diesem Tag eine Kirchfahrt auf den Schutzengelberg machen, aus Dankbarkeit für das Mirakel, das heut’ ist geschehen.“
„Eine warme Suppe wär’ mir noch lieber,“ sagte Felix; und da schrie die Mutter: „Weil Eins gar nicht weiß, wo Einem der Kopf steht! Ja freilich werden sie zu essen auch was haben müssen!“
Mitten in der Nacht knatterte das Feuer auf dem Herde. Ein Bund Maisstroh wurde in die Stube geschleppt und von jedem Bette des Hauses das beste Stück: vom alten Winzer das Leintuch, von seinem Weib’ die Decke, von der Tochter das Kopfpolster, vom kleinen Anton der Fußwärmerziegel wurde herbeigebracht, um davon der armen Dirn’ aus dem Ländhofe ein gutes Bett zu bereiten.
Dann aßen sie, dann gingen sie schlafen.
Noch bevor der Felix in seine Dachkammer hinaufstieg, sagte er zum Mädchen ein so warmherziges Wort, daß dem Alten, der es unversehens hörte, der Athem stehen blieb.
Nach all’ der Anstrengung und Angst schliefen die Schiffbrüchigen bald ein. Der alte Froschreiter wachte noch lange und murmelte ein- über’s anderemal: „Ist was dahinter bei diesen zwei Leuten! Ist was dahinter!“
Auch die Winzerin schlief nicht. Es klang ihr so in den Ohren und hinter dem Herde spann die Hauskatze – „’s ist noch nicht richtig!....“
Noch ehe der Tag anbrach, klopfte es am Fenster des Winzerhauses und eine rauhe Stimme rief von außen: „He,[S. 105] Leute, auf, ’s ist was geschehen! – Hat gestern spät Abends oder in der heutigen Nacht Niemand von da wahrgenommen, daß auf der Seim ein Floß herabgefahren wär’?“
Constanze sprang von ihrem Lager auf: „Der Vormund! Das ist ja mein Vormund!“
„Was höre ich denn!“ rief der von außen, „die Constanze? Und da d’rin wäre sie? O Du mein Gott! O Du lieber Gott!“
Bald war das ganze Haus wach. Der Mann draußen führte sein Pferd unter Dach, denn es stürmte, regnete und schneite; dann schritt er in die Stube.
Es war ein rauhgestaltiger, vollbärtiger Mann – es war Constanzens Vormund, der alte Freund des Ländhofer’s, der Waldmeister aus Breitenschlag.
„Mit dem bist gefahren? mit dem da?“ fragte er das Mädchen und versetzte dem Winzerssohn einen Handschlag auf die Achsel. Und hierauf mußten sie ihre Wasserreise und ihre Rettung wieder und wieder erzählen. – Der Waldmeister war froh, daß auf seinem Angesichte so viel Bart wucherte, in welchem sich ein paar unberufene Augentropfen leicht verstecken konnten.
„Jetzt aber, Ihr Leute,“ sagte endlich der Mann von Breitenschlag, „jetzt habe ich etwelches vom Ländhofe zu erzählen. Dort ist die Nacht nicht so glücklich abgegangen, als da im untern Viertel. – Ich darf’s auch Dir sagen, Constanze – die Ländhoferin ist gestorben.“
Ein mehrstimmiger Ausruf.
„Was hab’ ich nicht gesagt!“ rief die Froschreiterin, „mir hat frei so viel von der Hochzeit geträumt, und das hat kein gut Vorbedeuten. – Aber na, wie hat denn das mögen sein?!“
„Will’s wohl erzählen,“ sagte der Waldmeister. „Gestern in Breitenschlag – ’s ist schon dunkel worden – will mich just stät für den Sonntag einrichten – kommt ein Bot’ von der grünen Länd: groß Unglück geschehen, die Constanz’ und den jungen Unterviertler das Wasser vertragen – die Bäuerin auf den Tod krank. – Der Schlag hätt’ sie troffen in hellem Schreck, vor der Hausthür wär’ sie zusammengesunken und ich sollt’ eilends mitkommen. Ich frag’ nicht erst, wer der junge Unterviertler ist, spring’ auf mein Rössel und in einer Stund d’rauf bin ich im Ländhof. – Mit der Bäuerin ist’s vorbei, das seh’ ich gleich; blaß wie das Leintuch, liegt sie auf dem Bett, kann nimmer viel reden.“
„O Gott, meine arme Mutter!“ weinte Constanze.
„Geh’ Dirn’, sei jetzt still,“ sagte der Vormund, „hast Ursach’ zu klagen, so ist später auch noch Zeit dazu. Jetzt hör’ auf meine Red’. – Bäuerin, sag’ ich und geb’ ihr die Hand hin, was ist Dir so jäh widerfahren? – Ist’s der Waldmeister? fragt sie, wenn’s der Waldmeister ist, so möcht’ ich ein paar Wort’ allein mit ihm reden. – Drauf gehen die Leut’ aus der Stube. – Ländhoferin, sag’ ich zu ihr, hast ein Anliegen? – Ich möcht’ weinen, giebt sie zur Antwort, möcht’ weinen und kann nicht. Ein Teufel ist in mir. Waldmeister, ich verspür’s, ’s ist mein End’, auf einmal jetzt mein End’. Mein Herrgott wird mich nicht verlassen. Ich will Alles sagen. Waldmeister, ich kann ja nicht’s dafür, daß ich den Burschen so lieb hab’ gehabt. Geeifert hab’ ich mit der Dirn’, und ich hab’ sie wollen aus dem Weg schaffen. Ich selber hab’ das Plättenseil abgeschnitten –“
Wieder ein Schrei des Schreckens und Constanze rief: „Nein, Vormund, das kann nicht sein, das hat sie im Fieber gesagt.“
„Du bist eine gute Seel’, Mädel,“ versetzte der Waldmeister, „und das hat sie in der letzten Stund’ noch eingesehen. Um Verzeihung bitten läßt sie Dich für Alles; sollst recht glücklich sein auf dieser Welt. Das ist ihr letztes Wort gewesen.“
Constanze schluchzte bitterlich. Alle waren ergriffen.
„So hat sie mir’s anvertraut,“ fuhr der Waldmeister fort, „wie sie Alles gemeint hat, das muß ich erst von Euch erfahren. – Nun, und die Leut’ sind an der Seim dahingeeilt, und um Mitternacht, da die Bäuerin verschieden war, bin auch ich auf mein Pferd gesprungen und dem unteren Viertel zugeritten, daß ich doch eine Spur von Euch könnt’ entdecken. ’s ist mir gut gerathen, Gott sei Lob, ’s ist mir gut gerathen.“
„O, arme Mutter,“ klagte Constanze, „sie ist gewiß eine brave Frau gewesen und hat’s nicht bös’ mit mir gemeint!“
„Den Todten nichts Uebles, aber die Wahrheit muß an’s Licht,“ sagte der Vormund. „Kind, die Bäuerin hätte Dich vielleicht lieb gehabt, wenn nicht Deines Vaters Testament vorhanden gewesen wäre. Sie hat es gewußt, daß Du mit dem Eintritte Deiner Großjährigkeit der Herr auf dem Ländhofe sein wirst.“
„Ich bitt’ Euch, laßt mir jetzt diese Dinge weg!“ rief das Mädchen, „es hat uns erst der Tod die Hand gegeben.“
„Wohl, wohl, aber jetzt kommt wieder das Leben d’ran,“ versetzte der Waldmeister, „ich bin der Vormund und mir ist darum zu thun, daß Du jetzt weißt, wie es steht und was Du zu thun hast. Von heut’ an werden alle Schriften über den Ländhof auf Deinen Namen lauten. Ich bin ein betagter[S. 108] Mann und hab’ auch auf mein Haus zu denken, aber ich werde Dir in der Wirthschaft helfen, bis Du einen anderen, jüngeren Vormund wirst gewählt haben.“
Felix nieste. „Helf’ Gott!“ sagte er für sich selber, „und wahr soll’s sein, was ich mir jetzt gedacht hab’!“
Den Erzähler könnten wir jetzt verabschieden; wir wissen doch, wie es kommt. Weil der Vormund schon betagt ist und auf sich selber zu schauen hat, so muß die junge Ländhoferin – denn das Erbe des Vaters kann sie nicht ablehnen – dazuthun, daß sie bald einen Wirthschafter findet. Auch muß die Weltordnung so bestellt sein, daß, wenn die Froschreiterin von der Hochzeit träumt, es auch wirklich eine Hochzeit bedeutet. – Zu Martini, wie es die selige Bäuerin vor hatte, ist es wohl etwas zu früh, denn Constanze will der unglücklichen Stiefmutter etliche Wochen stillen Gedenkens weihen. – Aber nach Neujahr, zum Fasching, wenn’s anständig ist, Felix! – Warum denn nicht, der Felix ist allzeit bereit.
Einen seltsamen Gedanken hatte der alte Froschreiter. Unten in der Tiefe der Zollauer Wehr kreisten nämlich tagelang die Trümmer der Plätte und mehrere der Flachsbündel. Und da sagte der alte Winzer zu seinem Sohne: „Weißt, Felix, was ich an Deiner Stell’ thät’? Ich thät’ da unten den schönen Oberviertlerflachs aus dem Wasser fischen und fein brecheln, spinnen und weben lassen – ich sag’, das müßt’ ein gutes Bettzeug geben!“


Auf sonniger Bergeshöhe steht ein Haus. Zur Morgenstunde leuchtet es mit seinen röthlichen Holzwänden und seinen hellen Fensterscheiben freundlich nieder in das thaufrische Thal, wo zwischen den Wiesen und silberweiß schimmernden Weidenbüschen der dunkle Forellenbach hinzieht, und wo das Dorf liegt. Zur Morgenstunde hängt stets ein bläulicher Aetherschleier über dem Dorfe, aber die schlanke Kirchthurmspitze ragt heraus und läßt ihr vergoldetes Kreuz in der Sonne funkeln. Und wer nicht Augen hat, diesen Strahlengruß zu sehen, der hat wohl Ohren, das Morgenlied der Glocke zu vernehmen.
Zwei Männer, die aus dem Thale langsam gegen das Haus auf der Bergeshöhe emporsteigen, hören den Glockenklang und ziehen ihre spitzigen Hüte ab. Ein vorgeneigtes Greisenhaupt und ein nach rückwärts strebender strohlichter Lockenkopf sind es, die im Gehen ihre Morgenandacht verrichten und sich fromm einschließen in des Pfarrers Messe, deren Beginn die Glocke eben verkündet hat. Die beiden Männer haben mit einander eben nichts zu sprechen, und so überläßt sich jeder seinem Gebete. Der Alte ist demüthig, blickt zur Erde, zuweilen auch ein wenig nach rechts und links, denn es verlangt ihn zu wissen, wie die Saaten grünen. Der[S. 110] Kopf mit den Strohlocken richtet seine großen Glotzaugen und seinen halboffenen Mund geradewegs zum Himmel hinauf; da oben fliegen und zwitschern die Meisen und die Amseln, und er, der Strohlockenkopf erwirbt sich durch Vögelfangen sein Kegelschiebgeld und seinen Bruderschaftsbeitrag zum Jünglingsverein.
In solcher Andacht versunken, langten sie endlich oben am Hause an.
Das Haus stand auf freier Höhe und lehnte sich rückwärts an einen sanft abfallenden Tannenwald. Es war weder Stall noch Scheune da; ein kleiner Garten umgab den Bau und gegen die Morgenseite hin blühten Büsche und ragte eine Eiche. Das Haus war in dieser Gegend ganz seltsam: es war weit geschmackvoller als andere Menschenwohnungen der Gegend, und doch wieder viel einfacher als die Landhäuser der Reichen. Es war mit keiner dieser Gattungen vergleichbar. Das Haus ragte hoch, hatte an den Fenstern und Thoren feingeschnitzte Zieraten, nach Art korinthischer Säulen mit schön durchbrochenen Gesimsen. Die Fenster waren schmal und hoch, das Dach aus glatten Schindeln flach und luftig; gegen Mittag hin stand ein erkerartiger Söller hervor, mit festen Seitenwänden wohl verwahrt, mit einem Kranzgesimse in dorischer Form überbaut. Das Haus stand wie ein Tempel.
Wie die beiden Männer bisher ihr Haupt entblößt hielten, so bedeckten sie es jetzt, da sie in diesen Tempel traten.
War aber doch kein Tempel, war theils ein bequem und zweckmäßig eingerichtetes Wohnhaus, theils eine Künstlerwerkstätte.
An den Wänden standen Statuen aus Holz in allen Gestalten und Größen; mitten im Raume ragten Klötze, halbfertige Schnitzwerke, ihrer völligen Vollendung harrend.
An einem solchen Klotz stand der Bildner, ein schier gebeugter, aber doch behendiger Greis mit schneeweißen Locken, starken weißen Augenbrauen und mit frischrothen Wangen. Auf diesem Antlitze hatte der Meißel des Schicksals den Ausdruck stiller Freude und Befriedigung, aber auch den Zug einer schweren Vergangenheit und den ehernen Hauch eines starken selbstbewußten Geistes eingegraben.
Als die beiden Männer aus dem Thale eintraten und einen christlichen Gruß sagten, zog der Bildner sein Käppchen vom Haupte. Aber die Ankömmlinge thaten nicht desgleichen, diese ziehen ihre Hüte nur vor dem lieben Herrgott und vor dem Herrn Pfarrer.
Der Bildner wies ihnen in der Nähe der Wandfiguren Sitzplätze an; das Grauhaupt nahm den seinen sofort in Beschlag, der junge Gelblockenkopf aber stand ganz verlegen und wendete sich und wußte nicht, wo er sein erröthendes Gesicht hinthun sollte.
„Nu, Steff!“ sagte das Grauhaupt, und das Wort war ein Ermahnen zum Platznehmen.
„Na,“ versetzte der Bursche, weinerlich lächelnd, „da setz’ ich mich nicht hin, ich nicht. Das ist schon gar aus der Weis’! – So – hell mutternackt!“
Wie konnte nur Meister Eman dem jungen unverdorbenen Kirchensteff, der zur Bruderschaft des heiligen Aloisius zählte, zumuthen, neben der capitolinischen Venus Platz zu nehmen! Indeß bemerkte der Bildner lächelnd sein Fehl, und in der Nähe einiger Kobolde und ziegenfüßiger Faunen fand sich eine prächtige Sitzstelle für den jungen Mann.
„Was verschafft mir nur heute den Besuch?“ fragte der Bildner.
„Gelt, das ist zum Verwundern!“ rief das Grauhaupt und rieb sich vergnüglich einigen Erdstaub von seinem Zwilchärmel, denn er war der Todtengräber. Aber nicht in dieser Eigenschaft war er heute zu dem Hause des Bildners emporgestiegen, sondern in jener seines zweiten Amtes, denn er war auch Kirchenvater, d. h. der Mann, der nebst dem Pfarrer die Aufsicht über die Dorfkirche führte und an Sonn- und Feiertagen als Meßner waltete.
„Schaut, Meister Eman,“ sagte er schmunzelnd, „ein Grabkreuz brauch’ ich diesmal nicht, und redlich herausgesagt, Meister, die Grabkreuze macht Er nichts nutz. Mehr Blut muß auf die Herrgötteln kommen, viel mehr Blut; und die armen Seelen im Fegfeuer läßt Er ganz und gar aus. Hätt’ Ihm auch sagen mögen, daß sich ein Bildniß, wie Er es auf Seiner Gottseligen Grab gestellt, in einen christlichen Friedhof gar nicht reimt. Geht mich aber insoweit nichts an; und wir wissen es allmiteinand’, der Meister kann Seine Sach’ schon auch gut machen, wenn Er nur will. Wir bringen Arbeit, Meister.“
Der Meister lächelte ein wenig über den bevormundenden Ton des Kirchenvaters, und da er von den Leuten vollständig unabhängig war, so ließ er sich derlei Bemerkungen um so gleichgiltiger gefallen. Nun hatte er seinen Schnitzer beiseite gelegt und sich dem Grauhaupte gegenübergesetzt.
„Ja, ja,“ sagte der Kirchenvater und schlug seine flache Hand auf die Lederhose des Oberschenkels, daß es klatschte, „das ist eine verzweifelte Geschichte, jetzt; wir brauchen eine neue schmerzhafte Mutter Gottes auf unseren Hochaltar. Die alte ist schon caput über und über. In drei Tagen ist Frohnleichnam, mag Er uns bishin eine schaffen?“
Der Meister zwinkerte mit den buschigen Brauen, hob langsam seine Stirne empor, daß sich das Gesicht erklecklich verlängerte und über die Schläfe scharfe Runzeln zog.
„Drei Tage arbeitet der Schneider an einer Joppe,“ sagte er hierauf.
„Halt nu,“ brummte der Kirchenvater, „wenn der Meister meint, daß Er in drei Tagen nicht fertig werden kann mit der Schmerzhaften, so hat’s ’leicht wohl Zeit bis zum Sonntag.“
„Mein sehr guter Vetter,“ entgegnete der Meister in der landesüblichen Redensart, „unfertig kommt nichts aus meinen Händen, denn die Dinge, die wir als Bildnisse aufstellen, halten länger als ich, als Ihr, als das jüngste Knäblein Eurer Gemeinde. Und wehe Dem, der Aergerniß giebt einem kommenden Geschlechte! Wenn ich bereit bin, die Arbeit zu übernehmen, so kann das Frauenbild bis zur Weinachtszeit hin fertig werden.“
Schier sprachlos war der Kirchenvater. Da ergiff sein Sohn, der Steff, das Wort, und meinte, gut Ding brauche Weile, und man müsse halt einstweilen den Fastenschleier über die Mutter Gottes hüllen, denn es sei schon gar alles Gold weg von ihrem Rock, und von den sieben Schwertern in ihrer Brust seien fünf schon armselig abgebrochen; in solchem Zustande, das sei wohl einzusehen, könne sie sich nicht mehr länger ansingen lassen.
„Liebe Leute,“ sagte nun der Bildner, „wenn ich das Bildniß schnitze, so soll es, so weit das in meinen Kräften steht, ein Kunstwerk werden. Ein einfaches, würdiges Bild, die Gestalt einer glorreichen Himmelskönigin und demüthigen Jungfrau zugleich; ein Bild, das die frommen Beter mit Andacht und Liebe erfüllt.“
„Und der sieben Schwerter wegen wollt’ ich noch sagen,“ meinte das Grauhaupt, „wenn sie halt thäten vergoldet werden; die Ottenkircher haben es auch so.“
„Soll ich das Bild verfertigen,“ sagte der Meister nicht ohne Nachdruck, „so werden die Schwerter ganz wegbleiben. Der Schmerz der Gottesmutter soll in der Stellung der Gestalt und auf dem Antlitze ausgedrückt sein.“
„Eine Schmerzhafte ohne Schwerter!“ rief der Kirchenvater aus.
„Wohl,“ sagte der Meister, „die alte Darstellung mit den sieben Messern in der Brust ist albern und lächerlich, abgeschmackt im höchsten Grade – läßt sich mit der Kunst nimmer vereinen.“
„Thäten aber doch bitten,“ versetzte das Grauhaupt, „thäten ja die Ueberkosten gern extra bezahlen –“
„Eine solche Bestellung lehne ich dankend ab,“ sagte der Bildner und erhob sich; „wollt Ihr Fratzen haben auf Euren Altären, so seid Ihr bei mir am unrechten Mann.“ Sein Gesicht war dunkelroth, das Künstlerthum in seiner Seele war beleidigt.
Die Männer aus dem Dorfe schlichen achselzuckend davon.
Der Meister meißelte an seinem Lindenholze weiter. Aber nicht lange. Sein Arm zitterte, er legte das Werkzeug aus der Hand und starrte auf die Statuen hin, die an den Wänden aufgestellt waren. Der ganze sinnenlebendige Mythus der Griechen war hier verkörpert. Aber des alten Mannes Blick hing heute nicht an der lieblichen Eos, nicht an der hehren Pallas Athene, nicht an dem ehrwürdigen Zeus, nicht an den heiteren Gestalten der Musen; etwas länger weilte er an den finsteren trotzigen Recken der deutschen Göttersagen. – Tretet aus Eurer Starrniß und stürzet die Götzen[S. 115] der Nachkommen! – Das war vielleicht des Greises Gedanke. Endlich verließ er die Werkstätte und ging in das Freie.
An der schattigen Rückseite des Hauses, gegen den sonnengoldigen Tannenschachen gekehrt, stand ein anderes Bild. Es war eine junge, lieblich schöne Gestalt, halb noch Knabe mit frischen, vollen, trotzigen Lippen, mit aufgeweckter, stolzer Körperhaltung; halb Jüngling mit zarten, weithin gegossenen Locken, mit großen, schwärmerisch seligen Augen. Die Gestalt, in ein sich gefällig schmiegendes Schäferkleid gehüllt, war ein wenig vorgebeugt; am linken Arme trug sie eine Tafel, in der rechten Hand hielt sie einen Stift. So stand sie in ihrer Unbeweglichkeit da und betrachtete den herrlich leuchtenden Wald.
Die finstere Wolke verschwand auf des Meisters Stirn; er hielt seinen Schritt an und blickte wohlgefällig auf dieses freundliche Bild.
Nach einer Weile rief er den Namen: „Aladar!“
Da löste sich die Unbeweglichkeit der Gestalt, sie hüpfte heran und sagte mit heller Stimme:
„Vater, jetzt habe ich es erfaßt, was in den Wipfeln der Tannen ist. Aber sag’, hab’ ich es wohl auch ganz erfaßt?“
Mit dieser zweifelumschatteten Zuversicht hielt der Knabe die Tafel seinem Vater hin.
Der Meister betrachtete die Zeichnung; dabei wurde sein Angesicht fast furchenlos und er sagte die Worte: „Es ist gut. Aber höre: ganz hast Du es nicht erfaßt, was in den Wipfeln der Tannen ist. So geht es immer. Der Junge rechtet mit der Gegenwart, der Alte mit der Vergangenheit; der Junge mit der Natur, der Alte mit der Kunst; aber mich will es zuweilen bedünken, beide ringen vergebens. Wohl, mein Sohn, und es ist gut. Der Künstler darf in[S. 116] seinem Werke nie die volle Befriedigung finden; steht das Ideal seines Zieles nicht über dem Erreichbaren, so steht es zu tief. Das gilt besonders in der bildenden Kunst. Aus dem Nichtbefriedigtsein entspringt das ersprießliche Streben. Komm, Aladar, Du sollst das Gedeihen meines Helios schauen.“
Sie gingen in das Haus und standen vor dem Lindenklotz, an dem der Alte vorhin gearbeitet hatte. Aus dem rauhen Holze starrte ein Antlitz hervor, zwar noch herb und eckig, aber in seinen Hauptpartien doch edel und scharf markirt.
Der Bildner schien den bösen Eindruck des Morgenbesuches nun vergessen zu haben. Sein Blick lag freudig auf der allerdings noch sehr unvollendeten Arbeit und auf dem Jüngling, der die Holzsäule still und eingehend betrachtete.
„Der Gedanke in mir, das Sinnbild des Licht- und Flammengottes darzustellen, ist vielleicht dreimal so alt, als Du, mein Junge,“ sagte der Meister. „Aber das Geschick meines Lebens hat mich niemals zu jener Ruhe und Klärung kommen lassen, die zu einem solchen Versuche durchaus nöthig ist. Nur die kurzen Tage, die mir an Deiner Mutter Seite zu leben gestattet waren, hätten dazu vielleicht die Helle und Begeisterung geboten, nicht aber die Ruhe. Es ist in Stunden hochwogender Glückseligkeit, sowie in Tagen wilder Qual noch kein Kunstwerk geschaffen worden. Mir sind solche Zeiten nun vorüber und in diesen stillen Nachsommertagen habe ich mich endlich an meinen Lieblingsgedanken gemacht. Der Gottheit, die uns das Licht gegeben hat und von deren flammendem Wagen Prometheus das Feuer geholt – das göttlichste und wunderbarste der Elemente – dieser Gottheit will ich das letzte Werk meines Schaffens weihen, ehe ich eingehe zur ewigen Nacht.“
Die letzten Worte waren in großer Gefühlsbewegung gesprochen. Aladar’s dunkle Augen sogen jedes Wort von den Lippen des Vaters und sie entflammten in Begeisterung. Der Jüngling legte seinen Arm um die Statue, und als der Meister aufgehört zu reden, sagte er: „Mein Vater, Du hast heute wieder ein Wort gesprochen, das ich nicht recht verstehen kann. So erzähle mir endlich von Deiner Vergangenheit und von meiner Mutter.“
„Du wirst noch zu jung dazu sein,“ antwortete der Greis.
„Ich weiß das nicht. Ich bin erwachsen und schon ein Mann; ich werde morgen sechzehn Jahre alt.“
Nach einer Weile entgegnete der Vater: „Daß man aufblühende Blumen nicht in den Schatten stellen soll, das weißt Du. So hätte ich Dich gern verschont, mein Kind, und Dich blühen lassen im Sonnenlichte. Ich wollte Dich nicht vorzeitig aus dem Arkadien Deiner Kindheit verstoßen, so sehr es mich oft gedrängt hat, mich ganz und voll Dir mitzutheilen. Nun, ich sehe, Du wendest Dich freiwillig von den kindlichen Freuden und bist ernst und männlich geworden schier vor der Zeit. So will ich Dir auf Dein Begehr, und da es doch einmal sein muß, zu Deinem sechzehnten Geburtstage das Angebinde des Schmerzes machen. Morgen zur Nachmittagszeit, wenn die Sonne hinter die Wipfel des Tannenwaldes wird gezogen sein, wollen wir mitsammen niedersteigen in das Thal.“
Ein Weiteres von dieser Sache wurde heute nicht mehr gesprochen. Jeder ging an seine Arbeit. Der Meister meißelte an seinem Helios, und Aladar – das Bedürfniß des Tages ist stets der Herr im Hause – wirthete in der Küche.
Und am anderen Tage, als die Sonne hinter die Wipfel des Tannenwaldes gezogen war, wurde das einsame Haus auf der Bergeshöhe verschlossen und der Greis und der Jüngling stiegen niederwärts gegen das Thal.
Aladar hatte vom Hause weg kein Wort mehr gesprochen; auch der alte Mann schritt stumm dahin. Gar die Waldvöglein schwiegen zu dieser Tageszeit; nur daß zuweilen vom Tanne her das eintönige Hacken eines Spechtes vernehmbar war. „Selbst im Walde ist kein Sang mehr, ist nur das harte Pochen der Arbeit!“ sagte der Bildner. Eine Hummel summte über das grüne Heidekraut; da stand der alte Mann still und flüsterte: „Hörst Du die Glocken läuten?“
Der Bursche gab keine Antwort. Und als sie weiterschritten, hub der Mann an zu reden:
„In einem Thale jenes Gebirges, welches das weite Ungarland gegen Mitternacht hin begrenzt, bin ich geboren worden. Mein Vater war Hirt und hütete die Pferde des Gutsherrn. Auf wilden Pferden bin ich gesessen und habe sie gebändigt. Den Gutsherrn habe ich unsäglich gehaßt, denn er hatte einmal meinen Vater schlagen lassen bis auf’s Blut. Gewesen ist’s des einen Wortes wegen, das mein Vater gesprochen: Herr, unsereins ist auch ein Mensch, und es ist himmelschreiend, wie wir unterdrückt werden! So ein Wort hat früher schwerer gegolten, wie drei Todtschläge. Dazumal – Aladar, und das ist noch nicht lange her, diese junge Eiche hier ist noch in den Tagen der Knechtschaft aus der Erde gesprossen – dazumal hat der Gutsbesitzer willkürlich verfügt, nicht blos über seine Pferde und Schweine, sondern auch und weit rücksichtsloser noch über seine Unterthanen. Meine Mutter soll ein schönes Weib gewesen sein;[S. 119] als sie starb, war ihr letztes Wort zu mir: „Emanuel, und halte Deinen Nährvater in Ehren!“ – Mich hat dieses Wort in eine große Wirrniß gesetzt; aber meinem Vater, dem armen schutzlosen Hirten, bin ich treu gewesen, und zutiefst im Herzen habe ich geschworen mitten unter den wiehernden Rossen: „Die blutigen Streiche sollen nicht vergessen sein!“ – Gar bald bin ich von dem alten Manne gerissen worden, ich weiß heute noch nicht wie; nur das weiß ich, mit meinem Willen ist es damals nicht geschehen. Ich mag wohl irgend welche geistige Anlage gehabt haben; ich erinnere mich nur, daß ich nicht mit meinen Genossen hielt, daß ich sie aber beeinflußte. Auch schwebt es mir noch vor, daß ich als Hirte aus dem Lehme der Heide allerlei Gestalten formte. War das die Ursache, oder war es, weil ich unter meinen Standesgenossen mehrmals Aufwiegelungsversuche gegen den Gutsherrn gewagt hatte, die indeß stets armselig zu Schanden geworden sind – oder war es ein anderer Grund, kurz, ich wurde entfernt und bestraft, wie so großmüthig noch kein Thunichtgut bestraft worden ist. Der Gutsbesitzer ließ mich in die Hauptstadt Pest bringen und dort in eine Lehranstalt stecken. Anfangs war ich hier wie vom Himmel gefallen, wußte gar nicht, was das Alles zu bedeuten. Bald aber sah ich die gute Wendung ein.
„Ich habe lange und mit Liebe studirt. Nach wenigen Jahren schon war ich aus mir herausgewachsen. Ich sog den Geist der Alten ein und auch die Ideen der Neuen; das entzweite mich anfangs, ich empfand die Nothwendigkeit, daß hier eine Brücke gebaut werden müsse, und ich fand, daß nach den Gräueln zweier finsterer Jahrtausende sich die Welt wieder anschickt, in die Fußstapfen der Alten einzu[S. 120]lenken. In dieser Zuversicht atzte ich mein Herz an dem ewigen Schönheitsidole des alten Hellas und seiner heiteren Weisen, und in diesem Bewußtsein habe ich mich mit jauchzender Seele der bildenden Kunst ergeben. Nach zwölf Jahren arbeitete ich in klingendem Marmor. Meine Bilder wurden aufgestellt in Palästen.
„Jetzt wäre ich glücklich gewesen, aber das Wort der sterbenden Mutter hat mir im Herzen gebrannt. Und wehe dem Kinde, vom Verhängnisse berufen, seine Mutter etwa an seinem Vater rächen zu müssen!“
Der Greis schwieg. Sie gingen durch jungen, duftenden Anwuchs hinab, der dichter und höher wurde und endlich die Wandelnden in seine Schatten hüllte. Der Boden war steinig und von Wurzelarmen durchzogen. Da sagte der Vater zu seinem Sohne: „Habe Acht, daß Du nicht strauchelst!“
Endlich fuhr er in seiner Erzählung fort:
„Einst zur Sommerszeit kehrte ich in mein Heimatsthal zurück. Der alte Hirt – mein Vater – war begraben, seine Hütte verfallen. Aber ich wohnte ja im Schlosse und der Gutsherr ging mit mir Arm in Arm. Ich empfand stets, ich hatte durch das Studium meinen Beruf glücklich getroffen, aber ich fühlte gegen meinen Wohlthäter nicht die begeisterte Dankbarkeit, die ich wohl schuldig gewesen sein mochte. Mehrmals wollte ich den Herrn Arm in Arm auf den Kirchhof führen und zu einem Mauerwinkel hin, wo Nesseln wuchsen – unter denen meine Mutter lag. Er folgte mir nicht. – Zerstreuung, oder was man so nennt, gab es genug; der Gutsherr war ein Meister des Vergnügens. Würfeln und Schwelgen wußte er hoch zu betreiben; auch die Prügelbänke und den Galgen zählte er zu den Gegenständen seines Ergötzens. Einst[S. 121] ließ er zu Ehren eines erlauchten Gastes drei eingefangene Korndiebe ohne gesetzliche Aburtheilung an den Platanen des Lustgartens hängen. – Wohl, mein Sohn, es ist schade um Deine rothen Wangen, die ich jetzt verblassen sehe; aber sei ein Mann und höre mich weiter. – Eines Tages während meiner Anwesenheit im Thale war große Hirschjagd. Die Treiber waren schon zwei Tage und Nächte ununterbrochen bei Sturm und Regen in ihrem über Berg und Thal gezogenen Kreise gestanden, um das zusammengedrängte Hochwild einzuschließen. Die Jagd begann, wir durchbrachen auf unseren Rossen den Kreis; die Hörner schrillten, die Schüsse knallten von allen Seiten und das Johlen der leidenschaftlichen Jägerrotte gellte fast unheimlich durch die Waldung. Ich hielt mich abseits, mir war nicht um Schuß und Wild zu thun; ich band das Roß an eine Eiche und lagerte mich auf einen stillen, schattigen Anger und lauschte einer Quelle. Einen unsäglichen Ekel hatte ich vor dem Treiben dieser rohen, der crassen Willkür ergebenen Gesellen, die sich die Großen des Landes nannten. Unter den Schatten jener Eichen beschloß ich, keinen Tag länger in der Gegend zu verbleiben, sondern wieder dem geistigen Leben der Hauptstadt zuzueilen. Da hastete keuchend ein Mädchen durch das Dickicht heran, wild aufgeregt, mit zerfetzten Kleidern, blutenden Gliedern und angstglühenden Augen. Ein junges, kaum erwachsenes, schönes, merkwürdiges Mädchen, Aladar! – Vor meinen Füßen ist es zu Boden gestürzt, hat mich angefleht um meinen Schutz. Es war seiner Schönheit willen verfolgt von Jägern, eingeschlossen von dem Kreise der Treiber. – Das Kind hat seine Noth noch kaum in Worte gefaßt, so durchbrechen Pferde das Gestrüppe, zwei Reiter sprengen lachend auf das Mädchen zu; einer davon ist mein Gutsherr.[S. 122] Ich erraffe mein Doppelgewehr: „Hat solches Wild Vater Nimrod gejagt? Ihr Buben, wollt Ihr’s wagen, das Kind ist in meiner Hut!“ – Lachend ritten sie davon, aber ich sah es wohl, wie mein Gutsherr in stiller Wuth erblaßt war. Das Mädchen geleitete ich in sein Haus; es war sehr armer Leute Kind, das jeden Tag in den Wald ging, um wilde Früchte zu sammeln. Ich sah die Gefahren, die von diesem Tage ab doppelt über dem schönen Wesen schweben würden, und ich beschloß, es zu schützen. Allein noch an demselben Abend ließ mich mein edler Gönner und Gastherr in ein Gemach führen, das nur von außen zu schließen ist. Es war gar fest und sicher eingewölbt und das Fensterchen kräftigst vergittert; aber der Blick meiner Augen flog doch hinaus, und über der Hofmauer dämmerte der Bergwald herein – der Bergwald, in dem die Klause der armen Leute stand. Ich bin aber nicht lange in dieser Kammer gesessen. Die Zeit, mein Junge, war das Jahr des Heiles. Der Aufruhr wogte auch in das Bergthal hinein und da hat sich gewaltig viel Zündstoff gefunden. Die Vasallen, sonst feig und blöde wie eine Heerde von Mauleseln, wurden wach und verstanden die Stunde. Menschenmassen versammelten sich um das Schloß und ein langer hagerer Mann rief: „Mach’ uns auf, Du übermüthiger Schloßherr, in Deinem Hause ist unser gutes Recht vergraben, das wollen wir uns holen!“ Da flog ein Schuß aus des Magnaten Fenster und streckte den drohenden Waldmenschen nieder. Dieser Schuß hat dem Gutsherrn Schloß und Schlag gekostet. Das Gebäude wird gestürmt, bald brennt es an allen Enden, und der Gutsherr, für sein Leben zitternd, sucht ein sicheres Gewahrsam, stürzt in mein Kerkergewölbe und schutzflehend mir zu Füßen. – „Was steigst Du in den Kerker, in den Du mich geworfen[S. 123] hast!“ rufe ich bebend; „weißt Du es wohl, warum Du mich gefangen hältst, und weißt Du, Tyrann, vor wem Du liegst? Vor dem Sohne des Mannes, den Du mißhandelt! Heute giebt das Volk den Streich zurück!“ – „Erbarmen!“ stöhnte er, „Emanuel, vielleicht fleht in diesem Augenblicke Dein leiblicher Vater Dich an um sein Leben –“
„Ich habe den Mann vor der wüthenden Rotte beschützt; es gelang mir, ihn auf kurze Zeit in Sicherheit zu bringen. Bald aber ist er dem Zorne seiner sich selbst befreienden Unterthanen erlegen. – Ich habe in jenen Tagen nicht geruht, habe mitgerungen den wilden Befreiungskampf, der empörenden Unthaten gedenkend, die meinem Volke waren angethan worden. Das erste Opfer dieses Kampfes, der durch des Gutsherrn Kugel hingestreckte Mann war Nella’s Vater gewesen. Nella, freilich, so hat sie geheißen, die ich im Walde ihren Verfolgern entrissen. Nella – mein Sohn, Du kennst ihr Bild, es steht in unserem Hause und ist jene Büste, die ich Dir bisher Eos genannt habe. Nella ist mein Weib geworden.“
„Fast zur selben Zeit aber wird der Aufstand durch Schwert und Strick gebändigt und den Aufrührern werden lichte Pfähle zum Denkmal gesetzt. Mir hat es mein Gewissen laut genug gesagt, was ich gethan, ich habe für mein Volk gestritten. Wäre ich los und ledig gewesen, ich hätte mich ja hingestellt meinen Blutrichtern: „Da habt Ihr mich, Ihr Menschenschänder, mordet mich hin, wie Ihr Tausende gewürgt habt; ich bin ein redlicher Kämpfer meines guten Rechtes!“ – Aber ein geliebtes Weib an der Seite, bin ich geflohen. Ueber die Landesgrenze konnten wir nicht; wir wären verloren gewesen. Doch es hat auch brave Magnaten im Ungarlande gegeben. Ich sage das von dem Manne an der Theiß nicht,[S. 124] weil er uns in seine Burg nahm und beschützte, das that er vielleicht dem Künstler zuliebe, den er in mir verehrte. Ich sage das von jenem Manne, weil er den Geist der Zeit verstanden und ihm Rechnung getragen hat. Dieser Magnat hat seine Leibeigenen freigelassen vor den Tagen der Gewalt; so haben die Leute freiwillig sein Haus und sein Leben beschützt vor den wilden Stürmen der Revolution. – Ein Jahr lang haben wir unter fremden Namen in seinem Hause gewohnt. Hier hatte Nella Gelegenheit, ihren eigenen Geist zu bilden, auf daß er ihrem großen Frauenherzen ebenbürtig wurde. Ich habe in dieser Zeit unserem Schirmer aus Dankbarkeit ein Marmorbildniß gestaltet, von dem der gute Mann so entzückt war, daß er mich bittend zwang, eine Summe anzunehmen, die mir die Sorge für die Zukunft meiner Familie mit einemmale löste. Freilich kam rasch eine andere größere Sorge auf mich angestürmt. Unser Schützer starb an einem Herzleiden, und wir waren obdachlos. Und wir waren mitten im Lande, das mich in Acht und Bann gelegt hatte. – O, mein geliebtes Kind! der heißeste Vatersegen vermag es nicht, des Lebens allumfassendes Ungemach von Deinem Haupte zu scheuchen, aber niemals möge ein Tag Dir kommen, an dem Du heimatlos mit einer jungen Gattin die Menschen meiden mußt und friedlos Nächten und Wüsten entgegenfliehest, um für die zermarterten Glieder eine kurze Ruhestatt zu finden!“
Der alte Mann beugte tief sein Haupt und die schneeweißen Brauen seiner Augen wogten auf und nieder.
Der Wald war gar hoch und finster geworden. Die beiden Menschen schritten rasch. Auf Aladar’s Antlitz hatten während der Erzählung Gluthröthe und Marmorblässe gewechselt. Jetzt preßte er die Lippen fest aneinander. Plötzlich[S. 125] aber stand er still und rief in erregtem Tone: „Vater, laß meine Eltern nicht so lange in der Noth!“
„In Bettlerlappen gehüllt, sind wir gegen den Untergang der Sonne gezogen,“ fuhr der Greis fort, „sind endlich in das grüne Bergland gekommen, dessen Alpenkronen den Satzungen der Menschen nicht unterthan sind, in dessen sangeslebendigen Wäldern blutdürstige Bannflüche spurlos verhallen. – Wir sind frei gewesen. Im Kreise des ewigen Menschenrechtes sind wir leichten und frohen Gemüthes langsam weiter gezogen, um in den deutschen Landen eine bleibende Stätte zu suchen. – Siehe, mein Sohn, nun lichtet sich der Wald; wir sind im Thale und vor uns liegt das Dorf mit den friedlich rauchenden Schornsteinen.“
„So ist es auch an jenem Abende gelegen, als ich und meine Gattin – das liebe treue Weib – des steinigen Weges gegangen kamen. Vor Freuden haben ihre schönen süßen Augen geweint, als sie zu dieser Stunde die traulich umfriedeten Menschenwohnungen gesehen. Allein, als wir durch die Dorfgasse schritten, da sind an den Häusern alle Thüren zugegangen. Ja, ich glaube es, die Bettlerlappen! Aber ich habe mein Schärflein wohl gewahrt gehabt an der linken Brust, unter einem häßlichen Filzpflaster. Und auf meinen Ruf, daß wir getreulich Alles bezahlen wollten, hat uns das Wirthshaus des Ortes aufgenommen. Und nun war es in derselbigen Nacht –“
Die Stimme des Alten wurde tonlos, wollte versagen. Tüchtig räuspern mußte er sich, dann schlug er mit beiden Armen in die Luft hinein und rief: „Ei, geh, das ist albern; hätt’s längst schon verwunden gehabt! – In derselbigen Nacht, da – ja, Freuden, Freuden hat’s gegeben! – Ein Kind hat mir mein Weib geboren. – – O, Du armer,[S. 126] armer Knabe, daß Du das Mutterherz nicht hast empfunden in Deinen Kindestagen! All’ die Liebe und Freude und Sorge und Sehnsucht und Treue des Vaters ist nimmer im Stande, das Mutterherz zu ersetzen. Am Tage Deiner Geburt ist Deine Mutter gestorben. – Komm, Junge, wir wollen an dem Kirchhofe nicht vorübergehen; Du weißt ja den Hügel unter dem Ginster.“
Sie traten in den kleinen Friedhof, schritten still zwischen den armen Holzkreuzen hin, einer grauen Statue zu, die im Dunkel eines Strauches ragte. Diese Marmorstatue stach ganz wundersam ab von den stümperhaften und abgeschmackten Darstellungen des Gekreuzigten, der „Schmerzhaften“, und Insonderheit von den bildlichen Menschengerippen mit Stundenglas und Hippe, wie sie auf dem Kirchhofe zu sehen waren.
Die Marmorstatue stellte eine Frauengestalt dar, die in ernstem Sinnen an einer Urne stand, die linke Hand leicht an die Stirn legte und mit der rechten eine gesenkte Fackel hielt. Ein schönes Ebenmaß lag in dem Bilde, man fühlte Beruhigung und Frieden, wenn man es betrachtete.
Als sie vor der Statue standen, ergriff der Greis des Jünglings Hand und sagte: „Hier, Aladar, habe ich Deine Mutter begraben.“
Und nach einer Weile banger, schmerzlicher Stille brach der Bildner in den Ruf aus: „O, du göttliches Volk der Hellenen! Du hast deine Todten der heiligen Flamme gegeben und ihr Aschenschnee hat deine Wohnungen zu Tempeln geweiht. Uns Heilverlassene fesselt die Liebe an eine Erdscholle und unsere Herzen müssen zu des Gedächtnisses Feier niedersteigen in die Grauen der Gräberfäulniß. – – Vielleicht, mein Junge, habe ich an Dir gefehlt, daß ich Dich einer städtischen Bildung entzogen; aber es ist mir unmöglich ge[S. 127]wesen, dieses Grab zu verlassen. Ich war noch nicht an die vierzig Jahre, und dennoch, mein Schicksal ist erfüllt gewesen. Meine ganze Welt lag in diesem umwaldeten Thale. Dort oben auf der Bergeshöhe kaufte ich ein Stück Erde und baute das Haus. Das Waldland ist Deine Wiege geworden, mein Kind, der Frieden der Berge hat Dich gehütet, Dein einsamer Vater hat das wenige Gute, das in ihm selber zu finden, in Dich gelegt. Ich hoffe, Du hast nichts verloren dadurch, daß Dir die Welt, oder was sie so heißen, bisher fremd geblieben. An der Kunst erfreut sich Deine junge Seele, so wie die meine noch; und können wir unsere Ideen hier auch nicht in Marmor gießen, so hauen wir unseren Olymp aus den Stämmen des Tanns und meißeln unsere Götter aus dem weißen Holze der Linde. – Ueber ein Kurzes, und meine Zeit wird ja erfüllt sein. Und ist sie erfüllt, dann mein Kind bette mich hier an die Seite Deiner Mutter. Vergiß es nicht, Aladar, und lasse mir das zum Troste sein. Das Menschengemüth siegt über die Schrecken des Todes und in dem Gedanken der Vereinigung läßt sich’s freudig sterben. Und hast Du mich begraben, so verkaufe das Haus auf der Bergeshöhe und ziehe mit Deiner jungen frischen Kraft in die Welt. Ziehe nicht gegen Mitternacht, dort herrscht die kalte herztödtende Vernünftelei; ziehe nicht gegen Abend, dort waltet die schale Phrase und die stolze Ichsucht. – Ziehe gegen den sonnigen Mittag hin und küsse mir den Boden der Hellenen.“ – –
Diese feierliche Stunde ist aber auf eine recht widerliche Weise unterbrochen worden.
Es lag schon das Abendroth auf dem Marmorbilde, welches das Grab unter dem Ginster hütete. Der alte Mann wendete sich zum Gehen.
Eine Magd trieb drei meckernde Ziegen heran und gerade dem Kirchhofsthore zu. Als Aladar sah, daß die Thiere Miene machten, in den heiligen Garten zu trippeln, stellte er sich sofort vor den Eingang.
„Weg davor!“ rief die Magd, „wirst aber gleich weggehen, Du vertrackter Bub’, Du!“
„Was wollt Ihr denn?“ sagte Aladar, „die Ziegen gehören nicht auf den Gottesacker.“
Da hub die Magd gewaltig an zu keifen, und bald eilte aus dem nahen Pfarrhause ein junges kugelrundes Frauchen herbei; das stemmte seine Arme in die Seiten und konnte gar possirlich schwatzen. – „Du Lotterbub!“ rief sie hell, „die Gaisen laß durch, hörst Du?“
„Nein,“ sagte Aladar gelassen, „die Gaisen laß’ ich nicht durch, und sollte ich bis zum jüngsten Tag da stehen müssen. Ich habe ein Grab in diesem Garten und habe das Recht, dasselbe vor Entweihung zu schützen.“
„O du nichtsnutzig Volk!“ schrie das Frauchen, „ansonsten sind sie Heidenkerle über und über, verlästern die Mutter Gottes ihrer heiligen sieben Schwerter wegen, schnitzen Weibsbilder, rein wie sie Gott erschuf –“
Ueber ihre eigene Wendung erschrocken, hielt sie inne.
„Ja wohl,“ lachte der Jüngling, „wie sie Gott erschaffen in der Schöne und in der Unschuld.“
„Ei ja, spott’ nur zu: Du kannst lange spotten, bis Du unserm lieben Herrgott ein Ohr abspottest. Euch ist schon gar nichts heilig, als etwan der schwarz’ Bub’ mit den Hörnern. Wollt’ aber einmal so ein unschuldig Zickel da drin ein paar Halme nagen, gleich fiele Euch der Himmel ein. Ja, der Herrgott ist um eine Klafterlänge barmherziger als so ein hergelaufen Gesindel, der läßt auch im Kirchhof[S. 129] Futter wachsen. Für wen denn? Fressen die Todten Gras? Gut, Du Neidhammel, so laß es den Ziegen, und trotz’ nicht und mach’ Dich fein bald auf die Socken, Du Vagabund, Du!“
Der Greis hatte sich bei dieser Angelegenheit jeglichen Wortes enthalten. Nun hielt es auch Aladar für überflüssig, noch einmal den Mund aufzuthun. Er verscheuchte die Thiere, schlug das hölzerne Thor zu und nahm den Schlüssel mit sich. Das Frauchen zeterte noch, daß es im ganzen Dorfe nachklang.
Der Bildner suchte den Kirchensteff, um ihm den Schlüssel zu übermitteln. Er fand den Strohlockenkopf in der Futterkammer seiner Stallung, unweit der Kuhmagd, und zwar in einem Zustande, der sich nicht ganz zu jener Entrüstung reimen wollte, die den Steff gestern abgehalten, bei der capitolinischen Venus Platz zu nehmen. Die Beiden, der Steff und die Magd, führten nämlich in dieser Verborgenheit ein behend Tänzchen auf, zu welchem der Brunnen draußen den Takt plätscherte. Das eben ist das Mißliche bei den Mitgliedern der Aloisiusbruderschaft, daß sie öffentlich kein Tänzchen und kein Küßchen halten dürfen.
„Der Freithofschlüssel ist das?“ stotterte der Bauernbursche nun vor dem Alten, „ja, dann muß ich ihn aber gleich der Pfarrerköchin schicken, sie kunnt ja die Gaisen nicht unterbringen über Nacht, und der Ziegenstall ist noch nicht fertig.“
Als unsere Bildner wieder durch den abendlichen Wald hinaufgingen, sagte der Greis zum Jüngling:
„Was meinst Du, mein Junge, wirst Du noch einmal den Anwalt der Todten spielen?“
„Das werde ich,“ versetzte Aladar trotzig.
„Du Schwärmer, ich will Dir ein Wort sagen.“
„So sage es.“
Der Alte blieb stehen und sagte gelassen: „Der Lebende hat Recht.“
*
**
Das Frohnleichnamsfest war pomphaft abgehalten worden. Die Gemeinde war mit Fahnen und Kränzen durch das Thal gezogen; der Weihrauch stieg empor und verschwamm in dem Sonnenäther des Morgens. Weiße Jungfrauen trugen das dicht verschleierte Bild der „Schmerzhaften“ mit den Schwertern. Kerzenlichter flimmerten und zwei Glöcklein begleiteten den Zug. Der Kirchenvater hatte einen rothen Mantel um und trug mit noch drei anderen ehrenhaften Männern den „Himmel“, unter welchem der Priester ging. Der Steff trug die Aloisiusfahne und seine Augen schlug er fromm zum Himmel auf oder züchtig zur Erde nieder.
Der alte Eman stand auf dem Söller seines Hauses und blickte in das Thal und auf den Gottesdienst unter freiem Himmel. Er hörte die Glöcklein, er sah das Flimmern der Lichter.
„Wohl,“ lispelte er, „die Trophäe des Prometheus tragen sie auch mit sich. Noch lebt ein Funken der Lichtsehnsucht unter den Menschen.“
Aladar hatte den kirchlichen Auszug von der Nähe besehen, als er nach Hause kam, war er kleinlaut und schwermüthig.
„Du bist ergriffen, Aladar,“ bemerkte der Alte, „ja, es liegt etwas unendlich Rührendes in dem Gedanken, wie heiß die Menschen aller Länder in ihrer Art nach dem Reiche Gottes ringen.“
Aber der Jüngling wendete sich ab und schwieg. Und sein sonst so freundlich offenes Gesicht war betrübt.
Das blieb tagelang so, und Meister Eman kam schon auf den Gedanken, es sei in seines Sohnes Herz jener Funken gefahren, der ewiglich aus Eros’ Fackel sprüht, alle Jugend durchlodert und die Welt vor Erstarrniß wahrt.
Aber es war etwas Anderes, und seines Jungen Schwermuth sollte der Alte auch an sich selbst erfahren. Eines Tages, als Eman wieder das Grab seines Weibes besuchte, fand er die Marmorstatue zertrümmert. Jedes der Stücke, die auf den Hügel lagen, trug die Spur einer gewaltsamen Zerstörung. Eman fragte nicht, wer es gethan. Er wankte nach Hause, that einen Blick nach der Büste der Eos, stieg empor die Treppe, setzte sich auf den sonnigen Söller und starrte hinaus in die Himmelsweite.
In seiner Werkstatt hatte er von diesem Tage ab nichts mehr angerührt. Helios’ schönes, kunstreich vollendetes Haupt ragte fast dämonenhaft aus dem starren Holzklotze; kein Schnitt wurde an dem Bilde mehr gethan. Der alte Mann saß, selbst eine Bildsäule geworden, auf dem Söller und blickte unverwandt in den lichten Sommer hinaus. Er war im Herzen getroffen.
Aladar war Tag und Nacht bei seinem kranken Vater. Einmal hatte er es versucht, ihn zu trösten, da lächelte der alte Mann und sagte: „Des Menschen Werk wird vergehen, aber sein Ideal lebt. Und es lebt die Treue. Laß mich, mein Kind, das Auge noch im Lichte weiden, ehe es in den Schatten des Grabes vermodert.“
Als in den nahen Tannen die reinen Lüfte des Herbstes zu rieseln begannen, war der alte Eman in dem Tempel seines Hauses entschlummert.
Aladar, der schöne Jüngling mit dem stolzen freundlichen Lockenhaupte, stand vor dem Schläfer und ließ sein[S. 132] umschattetes Auge ruhen auf dem lieben alten Antlitze, das die Silbersträhne des Haares und des Bartes ehrwürdig umrankten. Das war ein freundliches Bild, die Furchen der Stirn waren völlig geglättet, auf den schmalen Wangen lag ein mildes Weiß und auf den Lippen lag die Güte und das Lächeln des Entschlummernden versteinert.
Aladar umarmte den Todten und küßte mit Innigkeit das Angesicht. Dann ließ er ihn auf dem wohlverwahrten Söller sitzen, das Antlitz nach dem Aufgange der Sonne gewendet.
Und dann verschloß er das Haus. Im Freien stand er still und blickte rings um sich. War das sein heiteres Heimatsthal? Nein, das war die kalte Fremde.
Zum Dorfe stieg er hinab und im Pfarrhofe klopfte er an.
Das Frauchen ließ ihn unzähligemal klopfen und war gar außerordentlich vergnügt, daß es jenen verweigerten Eingang in den Kirchhofsgarten an diesem Thore vergelten konnte. Endlich kam der Pfarrer selbst, um zu öffnen.
Aladar berichtete den Tod seines Vaters und bat den Pfarrer, das Grab für den Verstorbenen an der Seite jenes seiner Gattin bereiten lassen zu wollen.
„Lieber junger Herr,“ entgegnete der Seelsorger, „selbst der beste Christ kann bei uns die Stelle seines Grabes nicht wählen; wir begraben die Leute nach der Reihe.“
„Irre ich nicht, Hochwürden, so ist in dieser Zeit die Reihe ungefähr am Grabe meiner vor sechzehn Jahren hier verstorbenen Mutter. Der Todtengräber hat mir gesagt, daß der Kreis auf dem Kirchhof von sechzehn zu sechzehn Jahren vollendet wird. Der Preissatz wird für beide Gräber sofort bezahlt werden.“
Der Pfarrer ging langsam die Stube auf und ab und barg seine Hände in den Taschen seines Taffet-Talars.
„Es ist gar sehr die Frage, junger Mann,“ entgegnete er nun, „ob es überhaupt statthaft ist, Ihren Vater in unserem katholischen Friedhofe zu begraben. Wie stand es mit seiner Religion?“
„Ich kann den Taufschein aufweisen,“ sagte Aladar.
„Ei jerum!“ machte der Pfarrer, „auf den Taufschein kommt es nicht an; einen solchen hat der Luther auch gehabt. Es sind ganz andere Bedenken. Ihr Vater hat lange Jahre in unserer Gemeinde gelebt; ist er aber jemals in der Kirche gesehen worden? Hat er nicht mit unseren altehrwürdigen Bildnissen gehadert? Hat er nicht zum Aerger der ganzen Gemeinde eine stockheidnische Darstellung mitten in unseren Kirchhof gesetzt? Und sein Haus dort oben, ist es nicht ein wahrer Götzentempel voll gottloser unzüchtiger Bildnisse? Der Künstler hat sein Talent von Gott; wehe Dem, der es zu Gottes Schmach mißbraucht!“
„Mein Vater hat sein Künstleramt gewissenhaft erfüllt!“ versetzte Aladar mit Nachdruck.
„Leider hat er diesen frevelnden Stolz bewahrt,“ entgegnete der Priester mit leiser Stimme und blieb vor dem jungen Manne stehen; „Verirrungen sind menschlich, und Gott, der ein verlorenes Schaf mit Schmerzen sucht, hat Ihrem Vater durch eine wochenlange Krankheit reichliche Gelegenheit zur Bekehrung und Buße gegeben. Hat er die Gnadenzeit benutzt? Hat er auch nur ein einzigmal die Tröstungen der Religion verlangt? In vorsätzlicher Unbußfertigkeit ist er gestorben.“
„Herr!“ unterbrach hier Aladar, aber er kämpfte seine Aufwallung nieder.
„Junger Mann,“ sagte der Pfarrer, „rufen Sie Ihr „Herr“ auf der Gasse, wo Ihresgleichen ziehen. Im Pfarrhofe haben Sie Ehrerbietung zu beobachten. Verstehen Sie mich?“
„Ich bitte um Verzeihung, Hochwürden, aber die Vorwürfe, die Sie gegen meinen Vater schleudern, sind sehr ungerecht; er war ein Ehrenmann. Auch er hat Ehrerbietung zu fordern.“
Der Seelsorger schwieg einen Augenblick, dann sagte er etwas gedämpft: „Mag sein, darüber wird Gott im Himmel richten. Was aber das Begräbniß Ihres Vaters anbelangt, so thut es mir leid, Ihnen mittheilen zu müssen, daß die Kirche einem solchen Mann ihren Segen und die geweihte Erde nicht gewähren kann.“
Aladar erblaßte.
„Und Sie wollen meinem Vater ein Grab auf dem Kirchhof verweigern?“ sagte er fast tonlos.
Der Priester zuckte die Achseln:
„Ich verweigere es nicht, ich bin ein Diener der Kirche. Und die Kirche kann einen Menschen, der so weit entfernt war, der Unsere zu sein, der so böses Aergerniß gegeben – sie kann schon aus Rücksicht für die Gemeinde einen solchen Menschen nicht in die Gemeinschaft der Christgläubigen aufnehmen.“
„Und wissen Sie, daß mein Vater, als er sein Weib hier begraben hatte, auf die Welt, auf ihre Güter und Ehren, auf die Künstlerlaufbahn verzichtete, in dieser Gegend verblieb, Entbehrung, Schmach und Kränkung in aller Weise erduldete, nur um den Grabhügel seiner Gattin zu hüten und dereinst an ihrer Seite ruhen zu können? Aber nein, Ihr wißt ja nicht, was Gattenliebe heißt, was Herzenstreue bedeutet –“
Diese unüberlegte Aeußerung traf.
„Jetzt hab’ ich genug!“ rief der Geistliche mit dunkelrothem Gesicht, „lästern Sie den Satan! Wir sind fertig und der Todte wird hinter der Kirchhofsmauer begraben.“
„Das wird er nicht, mein Herr!“ sagte Aladar und legte seine rechte Hand auf die Brust.
Ruhigen Schrittes verließ er den Pfarrhof. Durch das Küchenfenster grinste ein volles Gesichtchen heraus und ahmte das Meckern einer Ziege nach.
Zur selben Stunde läuteten die Kirchenglocken, sie läuteten alle vier, sie läuteten lange. Es waren Todtenklänge; ein reicher Bauer der Gemeinde war verschieden.
Aladar schritt in den Kirchhof. Der Kirchenvater und sein Sohn, der strohlockige Steff, arbeiteten am Ginsterstrauch und gruben ein Grab. Sie gruben es nicht für den fremden Mann, der oben im fremden Hause verschieden war; sie gruben es für den reichen Bauern.
Aladar blieb entsetzt stehen und starrte auf die Arbeiter hin. Sie gruben in den Grabhügel seiner Mutter ein. Schon wollte er hinstürzen und ihnen den Spaten aus der Hand reißen, da besann er sich: „Ei, sie haben ja Recht, sie sind an der Reihe. Das Weib, das sie vor sechzehn Jahren zur ewigen Ruhe bestattet, hat nur zur Miethe hier gewohnt. Die Zeit ist aus, die Schaufel klopft an....“
Er trat an das Grab heran und blickte hinab. – Moder des Sarges, fahle Lappen, Knochen, Haarlocken – Jüngling, das war ein grauenhafter Anblick, der hat dir das lieblich schöne Bild der Mutter, wie es dir dein Vater in der Erzählung und in dem Bildnisse der Eos als Erbe hinterlassen, ganz und gar zerstört. Das Grab wurde durchwühlt, die Gebeine herausgeworfen auf den Rasen. Aladar[S. 136] erfaßte das Knochenhaupt mit beiden Händen und seine thränenschweren Augen starrten in die tiefen Höhlen.
So hat das Kind seine Mutter zum erstenmal gesehen. – –
Als Aladar zu seinem Hause zurückkam, stand der Todtenbeschauer vor der Thür. Er beschaute kopfschüttelnd den ehrwürdig schönen Greis, der auf dem Söller saß, und er beschaute die vielen Bildnisse in der Werkstatt und er beschaute das Haus.
„Werden Sie hier verbleiben?“ fragte er den Jüngling.
„Ich werde nicht hier verbleiben,“ war die Antwort.
„So werden Sie das Haus und diese Statuen verkaufen?“
Aladar sann, dann entgegnete er: „Das weiß ich nicht.“
Der Dorfarzt stand noch eine Weile da, dann zuckte er die Achseln und ging davon.
Und als Aladar wieder allein war, ging er auf den Söller und setzte sich zu seinem todten Vater. Fast so regungslos wie dieser saß er da und richtete sein Auge in die weite blaue Himmelsglocke hinaus. Es war so still und mild. Das Laub der gegenüberstehenden Eiche wollte schon ein wenig gilben. In der Luft spannen die Fäden des Herbstes. Ein einzigesmal läutete eine Waldbiene vorbei, dann war es wieder still. Gegen Abend hob sich unten aus dem Gebüsche ein hellrothes Flämmchen, es flackerte und schwamm empor gegen den Söller und hin über das Haus.
Ein verspäteter Aurorafalter war es gewesen.
Als auf der fernen Felsenhöhe, die hinter den Wäldern hervorleuchtete, die Gluth der Abendsonne verlosch, stand Aladar auf, erfaßte die kalte blasse Hand seines Vaters und sagte: „Sie wollen Dir das Grab an der Mutter Seite[S. 137] verweigern. Aber Dein Kind wird Dich verstehen und die Treue erfüllen.“
Als der Mond aufging, stieg Aladar nieder zum Dorfe und ging in den Friedhof hinein. Er ging zwischen den Kreuzen hin bis an die finsterstarrende Grube. Auf dem thaufrischen Rasen lagen noch die Knochen. Der Jüngling hub sie auf, schlug sie in ein Tuch und trug sie davon.
Am Thore schritt ein Mann vorüber, der hielt ihn an: „Was tragt Ihr da?“
„Einen Auferstandenen.“
Der Mann schauerte und eilte weiter.
Aladar stieg mit seiner seltsamen Last langsam den Berg hinan. Auf der Höhe leuchtete das Haus im Mondenscheine.
*
**
Am anderen Tage war ein völliger Feiertag im Dorfe. Die Kirche war in Trauer gehüllt. Stille Messen und laute Gebete wechselten ab und am Nachmittag rüstete sich Alles zum Begräbnisse.
Der verstorbene Bauer war ein sehr angesehener Mann gewesen, und in seinem Testamente stand ein Satz, der seiner christlichen Gesinnung wegen dem Pfarrer so gefiel, und dessentwillen er schon eine ganze Stunde vor dem Begräbnisse wieder alle Glocken läuten ließ. Die Kirche konnte ja doch wohl füglich klagen, sie gehörte mit zu den Erben.
Der Arzt des Ortes stand auf der Gasse und plauderte mit dem Kirchenvater. Beide waren gar ernsthaft und in würdiger Trauerkleidung.
„Hätten auch den alten Kauz da oben in den Kirchhof tragen lassen können,“ sagte der Arzt, gegen das Haus auf der Bergeshöhe weisend. „Der Mann war mehr Narr als[S. 138] Heide. Und auch sein Sohn tritt in die Fußstapfen des Alten. Der hat mir gestern gesagt, daß er fortziehen will. Gut, mag es thun, das ist die Narrheit nicht. Bin heute wieder bei ihm gewesen: ob er sein Haus verkaufe. – Nachbar, wie hoch schätzest Du dieses Haus?“
„Den Heidentempel!“ versetzte der Kirchenvater, „wer kann ihn denn brauchen? Ich achte das ganze Holz, das darin steckt, auf zwei Kohlenmeiler; das sind kaum hundert Gulden.“
„Da habe ich allerdings anders gerechnet,“ entgegnete der Arzt, „mir gefällt der Bau, es ist Geschmack daran und die Holzschnitzereien sind nicht ohne Werth. Ich habe dem Burschen eine Tausendernote dafür geboten.“
„Bader, Du bist ein Narr!“
„So ist dieser Junge ein noch größerer,“ rief der Arzt, – „verzehnfacht die Summe, hat er gesagt, und dann kommt und ich werde Euch dafür das Haus meines Vaters noch nicht verkaufen.“
Der Kirchenvater lachte laut auf, und das hatte sich schier nicht geschickt, denn es nahte schon der Leichenzug.
Die Menschen der ganzen Gegend waren beisammen, es wurde fast der Kirchhof zu klein. Die Windlichter flackerten hell in die Abenddämmerung hinein. Drei Priester im Ornat standen an dem Grabe und schwangen Sprengwedel und Weihrauchgefäße.
„Morgen kommt der Jude dran, oder was er ist,“ flüsterte ein Weib der Nachbarin zu, „hast Du die Grube hinter der Mauer schon gesehen?“
Die Antwort wurde abgeschnitten durch das Rollen des Sarges, der in die Tiefe glitt. Der Sarg war bunt bemalt. Jetzt gossen sie Weihwasser darauf hinab, da die Thränen[S. 139] mangelten. Der Verstorbene hatte weder Weib noch Kind hinterlassen; und fremde Erben weinen nicht. Der Pfarrer nahm die Schaufel, streute Erde hinab und rief in seiner todten Sprache die Worte:
„Ruhe Deiner Asche!“
Der Spruch war einem Anderen nachgerufen.
In demselben Augenblicke ging ein Getöse durch die Menge und Feuerrufe wurden laut. An der Wand des Kirchthurmes und auf den Dächern der Häuser lag ein mattzitternder Schein. Das Haus auf der Bergeshöhe stand in Flammen.
Die Leute drängten aus dem Gottesacker; an der finsteren Grube gab es nun für sie nichts mehr zu thun und zu schauen. Einsam steht der Sarg im tiefen Grabe, der Verwesung harrend, die nun naht mit ihrem jahrelangen Grauen.
Durch die hell erleuchteten Dorfgassen wogten die Menschen; einige eilten den Berg hinan.
Das Haus auf der Höhe war zu einer herrlichen Flammensäule geworden; senkrecht stieg sie in den Abendhimmel auf und die anstrebenden Funken schienen sich mit den Sternen des Himmels zu vereinen.
Aladar stand unter der Eiche und sah dem brennenden Hause zu. Seine Seele loderte vor Begeisterung mit den Flammen um die Wette.
Ein halb Stündlein früher war es gewesen, da hatte Aladar den brennenden Span in eine Spalte der Heliosstatue gesteckt. Er hatte gesehen, wie die glühende Zunge aufflackerte zu dem Bilde des Lichtgottes, wie die hellen Flüglein emporflatterten zu den übrigen Kunstgestalten und an der Wand hin, mit Begier wachsend und sprühend. Bald war die Werkstatt zu einem Flammentempel geworden und nur einzelne[S. 140] Häupter der hellenischen Mythe ragten aus dem wogenden Feuerbrodem. Gar bald brachen die Flammen zu den Fenstern heraus und flutheten die sonnengebrannte Holzwand hinan und züngelten gegen die Erker des Söllers. Das Feuer krachte, brüllte, durchbrandete das Haus nach allen Ecken hin, und von allen Seiten kam es nun mit wilder Gewalt gegen den Söller gebrochen, wo der alte todte Mann saß, wo vor dem Bildnisse der Eos ein Häufchen Friedhofsknochen lag. Aladar blickte durch Rauch und Flammen noch hin auf des Vaters Angesicht. Mit einer blühenden Röthe hatte dieses des Feuers Widerschein übergossen. Da sprühten von dem Haupte des Todten plötzlich Strahlen aus – wie Regenbogenstrahlen – und es loderten die Locken, ein Gluthmantel schleuderte sich über den Leichnam, über den Söller, über das ganze Haus.
Wie versteinert, aber mit leuchtenden Augen stand der Jüngling unter der Eiche und sah den Opfertisch seines Erbes in unbeschreiblicher Herrlichkeit verlodern.
Leute aus dem Dorfe waren herangeschlichen, aber als sie den Leichnam verbrennen, als sie im rothen Scheine die Bildsäule unter dem Baume sahen, da zogen sie sich mit Entsetzen zurück.
Als der Mond aufging, war das Haus auf der Höhe bereits in sich zusammengebrochen. Aus den einstürzenden Bränden sprühten noch die Funkenschwärme, entfachte sich noch ein letztes Aufleuchten, und als der Morgen dämmerte und dort auf den Wipfeln des Tanns die Vögel zwitscherten, war Alles und auch der letzte Strunk zu Asche verzehrt.
Aladar suchte am Rande der Brandstätte, wo der Söller niedergebrochen war, nach Knochen. Er fand keine. Der Morgenwind fachte und wirbelte in der weißen Asche und trug manches[S. 141] Stäubchen hin über die Häupter der Tannen zum Aether empor.
Und als die Sonne aufging, blickte Aladar noch einmal in die Runde des Waldlandes, in das Wiesenthal mit den Weidenbüschen und dem Dörfchen. Und noch einmal richtete er sein überthautes Auge auf die Aschenstätte – dann wendete er sich und zog davon.
Er zog durch schattige Wälder, er zog über Berg und Thal, er zog über Meere. Er zog gegen den sonnigen Mittag, um den Boden der Hellenen zu küssen.

Zwei Untergäuer.

An der Thorschranke, wo das Untergäu aufhört und das Obergäu beginnt, standen zwei wunderliche Gesellen. Der eine war ein behäbiger schrötiger Mann, der bis an die stämmigen blaubestrumpften Waden hinab einen grünen Rock trug und eine ziegelrothe Weste anhatte, an welcher mitten herab wohl über dreißig haselnußgroße Silberknöpfe funkelten. Um den Bauch spannte sich ein breiter Ledergurt, in welchem mit weißem Geschnüre allerlei Zierat und die zwei Worte „hohe Weid“ gestickt waren.
Unter dem niederen, aber breitdachigen Hut des Mannes hingen Strähne schon ein wenig grauender Locken über den steifen Rockkragen; die Nase sprang wie ein mächtiger Keil aus der derben Stirn herab, die sorgfältig rasirten Backen standen kräftig vor; alle Züge waren rauh, aber ausdrucksvoll, etwa wie die Gesichtsformen eines Marmorbildes, bevor sie der Künstler glättet.
Der zweite Geselle war ein schwarzer, etwa vierjähriger Stier mit massigen Gliedern, einem ungeheueren Haupte, an dessen beiden Ecken zwei kurze Hörnchen hervorstanden. Um[S. 143] diese Hörner war ein Strick geschlungen, den der Mann mehrfach um seine rechte Hand gewunden hatte, während die Linke einen tüchtigen Haselstock hielt.
So standen sie da und sahen einander an. Die großen pechschwarzen Augen des Stieres glotzten voll Trotz, die ungeheueren Nüstern pusteten stoßweise. Der Mann streichelte dem Rinde den steifen Nacken und die mächtige Fahne, die von dem Unterkinn bis zum Brustblatt zurückging; „sei gescheidt, Schwarzer, sei gescheidt und geh,“ sagte er gelassen, während er bei sich murmelte: „Hätte ich dich nur erst daheim in meinem Hof, du stetiges Rindvieh, ich wollt’ dich schon lehren, wer dein Herr ist!“
Aber als er nun den Strick anzog und mit dem Stock sachte an des Thieres Hinterbeine klopfte, um doch endlich durch die Wegschranke zu kommen, da zog der Stier sein Haupt ein und stieß ein dumpfes Gebrüll aus.
Auf diese Aeußerung verhielt sich der Mann wieder eine Weile ruhig, knirschte aber vor Zorn mit den Zähnen; eine solche Widerspenstigkeit war er nicht gewohnt. Er sah aber auch die Gefahr ein, die ein wildgewordener Stier bringen kann. So blickte er rathlos in die Runde.
Nichts als Heidekraut, Erlsträuche und Föhrenbäume.
Als jedoch die Beiden eine lange Weile vor der Wegschranke so gestanden waren, da kam die Richtung aus dem Untergäu ein Bursche des Weges. Die Kleidung desselben war ärmlich, aus blaugefärbter Grobleinwand; über den rothbraunen Locken trug er eine bunt gestreifte Zipfelmütze. Das runde Gesicht war noch bartlos, aber stark geröthet. Das Haupt tief nach vorn gesenkt, so daß die Zipfelmütze gerade emporstand, die beiden Hände in den Hosentaschen, so schlenderte der Bursche heran.
„He, Du!“ rief ihm der Mann im grünen Rocke zu, „geh’ her, hilf’ mir den Stier treiben!“
Der Zipfelmützenkopf hob sich empor.
Wer ist denn Der, daß er einem Fremden auf der Straße so mir nichts dir nichts Befehle giebt? Ich habe meines Wissens keinen Herrn, nunmehr gar keinen. – Na, der Bauer von der hohen Weid! Ei, das ist was Anderes, der ist der reichste und angesehenste Mann im ganzen Gäu, und der höchste obendrein, denn der Hochweidhof steht auf dem Rochusberg und blickt hoch über alle Dachgiebel und über Berg und Thal hin in’s Land. So ein Mann kann freilich auf allen Wegen und Stegen sein herrisch „Geh’ her! pack’ an!“ sagen.
„Ja,“ rief nun der Bursche, „ich will schon helfen.“ Er brach einen Weidenzweig. „Mit dem Stock wird das Vieh nur wild, Hochweidhofer.“
Nun der Stier sah, es wären ihrer Zwei, änderte er sein Verhalten, ging ruhig durch die Thorschranke und zwischen den beiden Männern behäbig einher.
„Bist Du vom obern Gäu, daß Du mich kennst?“ fragte jetzt der Bauer.
„Nein,“ antwortete der Bursche, „den Hochweidhofer kennt man auch im untern Gäu.“
Da schmunzelte der Andere. Der Bauer von der hohen Weid war eigentlich ein Großhirt. An Feldfrüchten nur spärlich Halme wuchsen auf den Höhen des Rochusberges; aber ein paar hundert Stück Vieh hatten jahraus jahrein ihr gutes Fortkommen auf den fetten Weiden und sonnigen Almen. Nur wurde es, rein wirthschaftlich genommen – und der Hochweidhofer nahm es immer so – zuweilen nothwendig, daß Blut aus den unteren Gegenden in das Rindvieh kam,[S. 145] und darum war der Bauer auch heute herabgestiegen, um einen gesunden und kräftigen Zuchtstier heimzuführen. Er hatte einen solchen im Thale gekauft und dabei geglaubt, es würde auch so ein Rind vor dem Hochweidhofer etwas mehr Respect haben, als vor anderen Leuten; jedoch der Stier bedeutete nur zu bald, daß er weder auf Geld, noch auf Rang sehe; er benahm sich sehr störrig, und als sie an die Wegschranke kamen, die den untern Gäu von dem obern trennt, weigerte sich der Schwarze, wie wir sahen, entschieden, sein Vaterland zu verlassen.
Nun der Zweite da war, folgte er willig und den Bauern wurmte es nicht wenig, daß das Thier sich erst durch die Gegenwart eines stockfremden Jungen veranlaßt fand, zu gehorchen.
„Wo willst Du eigentlich hin und was willst Du verrichten?“ fragte der Bauer den neuen Gefährten.
„Ich helf’ dem Hochweidhofer den Stier treiben,“ war die Antwort.
Jener sah den Burschen näher an. Ein Junge von siebzehn oder achtzehn Jahren, gut gewachsen, frischen Aussehens, mit ein paar großen, nußbraunen Augen, die fest und treuherzig blickten; vielleicht verwahrlost ein wenig, aber sonst kein übler Bursche.
„Bist Du ein Knecht von irgendwo?“ fragte ihn der Bauer.
„Ich bin Herr.“
„Also ein Grundbesitzer?“
„Der Herr über mich selber.“
Der Bauer sah ihn noch fester an. Ist das Trotz, oder will er hänseln? Troll Dich davon, Du! wollte der Mann schon losfahren, aber er sah ein, er bedurfte des[S. 146] Jungen. Es war dem Herrischen nicht gar behaglich in Gesellschaft der beiden Trotzköpfe.
„Du – wie muß man Dich heißen?“ sagte der Mann vom Rochusberge.
„Melchior.“
„Und – Dein Schreibname?“
„Der gilt nichts mehr.“
„Jetzt möchte ich aber wissen, wo Du daheim bist!“
Ein wenig schwieg der Bursche auf diesen fast gebieterischen Ausruf. „Ist das schon das obere Gäu?“ fragte er hierauf.
„Seit der Schranke her.“
„So bin ich im obern Gäu daheim.“
Der Bauer wollte jetzt stillstehen, aber der Stier erlaubte es nicht, trottete seinen gleichen Schritt.
„Mich däucht, Du bist ein Vagabund!“ rief der Hochweidhofer dem Burschen zu.
„Mich däucht auch,“ war die Antwort. Hierauf fuhr der Nirgendsdaheim mit seiner Hand streichelnd über den Rücken des Thieres, über den ein hellgrauer Streifen ging. „Der Schwarze wird weiß,“ sagte er halblaut, „ist er nur erst ein Ochse geworden.“
„Ja, verstehst Du denn vom Vieh was?“
Das Gespräch wurde unterbrochen. Zwei Gerichtsdiener mit bespießten Gewehren führten einen jungen Mann vom Berge herab und an unseren Dreien vorüber. Der Gefangene war in guter und geschmackvoller Gebirgstracht und eine schwere, silberne Uhrkette gängelte an der Weste. Die Arme hielt er über der Brust gekreuzt, durch ein Stahlkettchen aneinander geschlossen. Den grünen Hut, auf welchem keck Gemsbart und Hahnenfedern prangten, hatte er vorn schier[S. 147] bis zur Nase herabgedrückt; das Gesicht war etwas blaß und hatte ein leichtes Schnurrbärtchen.
Der Gefangene hatte bei der Begegnung seinen Kopf sogleich beiseite gewendet, aber Melchior war stehen geblieben, hatte ihn angestarrt, bis er vorüber war. Ein wunderliches Gröhlen stieß der Bursche aus, dann stand er noch eine Weile still und blickte der Gruppe nach.
„Der Forstadjunct Kilian, kennst Du ihn?“ sprach der Hochweidhofer.
Der Bursche nickte mit dem Haupte, auf seinem Gesichte spielten Todtenblässe und Dunkelröthe.
„Der hat sich sicherlich ein paar schwere Rehböcke zu Schulden kommen lassen,“ meinte der Bauer, „war aber sonst ein ordentlicher Mensch.“
„O du verfluchtes, o du vermaledeites Geld!“ stöhnte der Melchior, dann ging er wieder hinter dem Stiere her und sagte kein Wort mehr, was der Bauer vom Rochusberge auch fragen mochte.
So waren sie einige Stunden mitsammen gegangen, waren durch Gesträuche und Wälder gekommen und endlich auf einer Hochblöße angelangt, von der aus man den ersten freien Blick in’s Land hatte. Die Gegend ist zumeist Wald- und Haideland; nur selten steht an den sonnigen Hängen oder in den Wiesenthälern ein Haus, dann aber liegt ein Kornäckerchen und ein Krautgarten dabei. Der Blick geht so weit, bis die Waldhöhen blau werden und endlich an sonnigen Tagen die Berge und die Wölklein nicht mehr von einander zu unterscheiden sind.
„Sooh, mein Schwarzer!“ rief der Hochweidhofer gedehnt, „wir sind daheim! das ist schon meine Wiese – wenn’s gefällig!“
Der Stier ließ sich’s nicht zweimal sagen und hub an zu grasen.
„Halte den Strick dieweilen!“ sagte der Bauer zum Burschen, dann zog er eine große, rothlederne Brieftasche hervor, faltete sie langsam auseinander, blätterte in den Banknoten, während er in halb singendem, höhnischem Tone folgende Sprache führte: „Nu, wollen sehen – mein vornehmer Herr Stromer, was sich findet –; sollst dem Bauer von der hohen Weid – nicht umsonst – nachgelaufen sein –.“
„Nachgelaufen bin ich nicht!“ sagte der Melchior.
„Je, nur nicht gleich so hitzig, Junge! – sollst es nicht umsonst gethan haben – wird morgen zwar – vertrunken – verspielt sein. – Nichtsnutzig Volk, das! – Lauft am hellen Werktag in der Lunger herum – stiehlt dem Herrgott seinen Tag. – Seh, da hast, das gehört Dein, Du Vagabund Du!“
Er hatte sich schon lange den Berg heran gefreut, wie er, des Burschen nicht mehr bedürftig, seine Meinung würde sagen können. Nun war’s heraus; aber auch eine noch nagelneue Zweiguldennote war heraus: „Seh, das gehört Dein!“
Der Bursche hatte dem Bauer gleichgiltig zugehört, ihn aber mißtrauisch angesehen. Als er nun die Banknote vor sich flattern sah, wendete er sich hastig weg und rief: „Nein, ich rühr’s nicht an, mein Lebtag nicht. Mein heiliger Gott wird mich hüten.“
Der Mann von der hohen Weid stutzte. „Nun, ist es vielleicht zu wenig?“
„Ich sag’ vergelt’s Gott!“ sagte darauf der junge Mann, „aber Geld nehm’ ich nicht. – Hunger hätt’ ich!“
„Ei, das ist was Anderes. ’s ist keine halbe Stunde mehr bis zu meinem Haus, komm halt mit, und jetzt mach Dein Geld weg!“ Des Bauers Stimme war ein weniges milder geworden.
„Habt Ihr’s denn nicht gesehen, wie sie ihn davon getrieben?“ hastete der Bursche heraus, „ich nehm’s nicht! bei meiner Seel, ich nehm’s nicht!“
„Also, Du Bettelbub,“ versetzte der Bauer und stemmte seine Arme in die Seiten und streckte seinen Hals vor: „Du willst dem Hochweidhofer ein Almosen geben?“
Jetzt haschte der Andere nach der Geldnote und mit bebenden Händen zerfetzte er sie in viele Stücke.
Der Bauer starrte wunderlich drein und sagte kein Wort. Als er hierauf den Strick wieder in die Hand nahm, murmelte er: „Ja, wenn es so mit ihm steht, dann ist er freilich ein armer Teufel!“ Hierauf hob er seine Stimme zum Befehl: „Du kommst mit!“
Falsches Geld.
Der Hof auf der hohen Weid ist eine Almerei im Großen. Die silberweißen Schindeldächer des vielfältigen Gebäudes leuchten weit hinaus in die Gegend, sie sind von keinem Schutzbaume beschattet, sie liegen frei in einer sonnseitigen Mulde des Rochusberges. Im Hofe giebt es Schellengeklingel, Rindergebrüll und Ziegengeblök zu allen Tageszeiten. Wenn auch im Sommer große Heerden auf dem Hochboden und den Hinteralmen weiden, in Gegenden, die noch ein gut Stück höher liegen, als der Hof, so sind auch in diesem immer noch Kühe, Ochsen, Ziegen, Schafe und Schweine zur[S. 150] Genüge vorhanden, und ein prickelnder Duft, wie er zum Entsetzen der Recensenten häufig in Dorfgeschichten zu spüren sein soll, verleiht der großen Almwirthschaft erst den rechten Nimbus. Ein zahlreiches Gesinde, theils schläfrig, theils lustig, ist dem Viehstande beigemengt. Hinkende und bekropfte Schafhirten, alte, träge Ochsenwarte, aber auch flinke und ewig jodelnde Käserinnen, Buttermädchen, stets barfuß und hochgeschürzt und stets mit ihren Kühen und Kalben plaudernd, weil ihnen das Mannsvolk zu langweilig. Schuhe und Strümpfe tragen zur Sommerszeit nur die Großbäuerin und der Bauer und ihre zwei Söhne. Diese zwei Söhne sind junges, lustiges Blut; aber der Aeltere war so hoffärtig, daß er in die Stadt studiren ging; und der Jüngere ist seiner Schulzeit noch so nahe, daß er kaum erst den Katechismus wieder vergessen hat. Er beschäftigt sich viel mit Forellenfischen und Spatzenfangen, reitet den Ziegenbock, neckt die alten Kühe, bis sie ausschlagen, und ist somit dem Weibervolke auf der hohen Weid ein Gräuel.
Kein Wunder, die Langweile auf so einem Almhof, an dem keine Straße vorüberführt, auf dem man des Jahres außer den Viehhändlern kaum drei Fremde sieht. Gar kein Wunder, daß an diesem Tage, von dem wir erzählen, eine gewisse Stimmung des Hangens und Erwartens auf den Gemüthern lag. Der Stier kommt! Gestern ist der Bauer in das Untergäu gegangen, heute, längstens bis zum Nachmittagsbrot kommt der neue „Jodel“.
Die Stalldirnen fegten alle Spinnweben von den Winkeln, den Kehricht vor den Thüren weg, striegelten die Rinder glatt und sauber, und die Oberkäserin ging mit dem Gedanken um, zu Ehren des Ankömmlings einen Schottenkuchen zu beizen, der so groß wäre, wie ein Melkzuber.
Endlich, zur Stunde, als die Giebel des Gehöftes schon lange Schatten legten über die frischgemähte Wiese hinab, erhob sich eine lebhafte Bewegung, und Alles rief oder flüsterte: „Er kommt!“
Dröhnend und mit heftig hin- und herschlagender Halsfahne trottete der Stier raschen Schrittes in den Hof. Daß der Bauer mit dabei war, verstand sich von selber, aber daß auch noch ein Anderer – – ein junger, hübscher Bursche, manierlich über und über! – Mit der Zunge hat er geschnalzt, als sie zum Thore hereinkamen. Jetzt hält er den Stier an den Hörnern, während der Bauer Anordnungen trifft. Will sich’s aber nicht recht gefallen lassen, der Schwarze, schnaubt und pustert und plötzlich macht er einen Sprung. „Laß aus, laß aus!“ rief man dem Burschen zu, aber dieser läßt nicht ab von den Hörnern, wird mit fortgeschleift. Das Weibervolk kreischt auf, ruft den Namen Jesu an; da läßt der Bursche mit der Rechten los, ballt sie zur Faust und versetzt dem wilden Rinde einen Schlag hinter dem Auge. Der Schlag war weit zu hören, der Stier stand still, wendete langsam das Haupt; es war ihm nicht wohlgemuth. Sie standen wieder ruhig beisammen. Das Heer der Knechte nahte. Die Butter-Toni war gar ein weichherzig Mägdlein, die wäre für ihr Leben gern dem jungen Menschen zugesprungen, um ihn zu fragen, ob er sich wohl nirgends weh gethan; aber ihre Scheu vor dem Schwarzen war doch zu groß. Erst als der Stier in seinem Stalle war, kam sie mit Nadel und Zwirn herbeigerannt, um dem Fremdling das Beinkleid zu schlichten, das am Knie einen großen Riß bekommen hatte. Der so freundlich erwartete Stier aus dem untern Gäu hatte die Zuneigung der Bewohnerschaft von der hohen Weid verscherzt; hingegen war dieselbe im vollen Maße dem[S. 152] tapfern Fremden zugefallen, der nun in die Gesindestube geführt wurde, wo ihm der Hausvater reichlich zu essen auftragen ließ.
Durch die Thürfugen, durch die Fenster guckten die Mägde in die Stube, um den jungen Mann sitzen und essen zu sehen, bis der Bauer plötzlich den Ruf that: „Sakra! heißt das arbeiten?“ Da zogen sich die Augen zurück.
Jetzt ging die Thür auf, ein langer, hagerer Mann trat ein und sagte mit heiserer Stimme: „Glück herein, Unglück hinaus, der Herrgott beschütze dieses Haus!“
„Dank’ schön, dank’ schön,“ versetzte der Hochweidhofer und wendete seinen Kopf zum Fenster hinaus. Den alten Hirtengruß hörte er gern, aber den Mann, der ihn jetzt gesprochen hatte, mochte er nicht recht leiden.
Der Eintretende sah aber auch nicht just danach aus. Er hatte mattgraue Tuchkleider am Leibe, die aber schon recht abgetragen und an allen Enden zu kurz und schlottrig waren. Der obere Theil der Gestalt war stark nach links geneigt, so daß der dünne, schlanke Mann aussah wie ein geknickter Zaunpfahl. Die rechte Achsel war emporgezogen und auf derselben lehnte der kleine Kopf, der mit seiner niedern, breiten Stirn und dem scharfspitzigen Kinn eine dreieckige Form hatte. In diesem Dreiecke waren für’s Erste zwei wassergraue schielende Aeuglein, eine scharfe, aber zu kurz gerathene Nase mit weiten Nüstern, und ein erklecklich breiter Mund, an dem die Oberzähne so weit hervorstanden, daß sich die Unterlippe bequem hinter denselben bergen konnte. Zuckend hob der Mann den Arm, um seine braune Pelzmütze abzuziehen, denn artig war der Remini Dreihand immer, und die braune Pelzmütze trug er auch immer; diese war so zu formen, daß sie entweder ein Sonnendächelchen[S. 153] für das Auge, oder zur Winterszeit ein paar Schutzlappen für die Ohren gab.
So schlich der Remini nun durch die Stube, auf den Bauer zu, legte diesem eine Hand auf die Achsel und sagte gedämpft, aber hastig: „Hochweider! Hochweider! ’s ist schauderlich – ’s ist gar zum Närrischwerden!“
„Was denn?“
„Ach, ’s ist schauderlich! – Meine Mutter, wenn sie das gewußt, richtig, sie hätt’ mich mitgeschickt in die neue Welt hinüber. Und jetzt – Hochweider! – ist mir da in der alten herüben das passirt, Das, und mir! mir, dem guten, armen Remini, der ohnehin nicht weiß, wovon er leben soll in seinen alten Tagen –“
„Ei, geh mir!“ unterbrach ihn der Bauer, „Du bist das alte Klageweib, heut, wie immer, Du hast zu leben genug.“
Der geknickte Zaunpfahl schwieg einen Augenblick. Dann kramte er mit zitternder Hast in seiner Brusttasche. – „Hochweider,“ hub er wieder an und wickelte einen neuen Zehnguldenschein hervor, „Hochweider, hast schon einen falschen Zehner gesehen? – Nicht? – nu, da kann ich aufwarten; – ist nett gemacht, nicht wahr? – nett, fein –“; dann brach er los: „Fünf schwere Thaler hab ich ihm dafür gegeben, dem Lumpen, dem Schurken! – Und ich verliere mein gutes Geld, der Wisch ist falsch! Schau einmal, Hochweider, was das für ein Wasserdruck ist; mit Sauschmer ist er gemacht. – Aber heut’ haben sie den Fuchs aus dem Loch gezogen; weiß der Himmel, wie lange er’s schon getrieben!“
„Ja, wer denn? wer denn?“ rief der Bauer, „das ist ja ein ganz verrücktes Schwätzen!“
„Den Herrn Forstadjuncten Kilian Ehrlich haben heut’ die Schandarm’ abgeholt. Hochweider, einen Falschmünzer[S. 154] haben wir mitten unter uns gehabt. Aber ich sag’s, wenn er gehenkt wird, da laß ich mir was kosten, da muß ich dabei sein. Na ja, jetzt weiß man, wo die vielen nagelneuen Banknoten herkommen. Schau nach, Hochweider, ’leicht hast Du auch ein paar in Deinem Sack.“
Der Bauer fuhr gegen seine rothe Brieftasche, ließ sie aber im Rock stecken und murmelte: „Ich nicht. Der Bauer von der hohen Weid kennt sein Geld.“
Gut so, der Mann von der hohen Weid giebt sich nie eine Blöße, am wenigsten noch vor einem Menschen, wie dieser Remini Dreihand. Der Geizhals soll nicht die Freude haben, den Großmann des Berges auf der Stelle um ein paar Dutzend Gulden ärmer werden zu sehen.
Erst als der Geknickte mit weinerlichem Gesichte seine falsche Banknote mit derselben Sorgfalt wieder eingesteckt hatte, als wäre sie eine echte gewesen, und als er hierauf klagend wieder davongeschlottert war, ging der Bauer in die Stubenecke, in welcher neben dem letzten Fenster der braune Uhrkasten stand, und sichtete seine Banknoten. „Sakra, sakra!“ rief er plötzlich, „eine ganze Kuh ist hin! Fünf falsche Zehner!“
In zwei Minuten darauf war er wieder der Alte, schritt langsam gegen den Tisch und rief: „Nun, Herr Landstreicher, schmeckt’s nicht?“
Der Melchior hatte Messer und Gabel längst aus der Hand gelegt. Schon der falsche Zehner des Remini Dreihand hatte ihm den Appetit verdorben. Seitdem war er bewegungslos und blaß dagesessen.
„Gott vergelt es, ich bin satt,“ sagte er und stand auf, „aber ich wollt fragen, Bauer, könnt Ihr mich in Euren Dienst nehmen?“
Der Hochweidhofer maß den Burschen vom Kopf bis zum Fuß, und zwar mit einer hochfahrenden Kälte, als wäre er ein alter Recrutenrevisor. – Gefällt mir übrigens von Dir! – tauglich! wollte er schon sagen, anstatt dessen entgegnete er langsam und trocken: „Der Bauer auf der hohen Weid nimmt Keinen in seinen Dienst, den er nicht so gut kennt, wie seinen Thürstock da, Keinen!“
„Mein Tauf- und Heimatschein liegt beim Müller im Untergäu,“ sagte der Andere, „ich bin die Zeit her beim Müller gewesen.“
„Wird beim Müller im Untergäu das Dienstjahr zu Jakobi aus?“ fragte der Bauer scharf.
„Beim Müller nicht, aber bei mir,“ antwortete der Bursche, „der Müller hat mich an der Ehre beleidigt, da bin ich ihm davongegangen. Ich bin ein ehrlicher Mensch, und wenn Ihr mich aufnehmt, Bauer, so mögt Ihr mir die schwersten Arbeiten schaffen, mögt mich scharf behandeln wie Ihr wollt, aber das merkt Euch, ich bin ein ehrlicher Mensch!“
Mit gehobener Stimme, fast drohend waren diese Worte gesprochen worden; der Sprecher hatte dabei die Fäuste geballt.
„Hm, hm,“ meinte der Bauer kleinlaut, „das laß ich ja wohl gelten. Mußt ihn nicht gleich so aufnehmen, meinen Landstreicher.“
„Der bin ich auch, und bin es so lang’, bis ich Arbeit gefunden hab’. Zum Müller bringen mich vier Rösser nicht mehr zurück.“
Der Hochweidhofer ging langsam in der Stube auf und ab und hielt die Hände am Rücken. Er trat fest auf, daß die Dielen knarrten. Dieser fremde Junge wollte Recht behalten vor ihm, dem Mann von der hohen Weid! Konnte[S. 156] er so Einen in seinem Hause dulden? Aber der Mensch schien einen Kern in sich zu haben; und lauter Hundsfötter im Gesinde, das thut auch kein gut.
„Weißt Du was, Melchior,“ sagte der Bauer und blieb vor dem Burschen stehen, „wir machen dieweilen noch nichts aus. Bleib’ Du ein paar Tage auf der hohen Weid. Gefall’ ich Dir und gefällst Du mir, dann spannen wir auf weiteres an. – Ist Dir das recht, so paß jetzt auf. Du und der neue Stier, Ihr seid zwei Bekannte, Du sollst den Schwarzen heut’ noch auf die Hinteralm führen. Der kleine Bub wird Dir treiben. Bei dem Sennermägdle auf der Hinteralm wirst Du über Nacht bleiben. Morgen wirst Du den Stier an die Heerde lassen und so lang dabei bleiben, bis Du siehst, er ist angewohnt. Nachher kommst wieder heim.“
Kommst wieder heim! Das Wort hat dem Melchior wohlgethan.
Das Andenken in der Zipfelmütze und das Sennermägdle.
Der Schwarze hatte dieweilen auch sein Willkommbrot genossen. Als hierauf die kleine Karawane gerüstet war, schoß noch die flinke Butter-Toni herbei und steckte dem Melchior kichernd ein weißes Päckchen in die Hand. Seine Zipfelmütze war’s, die er bereits vermißt hatte; sie war vorhin im Kampfe mit dem Rind in den Wust gefallen und mußte gewaschen werden. Als sie der Bursche nun über den Kopf ziehen wollte, fand er ganz hinten im Zipfel ein schwammiges Dingelchen. Was kann denn da drin stecken? Ein niedliches Lebkuchenherz und ein papiernes Bildchen darauf, und auf dem Bildchen ein goldenes Körblein, und im Körblein ein Nest von rothen Rosen und in den rothen[S. 157] Rosen ein Liebespärchen, das sich die Hand reicht, und darüber die Worte gedruckt:
Da wollte sich des Burschen Gesicht schier zu einem Lächeln ziehen; er blickte um sich, sah kein Mägdlein, hörte aber Kichern im Gestalle.
Der kleine Bub, der als Treiber ging, war gewiß noch nicht zehn Jahre alt, aber er hatte einen so großen Filzhut auf dem Haupte, daß er das kleine Gesicht sehr hoch empor halten mußte, wollte er aus der ungeheueren Krempe hervor den schwarzen Stier und den blauen Knecht mit der Zipfelmütze noch sehen.
So zogen sie die Höhe hinan, über die Steinhalden und Grasblößen dahin, die schönen Matten des Hochboden entlang bis gegen die Hütten der Hinteralm. Der Kleine war Wegweiser. Sie hatten unterwegs manchen Strauß zu bestehen.
Dort und da waren in einem Schocke Rinder beisammen, die sich sehr für den vorüberziehenden Blutsfreund interessirten. Der Schwarze selbst wollte mit den Standesgenossen anbinden, und besonders, wo er Kühe und Kalben wahrnahm, da wollte er zu ihnen, oder er war kaum vom Flecke zu bringen. Die kräftige Hand Melchior’s gehörte dazu, um ihn zu bändigen, und der kleine Junge schlug stets einen solchen Lärm sowohl mit seiner Riemenpeitsche als auch mit seiner hellen Stimme, daß das Rindvieh ordentlich Respect davor bekam.
Endlich sahen sie die Hütte, aus welcher dünner Rauch in die Abendluft aufstieg und in welcher Melchior bei dem Sennermägdle übernachten sollte.
Es wurde dem Burschen ganz seltsam auf dieser Höhe; da war’s so still, so weit, so frei. Seine Glieder waren munter, sein Herz war andächtig und übermüthig zugleich.
Vor der Hütte weideten einige Schweinchen; am Brunnen trank eine betagte Kuh, im Hollerstrauch daneben schäkerten ein paar Ziegen. Die Hüttenthür war offen, aber die untere Hälfte derselben war durch einen Gadern gesperrt, auf daß die vorerwähnten Thiere nicht freien Eintritt hatten in die menschliche Behausung, in welcher das Sennermägdle wirthete.
Der Melchior lugte schon von weitem auf die Thür. Er sah innerhalb derselben in der Dunkelheit und dem Rauch des Herdfeuers eine Gestalt stehen, die gemächlich den Stab eines Butterrührkübels auf- und niederzog und dabei ein Pfeifchen schmauchte. Das Gesicht war runzelig und gar verdorrt, die kurzgeschorenen Haare waren dünn und grau. Die Dreie nun bemerkend, ließ diese Gestalt den Rührstab ruhen und machte einen langen Hals, der rechtschaffen gebräunt und an dem die Adern wie ein Knäuel rauher Stricke ineinandergingen.
„Gelt, Nickerl, es wohnen mehr Leute in der Hütten als Einer?“ fragte Melchior den Knaben.
„Nein,“ antwortete dieser.
„Wer ist denn nachher das, was dort Butter rührt?“
„Das ist das Sennermägdle.“
Der Bursche schwieg, that aber einen so heftigen Ruck an dem Strick, daß ihn der Schwarze fragend anglotzte, was er doch schon wieder mißgangen haben könne?
„Mägdle, der neue Stier ist da!“ rief der Nickerl. Da kam denn die Gestalt mit den kurzgeschorenen Haaren und dem Tabakspfeifchen sofort herangetrippelt, und ihr Anzug, ein grauer, schwarzgestreifter Wiflingkittel mit der gleichfarbigen[S. 159] Schürze und dem einmal blau gewesenen Busentuch ließ keinen Zweifel mehr übrig: es war ein Weib, es war das Sennermägdle.
Der Stier wurde in eine bereitete Klause gethan und mit Bocksbart und Süßklee gefüttert. Der Nickerl war wieder davongehüpft, und man hörte ihn über die Almen hinaus lange noch lärmen; der Kleine suchte die Gespenster, vor welchen er sich in der Nacht fürchtete, durch helles Geschrei zu vertreiben.
Der Melchior saß völlig schwermüthig vor dem dürftigen Herd, auf welchem ihm das „Mägdle“ das Abendbrot kochte. Als sie die „Mehlspatzen“, die sehr fett waren, verzehrt hatten, ging die Alte den Burschen an um ein Pfeifchen Tabak.
„Weibel,“ entgegnete Melchior treuherzig, „ich hab’ meiner Tag nicht geraucht.“ Er redete weiters nicht viel, aber Eines ging ihm nicht aus dem Sinn; das Ding war auch ganz unerklärlich, es war gar nicht zu lachen darüber, es war geradezu ein Unding, ein neues Unding in seiner Welt. Das kleine Köpflein sah ja schier kahl und gerupft aus. Er war sonst nicht neugierig, aber nun that er doch den Mund auf: „Ist es des Herdfeuers wegen, daß Ihr Euch die Haare habt schneiden lassen?“
„Was brauch ich denn die Fetzen!“ fuhr sie ihn an; bald aber setzte sie, wie selbstgefällig, grinsend bei: „Ich verkaufe mein Haar!“
„Verkaufen!“
Der Melchior war von seinem umgestülpten Milchzuber aufgesprungen. „Geld und wieder Geld!“ rief er, und im Munde kaute er die Worte herum: „Herr je, was muß die nicht schon Alles verkauft haben, wenn die paar armseligen Haarweben nicht mehr sicher sind auf ihrem Schädel!“
„Wie sagst?“ fragte die Alte.
„Ist schon recht,“ sagte der Bursche.
„Mein Gott, wo nähm’ unsereins sonst das Tabakgeld?“
„Ist schon wieder recht!“ rief der Melchior, „Sennin, ich möcht schlafen gehen!“
Auf dem Dachgeschoß der Klause, in welcher der Stier seine Nachtruhe hielt, lag frisches Heu; da hinein warf sich der Bursche aus dem Untergäu und streckte die Glieder weit von sich.
Geld! im Untergäu das Gift, im Obergäu das Gift – überall! – Mich bringst du nicht um, ich bin ehrlich, so steht’s in meinem Taufschein – und ich will’s verbleiben. Du kleines Ledertäschlein da, von meinem Pathen hab’ ich dich, für Geld wärest du gemacht. Nicht einen Pfennig kriegst mir hinein. Wart einmal, sollst nicht leer bleiben – sollst es gut haben – so!
Das Lebzeltenherz steckte er in den Geldbeutel. Dann barg er diesen tief in seinen Hosensack, dehnte sich noch einmal im weichen Heu und schlief ein.
Das Gegröhle der Schweine war es am andern Morgen, das unsern Melchior zu dem herrlichsten Alpensommertag erweckte. Der Bursche hatte nur einige Rispenhälmchen aus seinen Hosen und Haupthaaren wegzuzupfen, dann war er angekleidet und herausgeputzt. Kaltes Brunnenwasser goß er sich noch in das Gesicht und eine warme Molkensuppe in den Magen, dann war er bereit.
Er ging mit der Heerde auf die Weide. Es waren lustige Kühe und flinke Kalben da, und der Schwarze war Lebemann. Melchior sah es gleich, daß sich der Untergäuer hier nicht langweilen werde; er hätte denn sofort in das Gehöfte zurückkehren können. Allein auf der sonnigen Matte[S. 161] war es so wohlig zu liegen, die Augen zu schließen und dem Glockengeschelle zuzuhören. Er that’s und dachte dabei an das Lebkuchenherz, das er in seiner Geldtasche trug, dachte an die kleine Magd, die ihm das Ding zugesteckt hatte. Sie hatte ein kurzes rothes Kittelchen an und gelbe Haare auf dem Kopfe, das war Alles, was er von ihr wußte. Und es war genug, häufig genug. Er riß die Augen auf und sah in die Heerde hinein.
Dort nicht weit stand ein Wassertrog, der war aus Föhrenholz, es klebte noch die dicke, gefurchte Rinde daran. Melchior ging zum Troge, trat mit der Schuhferse ein Stück Rinde davon und begann mit seinem Taschenmesser an diesem Stücke zu schnitzen.
Er schnitzte, murmelte, pfiff, sang dabei Schelmenlieder aus dem Untergäu. Und endlich war das Ding fertig. Er hub es mit der rechten Hand ein paar Schuh weit von sich in die Luft hinaus, drückte ein Auge zu und mit dem andern lugte er so d’rauf hin. Gut gerathen war’s, ein Vögelchen spitzte die Stoßfedern, hob das Köpfchen, sperrte das Schnäbelchen auf. Ja, so schnitzen aus Föhrenrinden, das hat er schon als Knabe gelernt, das bringt Keiner so zu weg, wie der Melchior. Aber die kleine Magd mit dem gelben Haar, wird sie ihn schließlich nicht gar ausspotten, daß er ihr für das nette Lebkuchenherz nichts zu bieten weiß, als so ein hölzernes Dingelchen da? Sie kichert und lacht so gern, das hat er schon gesehen... Sie soll aber nicht kichern und lachen über ein Andenken, das ihr Melchior giebt, sie soll sehen, wie tief in’s Herz hinein ihn ihr Lebkuchen gefreut hat, sie soll merken, wie er das Lebkuchenherz verstanden hat, sie soll wissen –
Was nur soll sie wissen?
Der Melchior hat an seiner Halsschnur ein messing Marienbildchen und ein silbernes Ringlein hängen. Das Marienbildchen hat er von seiner Mutter – Gott schenk’ ihr die himmlische Freud’. Das Ringlein hat er von einem frommen Kapuziner, der einmal mit einer großen Blechbüchse in’s Haus gekommen ist und dem die Mutter um Gotteswillen einen schweren Klumpen Rindschmalz in die Blechbüchse gelegt hat. Der Pater hatte mancherlei Schätze bei sich und aus Dankbarkeit für den Klumpen steckte er dem Knaben ein funkelndes Silberringlein an den Finger. Der Finger war bald zu groß gewachsen, da kam der Ring an die Halsschnur.
Der Melchior dachte daran, nahm seinen geschnitzten Vogel wieder zur Hand und schlitzte ihm den Bauch auf. Eine tiefe Spalte nämlich schnitt er in das hölzerne Thier; dann that er das Ringlein von der Schnur, rieb es ein Weilchen an der blauen Leinwandhose, bis es in der Sonne wie Gold funkelte, that es dann in den Spalt und verklebte diesen sorgsam mit Splitterchen.
„Jetzt, Rothkröpfel, ist auch ein Herz in dir!“ rief er lustig, „jetzt bist schon recht für die Rothkitteldirn!“
That das Vöglein in seinen Hosensack, rief der grasenden und scherzenden Heerde zu: „Viel Glück auf der Hinteralm und stoßt euch kein Hörndel ab und – das Sennermägdle, das laß’ ich von weitem schön grüßen!“ und ging davon.
Ueber die stundenlange Schneide des Rochusberges ging er hinaus.
Hier auf der Höhe – wo ihm nicht der geizige und nergelnde Müller mit seinem ewigen Brummen und Befehlen zur Seite war, wo er seine schlanken Beine einmal fest und sicher in den Boden setzen, seine hohe Brust einmal ordentlich[S. 163] hervorkehren, sein Haupt einmal keck in die Höhe heben konnte, wo er seinen klaren Augenblick einmal trotzig, lebensfreudig in’s Weite schießen lassen wollte, wo jeder Athemstoß ein Jauchzen wurde – machte er Halt. „Es ist Platz für mich, und wenn ich einmal doppelt werde, Platz genug!“ – da hätte man’s sehen können, was der ganze Bursche für ein prächtiger Kerl war.
Das dünne, weiche Leinenkleid that nichts dagegen, daß man seinen drallen, echt älplermäßigen Gliederbau durchaus kennen lernen konnte; zudem stand zu vermuthen, daß der Melchior gar kein Hemd anhatte. Die Hände hielt er stets in den Hosentaschen; in der rechten hielt er das Beutelchen mit dem Lebkuchenherz, in der linken den Vogel. So schlenderte er fürbaß und der weißrothe Haubenzipfel schlug am Nacken bei jedem Schritte wie ein Pendel hin und her.
Je näher der Bursche aber gegen den Hochweidhof kam, desto mehr verging ihm die Lustigkeit. Unter den Menschen war er wieder der arme Schelm. Und vielleicht hat es der Bauer schon erfahren, weß Stammes und Namens er, der Melchior, ist und wird ihn gleich aus dem Hause weisen. Die Menschen gehen alle nach dem Schein, alle! Der Bauer von der hohen Weid, sagt man zwar, der gehe schnurgerade der Nase nach und dem Kern zuleibe. Dann freilich wär’s gewonnen. – Heute oder morgen muß der Melchior doch den Mund aufmachen, will er auf der hohen Weid verbleiben. Heute ist’s besser als morgen.
„Nu, Melchi, wie steht’s auf der Alm?“ fragte der Bauer sogleich, als der Bursche vor sein Auge trat.
„Könnt’ gar nicht besser stehen,“ antwortete der Melchior.
„Was schafft das Sennermägdle?“
„Nicht einmal scheu ist er worden,“ sagte der Bursche.
„Wer?“
„Der Stier.“
„Vor wem?“
„Vor der alten Vettel.“
Jetzt that der Bauer einen ganz gewaltigen Lacher. „Bist ein rechter Sakra, Du!“ rief er, dem Burschen die flache Hand auf die Achsel werfend, „ein Höllsakra übereinand! Und nun schau, daß Dir die Bäuerin Dein Mittagsmahl giebt, die Leut’ haben schon abgegessen. – Hast denn noch was auszurichten?“
„Bauer,“ sagte nun der Untergäuer stockend, „meine Mutter hat fort gesagt, wenn das Herz voll ist, so hat im Magen nichts Platz. Mir gefällt’s schon auf der hohen Weid und ich möcht was reden mit Euch, aber ganz allein.“
„Mit mir was reden willst? Lug einmal, Junggesell, seit wir Zwei uns kennen, giebst Du mir ja einen Befehl um den andern! Willst Du was reden, so hast mich fein zu fragen, ob ich was hören will. Nu, für ein andermal. Kannst jetzt mit mir gehen.“
Er führte den Burschen über eine Stiege in eine rückseitige Kammer empor. Hier hingen, lehnten und lagen allerlei Werkzeuge, Messer, Hacken, Sägen, Feilen, Bohrer und andere Dinge, deren Zweck gar nicht zu errathen war. Des Bauers Werkstatt, in der er die Halsjöcher seiner Ochsen zimmerte, die Melkzuber und Milchbutten band, die Haarstriegel schärfte, die Messer schliff, mit denen den Rindern die Hörner und die Klauen beschnitten wurden, und allerlei andere Dinge schuf und verrichtete, die in der Wirthschaft nöthig waren.
Der Bauer setzte sich nun sofort auf die Hanselbank, zwängte einen Balken unter den hölzernen Haltkopf, begann[S. 165] mit einem Reifmesser daran zu schneiden und sagte: „Melchi, jetzt kannst was reden mit mir.“
Der Bursche setzte sich auf einen Ahornblock, schlug mit den Händen auf die Oberschenkel, daß es klatschte, zuckte die Achseln und stieß das Wortlein: „Ja!“ heraus. Dann schwieg er und trampelte mit den Schuhen.
Der Hochweider schnitt gelassen an seinem Balken.
„Bauer,“ sagte nun der Melchior kleinlaut, „möcht Euch sagen, wie’s mit mir steht. ’s ist eine schwere Sach’, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mein Vater, der ist im Gefängniß gestorben, weil er sich unredlich Gut zugelegt hat; meinen Bruder haben die Gendarmen weggeführt, weil er Banknoten gefälscht; mich hat der Müller im Untergäu verjagt, weil ich kein Schurke hab sein wollen; seht, das ist meine ganze Geschichte.“
Der Bauer hatte beim „Schurken“ sein Messer still gehalten. Nun schnitt er wieder; als er aber sah, der Bursche wollte nicht mehr weiter reden, blickte er mit scharfem Auge auf: „Der paar Worte wegen hast mich über die Stiegen herauf gehetzt?“
„Habt Ihr den Ehrlich-Schmied vom Untergäu gekannt, Bauer?“
„Den Alten noch, hat mir ja im Eismonat meine Ochsen beschlagen, wenn ich Fuhrwerk im Thal gehabt!“ sagte der Hochweider, „hat seinen Namen nicht umsonst getragen, ist ein Ehrenmann gewesen.“
Der Melchior stieß einen tiefen Athemzug aus der Brust. – „Ah!“ sagte er sich aufrichtend, „jetzt Bauer, jetzt red’ ich mich leichter. Der Ehren-Schmied, der alte, von dem Ihr da sagt, der ist mein Großvater gewesen. Als so ein Bübel bin ich noch auf seinem Knie gesessen. Alle[S. 166] Leut’ haben mich den Ehren-Schmied-Buben geheißen, in der Schul’ bin ich der Ehren-Schmied-Melchi gewesen, wir haben uns ja auch Ehrlich geschrieben. D’rauf, wie mein Vater die Wirthschaft übernommen hat, ist’s abwärts gegangen. Meine Mutter, die ist gut gewesen, rechtschaffen gut, sie hat mehr an die Armen verschenkt, als es hätte sein sollen, und das hätt’ sie doch nicht thun sollen, daß sie von der Wirthschaft heimlich Korn und Speck und Fleisch verkauft hat. ’s ist bitter für mich, zu sagen, der paar Groschen wegen ist’s ihr zu thun gewesen. Wie das Sprüchel sagt: das Weib kann mit der Schürze mehr aus dem Haus tragen, als der Mann mit dem Erntewagen einfährt. Ganz und gar sind wir verarmt. Mein Vater ist mit traurigem Gesicht im Hause umhergegangen, die Arbeit hat ihm nicht mehr schlaunen wollen; wär’ sie schon umsonst, so hätt’ er keine Freud’ mehr zu ihr. Ein Terno in der Lotterie gewonnen, könnt’ wohl noch retten! Hat viel simulirt, mein Vater, wie er nur wieder zu Geld kommen könnt’. Da ist einmal ein mühseliger Hausirer in unserm Hause über Nacht geblieben, in derselben Nacht erkrankt und so hat mein Vater den armen Mann, um den sich sonst Niemand hat wollen annehmen, unter seinem Dach behalten und meine Mutter hat ihn wohl um Gotteswillen fleißig gewartet. Nach vier Monaten ist der alte Mann bei uns gestorben. In aller Still’ haben wir ihn auf den Kirchhof getragen, wie ein Bettelmann schon begraben wird. D’rauf, wie mein Vater das Sterbebett aus dem Stübel tragen will, findet er im Strohsack in ein blaues Tüchlein gewickelt – Geld. Ich, der junge Bub, hab’s erst viel später erfahren, es sollen an die neunzig Gulden gewesen sein. Jetzt Hochweider, wenn Einen die Gnad’ Gottes jah verläßt!... Baargeld! Wer hätt’ so was beim Bettelmann gesucht? Wer[S. 167] frägt danach! Keine Schrift, kein einzig Wort ist laut. Und die Krankenpflege hat Müh’ gemacht und die Kost und die Medicin hat Geld gekostet, wie kann’s denn eine so große Sünd’ sein, die kleine Baarschaft da in aller Still’ für’s Haus zu verwenden! – So wird’s meinem Vater halt in den Kopf gekommen sein. Auf das geht eine Weile hin, steigt der Gerichtsdiener in die Ehren-Schmiede. Ja, der ist wohl auch sonst zuweilen gekommen, aber diesmal wird mein Vater todtenblaß. Er muß vor’s Gericht, muß sich ausweisen, was es mit dem Gelde ist, das er im Strohsack des Hausirers gefunden! – Eine Magd in unserm Haus, die dahinter gekommen, hat’s verrathen; mein Vater hat auf das erste Wort Alles gestanden, er hätt’ nicht vorgehabt, den Fund beim Amte anzuzeigen, hätt’ ihn für die Mühen und Auslagen im Haus behalten wollen. Jetzt, Hochweider, haben sie den Ehren-Schmied eingesperrt.“
Diese letzten Worte hatte der Melchior nur so vor sich hingemurmelt und hatte dabei stark mit den Schuhen auf den Fußboden geklopft. Seine Wangen waren hochroth, seine Augen blinzelten und richteten sich zu Boden. Der Bauer von der hohen Weid saß ruhig auf seiner Hanselbank und schnitt und hobelte und hielt den Balken wagrecht vor sein prüfend Auge hin, ob er wohl schon gleich und glatt genug sei.
„Mit dem Andern,“ sagte der Bursche jetzt, „will ich warten, bis Euer Holz fertig ist, Bauer.“
Da ließ dieser von seiner Arbeit ab und versetzte: „Wie Du siehst, bearbeite ich das Holz mit den Händen und nicht mit den Ohren.“
„Der Ehren-Schmied-Sohn muß es leiden, wie man ihm zuhört,“ sagte der Melchior und schlug wieder auf seine Schenkel. „Mein Vater, der ist nach wenigen Wochen im[S. 168] Gefängniß gestorben, nicht lange darauf auch meine Mutter. Die Schmiede ist in fremde Hände gekommen. Meinen älteren Bruder, viel gescheidter und anstelliger als andere junge Leut’, hat der Oberförster Tarnwald zu sich genommen. Der Kilian, hat es geheißen, hätt’ lieber studiren und ein Baumeister oder Maler werden sollen, er hat manchmal allerhand so Zeichnungen gemacht. Um mich, den einfältigen und noch kleinen Jungen hat sich Niemand kümmern wollen und Verwandte wissen wir in der ganzen Gegend keine aufzuweisen. Da hat mich der Müller genommen. Beim Müller hab ich gezogen wie ein Ochs, getragen wie ein Esel, sieben Jahr’ lang. Das ist auch in der Ordnung gewesen, ich hab’ meine geraden Glieder und ich will gern arbeiten. – Da geht Euch vor etlichen Tagen auf einmal das Gerede, die neuen, falschen Banknoten, die in der Gegend umliefen, hätt’ der Forstjung Kilian Ehrlich gemacht! – Keiner hat gefragt, ob’s wahr, Jeder hat’s geglaubt auf’s erste Wort. Ehrlich! haben sie geschrien und hell gelacht – die braven Ehren-Schmiedleut! Das Weib hat den Mann bestohlen, der Mann hat den armen Hausirer ausgeraubt, der Sohn ist ein Fälscher geworden – ist eine nette Bande. – – Die Ehrabschneider! die Teufelsleut’!“ Die Worte blieben dem Burschen im Halse stecken, seine Fäuste bebten auf den Knieen und der Hochweider, der nur so hinblinzelte auf sein Gesicht, sah das schäumende, knirschende Antlitz eines Rasenden.
„Und ganz recht haben sie,“ sagte später der Melchior scheinbar ruhig, „der Wahrheit kann man nicht auf den Mund schlagen. – Nur daß Ihr’s wißt, Bauer, wie wir zugrunde gerichtet sind. – Und –“ jetzt sprang er auf, „das verfluchte Geld ist Schuld an meiner Mutter, an meines Vaters, an meines Bruders Verderben. Und gestern, wie uns der Kilian zwischen den Gendarmen unten an der Leuten begegnet ist, da[S. 169] hab’ ich bei mir den Schwur gethan: mein Lebtag nicht einen Heller will ich haben von dem vermaledeiten Geld, das die braven Leut’ umbringt!“
Der junge Mann schlug sich die beiden Hände in das Gesicht und kam in ein Schluchzen, das den ganzen Körper schüttelte.
Der Hochweidhofer erhob sich langsam und sagte, „Melchi, Du bist ein braver Bursch! Dich wird auch das Geld nicht verderben, wenn Du nur erst eins hast.“
„Wie der Will,“ fuhr der Melchior dazwischen, „den Geldleuten, den Rechtschaffenen, wie den Lumpen, allen will ich zeigen, wie man ohne einen einzigen Pfennig in der Tasch’ durch die Welt kommen und der Ehrlich bleiben kann. Und die Untergäuer sollen sehen, daß das Blut vom alten Ehren-Schmied noch lebt!“
Solcher Sinn gefiel dem Bauer von der hohen Weid. Er hätte aber nicht geglaubt, daß dieser Junge, dem er manchen Vagabunden an den Kopf geworfen hatte, so denken und seine Worte so gesetzt und rechtschaffen vorbringen konnte. Er hätte ihm mögen die beiden Hände fest drücken, doch besann er sich noch früh genug, er sei der Bauer von der hohen Weid, und so sagte er nur: „Melchi, bist ein wackerer Bursch; aber was Du mir da erzählt hast, das weiß ich schon seit drei Stunden. Ich hab’ vom Müller im untern Gäu Deine Siebensachen und Deine Papiere holen lassen und da ist mir gesagt worden, wie’s mit Dir und den Deinigen steht. Der Müller hat mir freilich berichten lassen, daß einem Menschen, der eine solche Verwandtschaft weist –“
„Nicht zu trauen ist!“ ergänzte der Melchior. „Ja, das wird er gesagt haben, ich kenne den Müller. Will’s Euch nur noch erzählen, Bauer, warum ich ihm aus dem Haus[S. 170] gegangen bin, das hat er Euch sicher nicht berichten lassen. Gestern in aller Frühe, weit ehe noch die Sonne auf ist, kommt er in die Kleienkammer, wo mein Bett steht. Ich will gleich aufspringen, ’s giebt viel Arbeit im Tag. – Nu, nu, Melchior, sagt der Müller, was wirst denn schon jetzt aus dem Nest steigen, ’s ist ja Zeit, schläft noch das ganze Haus. Hab’ Dir nur was sagen wollen, Melchior. Wirst es wissen, vor ein paar Wochen, in der Mariaheimsuchungnacht, ist dem Gutsverwalter unten der Fischbehälter ausgeplündert worden. Und jetzt ist die Sach’ so angestellt, daß ich auch in die Schmier hineinkommen soll. Ich will die vielen Laufereien zu Gericht nicht haben und deswegen, Melchior, ’s kann sein, daß Du gefragt wirst – weißt Melchior, ich muß einen Zeugen haben, daß ich in der Mariaheimsuchungnacht zu Haus gewesen bin. – Den Zeugen muß halt die Frau Müllerin machen, sag’ ich. – Geht nicht, sagt der Müller, Eheweiber werden nicht angenommen. Aber bei Dir ist’s was Anders, Du wirst es ja wohl wissen, daß ich in derselben Nacht daheim gewesen bin. Du brauchst ein neues Paar Stiefel, Melchior, soll gar keinen Umstand haben, und es bleibt jetzt dabei, Du bist mein Zeug’, daß ich in der Heimsuchungnacht in der Mühl’ gewesen bin. – Ich kann der Zeug’ nicht sein, Müller, sag’ ich, ich weiß ja gar nicht, ob Ihr daheim gewesen seid, ich hab’ fest geschlafen. – Bist sieben Jahr’ in meinem Haus gewesen, sagt drauf der Müller, hab’ Dich als armen Waisen aufgenommen, wie Dein Vater im Arrest gestorben ist; hab’ Dich allerweil wie mein eigen Kind lieb gehabt, wirst mir nicht undankbar sein, Melchior. – Ein falsches Zeugniß geb’ ich nicht! schrei ich auf. Da thut der Müller einen Lacher: – Schau das Galgenbandl! will den Gewissenhaften spielen! – Hochweider, wie ich das[S. 171] gehört – hell mutternackt bin ich aus dem Bett gesprungen. – Weil sich die Meinen vergangen haben, so willst mich auch zum Schurken machen, Müller! ruf’ ich aus. – Marsch aus meinem Haus! schreit er aufgebracht. – Heut’ lieber wie morgen, sag’ ich, werf’ meine Kleider über und lauf davon. Er ruft mir noch viele gute Worte nach, ich sollt’ nur bleiben, ’s wär Alles vergessen. Hab’ davon nichts mehr verstehen mögen; bin fortgesprungen, bin herumgegangen auf der Haid, Hochweider, dann habt Ihr mich angerufen.“
Der Bauer hatte längst nicht mehr am Holze geschnitten.
„Melchi,“ sagte er jetzt, „’s hat Alles den rechten Schick, wenn Du von Deinem alten Dienstherrn noch was wissen willst: den Müller haben heut’ die Gendarmen geholt.“
„Der Müller geht mich nichts mehr an,“ sagte der Bursche trotzig, „hab’ mit mir selber zu thun. Jetzt sagt es, Bauer, wollt Ihr mich in Dienst nehmen oder nicht?“
„Wie Du bist,“ versetzte der Bauer, „so wirst Du Dienstplätze überall finden. Willst auf der hohen Weid verbleiben, so ist’s abgemacht, bin ich mit meinem Knecht zufrieden, so soll’s auch er mit mir sein; da hast dieweilen Dein Angeld.“
„Bauer! ich leiste was ich kann und Ihr gebt mir, was ich brauch!“
Nicht einen einzigen Blick warf er auf das ihm vorgehaltene Geld, der Hochweidhofer mußte es wieder einstecken.
Hierauf ging der Melchior in die Gesindestube, um sein Mittagsmahl zu verzehren.
Der Bauer kam ihm nach: „Noch was will ich Dir sagen, Melchi, meine Leut’ wissen es nicht, daß Du der Bruder vom Forstadjuncten bist, sie brauchen es auch nicht zu wissen.“
In demselben Augenblick wankte draußen vor den Fenstern die geknickte Gestalt des Remini Dreihand vorüber. Unter der rechten Achsel, wie man sonst die Regenschirme trägt, trug er heute ein Schießgewehr bei sich. Der Bauer lachte laut über diese Figur, da krächzte der Remini durch ein Fenster: „Hab mich bezahlt gemacht. Vom Forstadjuncten ist’s; ein feiner Doppelstutzen! Ist mehr werth als der falsche Zehner!“
„Ha, das glaube ich!“ rief der Bauer, „Mancherlei wiederum ist keinen Schuß Pulver werth. Gieb acht, Remini, daß der Stutzen auf Dich selber nicht losgeht!“
Die Wirthschaft auf der hohen Weid wird hier nicht näher beschrieben. Die Thiere pflegen und hüten, die Ställe in Stand halten, die Scheunen mit Heu und Streu füllen, die Milch, Butter und Käse bereiten, das waren die Hauptbeschäftigungen der Leute, die daran jahraus jahrein übergenug zu thun hatten.
Es ist eine seltsame Stimmung im Hirtenhause. Lustigkeit, Leichtlebigkeit, Uebermuth, Trotz, Unbändigkeit und Ungezwungenheit allerwärts – wie’s eben geht, wo Mensch und Vieh zusammen sich des Lebens freuen. Den Hochweidbauer ficht das nicht an; wenn nur die Wirthschaft ihren guten Lauf hat und Jeder seine Arbeit thut, alles Andere mag gehen, wie Gott es will. Der Herr Pfarrer im Untergäu hat freilich einmal zu verstehen gegeben, er, der Bauer auf der hohen Weid, wie überhaupt jeder Hausvater, sei nicht allein für das leibliche Wohl seiner Hausgenossen, sondern auch für deren Seelenheil verantwortlich. Darauf hatte aber der Bauer in seiner vollen Ungeschlachtheit geantwortet: „Ja, sakra! wenn jeder Hausherr selber Seelsorger sein soll, wozu brauchen wir dann die Pfaffen! –[S. 173] Ich laß meine Leut’ in die Kirche und zur Beicht’ gehen, so oft das vorgeschrieben ist, das Weitere geht mich nichts an.“ Gleichwohl that der Mann in seiner Gewissenhaftigkeit ein Uebriges, er sah immer darauf, daß die Mannspersonen seines Hofes stets um fünfundzwanzig Jahre älter waren, als die Weibsleute. Dadurch regelte sich Vieles. Ferner hatte der Mann von der hohen Weid auch die Vorsicht, des Nachts stets einen oder zwei Rundgänge durch und um das Gebäude zu machen, schon des Feuers, der Diebe, der Ordnung in den Stallungen wegen. Auch wurden zur Nachtszeit die zwei großen Kettenhunde losgelassen.
Ob der Bauer, als er den noch nicht neunzehnjährigen Melchior Ehrlich in’s Haus genommen, seine Regel vergessen hatte, oder sie absichtlich umging, läßt sich nicht bestimmen. Er fand eben Gefallen an dem kernigen Burschen und dachte, es könne nicht schaden, daß in sein schläfriges oder leichtfertiges Gesinde einmal ein wenig Sauerteig käme.
Dem Melchior jedoch, dem ging es ganz eigen. In den Geschäften, denen er zu obliegen hatte, stellte er seinen Mann, mitunter sogar seinen doppelten; auch war er sich bewußt, daß er stets gute Courage in der Brust fand, wollte er was durchsetzen. Und trotzdem – und dennoch – er war nun schon drei Wochen im Hof auf der Weid und er wußte noch immer nicht, was die kleine Buttertoni eigentlich für ein Gesicht hatte. Wenn sie an ihm vorüberlief, oder er an ihr hinstreifte, oder wenn sie sich von einer Futterkammer in die andere irgend einmal ein paar schalkhafte Worte zuriefen, so glitt sein Blick wohl an ihren stets sauber gehaltenen Barfüßchen hin, an den Waden, am rothen Kittelchen empor, bis wo die Masche des Schürzenbandes ist, kam aber nicht höher, als bis zum obersten Busenhäklein, wo zuweilen auch[S. 174] eine kleine, wilde Rose stak, mit sammt den Dörnchen aber, so daß der alte Ochsenwart, wenn er, anmaßender als der Melchior, mit seinen kartoffelbraunen Knochenfingern nach derselben langen wollte, sich allemal recht tüchtig stach.
Und von dieser Unkenntniß ihres Angesichtes stammten die unsinnigen Träume, die den jungen Untergäuer fast jede Nacht umgaukelten. Er sah die glatten, runden Füßchen, das schmiegsame Kittelchen, die strammgespannten Busenhäklein, das gelbe Lockenhaar, welches gern in wilden Strähnen niederhing über den Nacken – sah das Alles fein und genau, aber das Gesicht hatte eine ellenlange Nase, auf welcher graue, kurzgeschnittene Haare standen, wie auf dem Haupte des Sennermägdle.
Als nun aber der Melchi, wie er im Hofe stets genannt wurde, an der Butterkammerthür ein Bohrloch entdeckt hatte, und mehrmals des Tages, wenn ihn sein Weg just vorüberführte, davor stehen blieb und durch dasselbe die junge Butterin betrachtete, auch vom Busenhäklein aufwärts betrachtete, da gestalteten sich die Träume freundlicher.
Die kleine Buttertoni, die Rothkitteldirn, hatte ein gar nettes Lärvchen. Die frischrothen Lippen legten sich nach oben und unten ein wenig heraus, wie die Blättchen einer Rose anfangs thun, ehe sie sich erschließen; sie waren immer ein bischen offen, und wenn das Mädchen kicherte, da sah man, was es für frische Zähne hatte. Das Näschen war hübsch aufgeschweift, die Augensterne duckten sich halb unter den langen Brauen, als wollten sie mit wem Verstecken spielen. Wenn die Brauen aber doch mitunter emporgezogen wurden, so zitterte ein ganz seltsamer Thauglanz über den blaugrauen Augen, vor dem der Melchi erschrak. Die kleine Toni verhielt sich selbstverständlich durchaus ungenirt in ihrer Butter[S. 175]kammer, das Kübeltreiben macht warm; da that sie das Jöppchen mehrmals so weit auseinander, daß der Melchi durch das Bohrloch alle Flicken ihres Pfaidleins gesehen hätte, wäre er nicht rechtzeitig mit einem Stöpsel aus Fichtenmoos in das Loch gefahren, um dieses seinen und auch anderen Augen gründlich zu verstopfen.
Daß der Bursche unter so ängstlichen Stimmungen bisher nicht dazu gekommen war, der kleinen Toni als Gegengabe für das Lebkuchenherz den föhrenrindenen Vogel anzubieten, ist erklärlich. Oft genug wollte er’s thun, hatte aber nicht die Schneid dazu. Da fiel es ihm eines Tages ein: die Rothkitteldirn solle sich den Vogel selber nehmen, wenn er ihr gefiele. Er stellte ihn auf ihr Kammerfensterchen; aber da blieb er stehen und sie sah ihn nicht. Hingegen bemerkte ihn der kleine Nickerl und dieser verband sich mit dem Fritz, dem jüngern Sohn des Hauses, um den possirlichen Vogel vom Fenster abzunehmen. Noch rechtzeitig kam der Melchi der Verschwörung dahinter, steckte den föhrenrindenen Vogel wieder in seinen Hosensack und trug ihn herum wie vor und eh.
Da trug es sich zu, daß der Bursche einmal beim Erlbuschhacken zur Stallstreu ein Loch in seine Hose riß, gerade über den Hüften. Er kam des Abends heim mit der Bitte: „Du, kleine Toni, gelt, Du bist so gut und heilst mir den Riß da mit Zwirn und Nadel zu?“
Sie lachte hell und kam sogleich mit dem Werkzeug herbei. „Na, Du mußt Dich auf die Kübelbank setzen, sonst wackelst mir allzuviel hin und her. So! und jetzt halt still und rühr’ Dich nit. Bübel weißt, die Nadel beißt.“
„Stich zu,“ sagte der Bursche, und jeder Stich ging ihm heiß durch Mark und Bein, es war ihm gerade, als nähe die Rothkitteldirn sein Herz an das ihrige fest.
„Wirst einmal ein sauberer Soldat, Du,“ sagte die Butterdirn.
„Mag keiner werden,“ versetzte er trotzig, „mir steht das Leutumbringen nicht an. Schau um, Leut’ sind zu wenig, Geld ist zu viel.“
„Grad verkehrt hast es gesagt,“ bemerkte die Butterdirn.
Der Melchior schwieg und gab sich der ganzen wohligen Empfindung des Zunadelns hin.
„Uh Jesses, mein Lebertag!“ rief das Mädchen plötzlich und brach in ein so heftiges Lachen aus, daß der Athem gar nicht mehr zurückkehren wollte und der gute Melchi mit beiden Fäusten auf ihrem Rücken trommelte, um sie vor dem Ersticken zu retten.
„Mein Lebertag!“ röchelte sie wiederholt und kam stets neuerdings in’s Lachen, „was ist denn das für ein spaßiger Brocken da drin?“
Sie hatte den föhrenrindenen Vogel entdeckt.
„Das da?“ entgegnete der Bursche, „das ist ein Rothkröpfel. Gefällt es Dir?“
Von Neuem ging das Röcheln des Lachens los und als sie endlich zu sich gekommen war, fragte sie ganz heiser: „Na, Du dalkerter Bub, das hast gewiß selber gemacht und kann mir’s wohl denken, das willst Du Deiner Schönen geben! ’leicht einer sauberen Untergäuerin! Na wart, das kriegst mir nimmer zurück!“
Den Vogel aus dem Sack hinter ihr Busentüchlein stecken war eine rasche That, dann kicherte und schäkerte sie noch eine Weile lustig fort.
Der Melchi war überglücklich.
„Der ist ja für Dich, Toni,“ flüsterte er und wußte dabei nicht, wohin mit seinen Augen, „für das schöne Leb[S. 177]zeltenherz, Toni, weißt? Und paß nur recht auf, ’leicht legt der Vogel einmal ein Ei, das soll auch Dein sein...“
Neuer Lachkrampf. Der hölzerne Vogel legt ein Ei! So was Possirliches hatte die Rothkitteldirn all ihr Lebtag nicht gehört.
„Melchi!“ rief jetzt der Bauer von draußen.
Die Beiden waren mäuschenstill. Der Bauer entfernte sich wieder.
„Ein dummes Hocken da!“ rief der Bursche plötzlich und sprang zornig auf. „Was ist denn Heimliches dran, wenn mir die Dirn das Loch zuflickt!“
Er eilte dem Hausherrn nach.
Schlechtes Geld.
Der Forstadjunct Kilian war nicht mehr zurückgekehrt. Es hieß, er sei auf lebenslang in einen tiefen Kerker geworfen worden.
Der Melchior war darüber sehr traurig, aber der Hochweidhofer tröstete ihn: „Ein junger, das erstemal ertappter Falschmünzer auf lebelang, das wäre unerhört, das ist gar nicht wahr.“
„Und ein zum zweitenmal Ertappter?“ rief der Bursche erregt; „mir ist hart um’s Herz, denk ich an meinen Bruder; aber sie sollen ihn nur im Kotter behalten; wenn er auskommt, der laßt’s nimmer.“
Dann wieder simulirte er, wie er seinem Bruder etwas Gutes thun könnte, unterdrückte aber den Gedanken und rief sich zu: „Melchior, halte dich an ehrliche Leut’!“
Zur Herbstzeit, als der Abtrieb von den Almen kam, war der warmblütige Bursche längst wieder bei Lust und Uebermuth.
Der Herbst bringt im Gebirge immer die schönsten Tage des Jahres. An einem solchen Tage war es, als sie herabkamen gegen den Hochweidhof, die braunen, weißbesprenkelten Rinder mit den Schellen und mit den Kränzen aus Rhododendronlaub, Enzian und Zirmgesträuche. Um die Stirn hatte Jedes seinen Strauß; die hoffnungsvolleren Kühe hatten auch Kränze um den Hals, grünes Gezweige um die Hüften geschlungen. Und der Stier aus dem Untergäu schon gar! Der mußte sich zu allseitiger Befriedigung aufgeführt haben, er sah schier aus wie ein wandelnder Rosenstrauch. Waren diese blauen, weißen und gelben Blumen und Rosen, die er um seinen Leib gewunden trug, denn alle auf der herbstlichen Alm erblüht?
Ein paar schäkernde Ziegen machten sich viel um ihn herum zu thun und erhaschten dann und wann ein Maul voll Bocksbartkraut und wilden Thymian, mit welchem der Stier geschmückt war.
Zahlreiche Senninnen, junge und minder junge aus der ganzen Gegend waren dabei und Jede hatte vorne ihre Schürze zu einem Sack aufgebunden und aus diesem Sacke vertheilten sie an die Mannsleute kleine Käsekuchen und Butterkrapfen. Mancher von den Mannsleuten war freilich so keck, sich mit eigener Hand das Kräpflein aus der Schürze zu holen, was aber nicht Jede ungestraft geschehen ließ. Auch einige der Almerinnen hatten freundliche Rosmarinkränzchen auf den Locken; blos das Sennermägdle von der Hinteralm hatte nichts als einen ungeheuren Strohhut auf ihrem geschorenen Haupte. Auch sie hatte Krapfen im Vortuch, doch wollte Keiner d’rum kommen, nur der alte Remini Dreihand fand sich ein und aß ihr den ganzen Schürzeninhalt auf. Die Alte ließ es geschehen und machte dieweilen Feuer mit Stein und Zunder und paffte aus ihrem Pfeifchen.
„Dieses Weib wär’ mir nicht halb so widrig, wenn es nicht das Sennermägdle heißen thät,“ vertraute der Melchior dem höckerigen und kropfigen Ochsenwart.
„Je!“ rief dieser, „der Name ist noch das Beste an ihr.“
„Das schon, aber probir’s nur Du und heiße das schöne Hänschen; Alles wird Dich auslachen und spotten; und so Du der alte, bucklige Hans bist, geht Jeder ernsthaft an Dir vorbei. Aber sag’ mir doch, wer hat denn der Alten den närrischen Namen gegeben?“
„So viel ich weiß,“ sagte der Ochsenwart, „hat sie den selber mit sich gebracht, als sie vor vierzig oder fünfundvierzig Jahren aus dem Kärntnerland zu uns auf die hohe Weid gekommen ist. Sie ist eine gar brave Almerin, Melchi! Du, die kann mit dem Vieh umgehen! Nicht drei Stückel sind ihr verdorben, so lang’ sie bei uns auf der Alm ist. Nu, das Sennermägdle ist ihr verblieben aus Gewohnheit. Vor drei oder vier Jahren hat sie der Bauer einmal die alte Froni genannt, so heißt sie. Hat auf das hin aber den Dienst wollen aufsagen auf der Stell’. Ist sie seitdem halt wieder das Sennermägdle.“
Als der Bauer von der hohen Weid an diesem Tage gesehen hatte, wie frisch, glatt und wohlgenährt seine Heerde von der Hinteralm zurückgekommen war, da hieß er das Sennermägdle zu sich in den Streuschupfen treten und drückte ihm drei funkelnagelneue Thaler in die Hand.
Der geknickte Zaunpfahl war nicht weit davon gestanden; und als das Mägdle hierauf in die Graskammer ging, und in das Milchgelaß, und endlich auf den Rübenacker hinaus, wo es in seiner Arbeitsamkeit überall Geschäfte fand, schlich ihr der Alte nach und sein dreieckiges Gesicht grinste süßlich d’rein.
Später stieg das Mägdle in die Krautgrube hinab, wie solche bei den meisten Alpenwirthschaften jener Gegend zur Aufbewahrung des Kohlkrautes als ein mehrere Klafter tiefer Schacht sich vorfindet. Die Alte war tief unten und trat mit ihren breiten Füßen die früher durch heißes Wasser eingeweichten Krautköpfe fest. Auch zu dieser Grube, die ein wenig abseits vom Hofe an einem Hagebuttenstrauche war, kam der alte Schleicher nach. Eine Weile lugte er, am Rande des Schachtes stehend, nach allen Richtungen um sich, dann zog er seine Pelzhaube an, duckte in die Tiefe hinab und sagte: „Sennermägdle!“ Seine Stimme war so schmiegsam und weich, als wäre sie über und über mit Fuchsschmalz geschmiert worden. „Sennermägdle,“ sagt er, „Du bist so viel fleißig und Dir schlaunts besser, wie drei anderen Weibsleuten im Hochweidhof zusammen. Bist erst von der Alm gekommen und machst Dir da schon wieder zu schaffen. Du, Sennermägdle!“
„Jetzt hab’ ich keine Zeit zum Schwätzen!“ rief die Alte von der Grube herauf und trat wacker auf die Köpfe los.
„Freilich nicht,“ entgegnete der Remini, „aber Deine guten Butterkrapfen vorhin, die haben mir frei so viel taugt. Gern, daß ich Dir auch einmal einen Gefallen thun möcht.“
„Ist schon recht,“ sagte das Mägdle.
„Ich hätt’ wohl noch ein Anliegen, Sennermägdle,“ schnürfelte der Alte, „ist aber nit schicksam, thät’s auch nit, hätt’ ich die Sach’ nit gar so nöthig.“
Die Magd stand still und blickte auf: „Wirst doch nit Noth leiden müssen, Remini!“
„Das dieweilen just nit, Gott sei Lob und Dank! gleichwohl man’s nit wissen kann, wie’s Einem in seinen alten Tagen noch gehen wird. Aber – nu, siehst Du, Mägdle,[S. 181] wohlthätig sein will Einer doch auch ein wenig, wie man halt kann und mag. Und da hab’ ich im Untergäu ein Pathenkind, ein armes Waiserl, und dem möcht’ ich recht gern ein klein Ding schenken, so zum Andenken was, daß Unsereiner auch nit ganz vergessen ist, wenn so ein Mensch einmal in die Welt wachst. Ich hab’ gesehen, Sennermägdle, Dir hat heut’ Dein Bauer für Deine Bravheit drei Thaler zugesteckt; wenn Du nichts dagegen hättest, die möcht’ ich Dir zu gern auswechseln. Thät’ Dir frei einen Zehnerbanknoten geben.“
„Du meine Zeit!“ rief die Magd in der Grube und hüpfte beständig auf den platten Kohlköpfen umher, „meine drei Schimmel werden wohl so viel nicht werth sein; und herausgeben kann ich nicht.“
„Fünf Gulden mögen sie just decken,“ fiel der Alte rasch ein, „und die andern fünf will ich Dir gern bis auf Deinen Jahreslohn zu Weihnachten borgen. Mägdle, wir machen’s gleich ab.“
Noch einmal blickte der Remini mißtrauisch um sich. Dort auf dem Zaun sitzt eine Krähe! Na, kindisch, ’s ist doch nur eine Krähe. So kann er die Banknote schon hervorholen. Das Sennermägdle beginnt auch die Thaler aus der Joppe zu nesteln; ei, thut’s ja gern, wenn dem Alten damit gedient ist; bleibt eh kein Geld, ob’s von Silber ist, oder von Papier – bleibt kein Geld bei einer Almerin.
„Vetter!“ rief in demselben Augenblick der Hagebuttenstrauch. Der Alte wäre vor Schreck schier in die Krautgrube gefallen.
Der Melchior kroch hervor: „Nicht als ob ich zu horchen gekommen wär’,“ sagte er, „ich hab’ dahinten dem kleinen Fritz ein paar Kranabetherschlingen aufgerichtet. – Seid so gut, Remini!“ Er langte mit kecker Hand nach der Banknote[S. 182] und sah sie an. „Schau, noch ein falscher im Land! – Remini, das ist derselbe, den Ihr vorig Sommer vom Forstadjuncten bekommen. Was habt Ihr denn das Papier gar so abgeknittert? ’s ist doch ein neuer. Geht, Remini, zerreißt den Fetzen; Ihr habt Euch ja schon entschädigt durch den Doppelstutzen.“
Der Bursche war so boshaft, zu diesen seinen Worten ein lächelndes Gesicht zu machen. Im Dreieck des Alten aber zuckte jede Muskel, und er zog seine scharfe Unterlippe weit hinter den schartigen Oberkiefer zurück.
„Anschmieren hat er mich wollen?“ zeterte die Alte im Loch, „Du Spitzbub, Du schlechter! – Dank Dir Gott, Melchi! – Wart, Du vertrackter Galgenstrick, Du! Dir will ich noch einmal Butterkrapfen schenken! – Ein falsches Geld für meine guten Thaler! – Dank Dir Gott, Melchi! – Dein Glück, Du alter Schleicher, daß ich nicht oben bin, Dir wollten ein paar Tüchtige nicht schaden auf Dein Ohrfeigengesicht! – Hell betrogen hätt’ er mich, der Kerl da! Na, schaut’s aber da her, schaut’s den Lumpen an! – Vergelt’ Dir’s tausendmal Gott, Melchi!“
So zeterte das zornige und das dankbare Sennermägdle.
Der Alte trollte sich sachte davon und murmelte: „Nichts als Malheur! ’s ist des Teufels! Ach, hätt’ mich meine Mutter lieber in die neue Welt geschickt!“ Dann schoß er nur noch ein paar giftige Blicke auf Melchior zurück.
Jetzt erst kam diesem die Wuth. Die Banknote riß er mitten auseinander, dann ging er, ohne noch ein Wörtchen mit dem Sennermägdle zu wechseln, in den Hof zurück.
Der alte Dreihand schlich, doppelt geknickt, die Lehne hinab gegen seine Klause, die in einer Schlucht stak und in welcher wilde Früchte für den Winter, als dürre Beeren,[S. 183] Holzäpfel, Holzbirnen, Pilze u. s. w., in großen Haufen geschichtet lagen. Die Hütte war ganz erbärmlich und gar nichts Nennenswerthes darin, als etwa der Doppelstutzen, der hinter dem Bettstroh ruhte und in welchem immer noch die Ladung stak, mit der sie der Alte zur Hand bekommen hatte. Der Remini hätte manches Reh, das in der Schlucht lief, von Herzen gern damit niedergeschossen, aber er kam nicht dazu. „Am Ende,“ meinte er, „treff’ ich das tolle Thier nicht und dann ist auch das Pulver hin.“
Doch war dem Alten das Schußgewehr ein angenehmer Geselle in den langen, öden Nächten. Hieß es ja, der Remini Dreihand berge Geld in seiner Klause.
Die Liebe blüht.
Im Winter ging es auf dem Hofe noch lebhafter zu, als im Sommer. Da war Alles von den Almen beisammen auf der hohen Weid. Auch kamen die Viehhändler, die Fleischhauer von den Ortschaften herauf, und zur Weihnachtszeit kam mancher neue Dienstbote und mancher alte ging.
Zur Weihnachtszeit war es auch, als der Hochweider den Melchior mit in sein Stübchen nahm: „Bist mir zwar zu Jakobi erst in’s Haus gekommen, aber ist der Bauer von der hohen Weid mit Einem zufrieden, so giebt’s beim Auszahlen kein halbes Jahr. Haben nichts Festes ausgemacht, also siebzig Gulden für’s vergangene Jahr.“
Er zählte das Geld auf den Tisch.
„Ich frag’ nur Eins, Bauer,“ sagte der Melchior, „muß ich fort, oder soll ich dableiben?“
„Ich denk, Melchi, bis auf weiteres weißt, wo Du daheim bist. Und willst schon Deine besondere Ehr’ haben,[S. 184] auch recht, so sag ich: sei so gut, Melchior, und bleib mir noch für’s nächste Jahr auf meinem Hof.“
„Ist recht, Bauer. Habt Ihr sonst was anzuschaffen? Nicht, so geh ich wieder an meine Arbeit.“
Er ging und das Geld blieb liegen auf dem Tisch. Keinen Blick hatte der Bursche nach demselben geworfen.
„Seit die Welt steht, ist so ein Knecht noch nicht herumgegangen auf der hohen Weid!“ brummte der Bauer, „und früher sicherlich auch nicht. Wie der Will, das Geld werd’ ich ihm aufbewahren. Wart, Junge, ’s kommt eine Zeit, wo Du danach fragen wirst!“
Und der Melchior ging in den Stall zu den zwanzig Ochsen, die ihm anvertraut waren, und er redete in’s Heu hinein: „Geld? Geld hat er wollen geben. Und nicht einmal die fünfzig Gulden hätt’ er mir abgezogen, um die ihn die fünf falschen Zehner von meinem Bruder betrogen haben. Ich nehm’ gar nichts. Ich hab’ mein Essen und ich hab’ meine kleine Toni. Ich leb’ wie ein König, aber nicht so unruhig. Wenn ich mir schon was wünschen möcht’, eine neue Zipfelmütze.“
Und wie es schon manchem Menschen gegeben ist, daß jeder seiner Wünsche in Erfüllung geht: als der Dreikönigstag kam, hatte der Melchior seine neue Zipfelmütze. Es war ein Angebinde zum Namenstag von – der Rothkitteldirn.
Wohl hatte dieselbe nicht immer dasselbe rothe Röcklein an, aber dadurch verlor sie natürlich nicht an Werth in Melchior’s Augen. Wäre in dem vielbelebten Hofe nur öfter Gelegenheit gewesen, mit ihr heimlich zu plaudern! Wohl löste sich zuweilen ein Knopf von Melchi’s Kleidern, den die kleine Toni anheftete; wohl kam beim Heuschütteln manchmal ein Splitterchen in des Mädchens Auge, das der Bursche[S. 185] sofort mit vielem Geschick herauszubekommen wußte, oder er zog ihr mit seiner Taschenveitelspitze ein eingetriebenes Holzspaltchen aus der Hand – aber das wollte den Leutchen allweg noch zu wenig Unheil sein.
Nur gegen den April hinaus wußte die Toni den Burschen einmal unversehens in ihre Butterkammer zu bekommen. Sie wartete ihm sofort mit einem über und über bebutterten Brotschnitten auf. Da sah sie der Melchi groß an: „Toni, weiß es der Bauer?“
„Gut keine Red’,“ kicherte das Mädchen, „desweg magst ganz und gar ruhig sein.“
„Der Bauer weiß es nicht, daß wir da von seinem Brot und Butter naschen wollen? Dirn, Du mußt – gescheidt sein!“ – ehrlich hatte er eigentlich sagen wollen.
Die kleine Toni hub gewaltig an zu lachen, und als sie damit fertig war, aß sie das Butterbrot selber.
Eine nachhaltige Mißstimmung hatte diese kleine Meinungsverschiedenheit nicht zur Folge.
Der junge Knecht wußte wohl, daß die Toni sonst ein braves, fleißiges und auch sparsames Mädchen war, welches viel auf die Wirthschaft und den Erwerb hielt, so verzieh er gern das kleine Fehl. Und sie selber hatte ja ein Recht zum Verkosten; mußte doch wissen, wie ihre Butter schmeckte.
Mit den Veilchen, mit den Maaßliebchen, mit den ersten Schwalben kam den beiden jungen Leutchen neue Wärme in’s Herz. Sie waren sich gar sehr zugethan und Eins vertrat im Hofe die Vortheile des Andern; war es in der Arbeit, die sie theilten, oder bei Tische, wo sie einander die besten Bissen zuschmuggelten. – Die Liebe solch’ armer Dienstboten hat einen gar seltsamen Reiz, sie wird durch das Beisammensein, durch das Mitsammenleiden, durch das heimliche Verlangen nach[S. 186] Gegenseitigkeit, durch das hingebende Vertrauen zu dem einen Menschen stets neu entfacht und muß sich doch im Verborgenen halten, sich vor dem Hausherrn, vor den Hausgenossen verleugnen, soll sie nicht Gefahr laufen, zerstört zu werden. „So warm ist kein Feuer, keine Gluth ist so heiß, als heimliche Liebe...“
Der Melchior war denn endlich auch recht zutraulich geworden, er lugte dem Mädchen längst nicht mehr durch das Bohrloch in die Augen. Und er hatte auch mehrmals sich schon erkundigt, ob der föhrenrindene Vogel das Eierchen noch nicht gelegt habe, worüber die kleine Butterdirn stets in ihren Lachkrampf verfiel.
Der Melchior war nun volle neunzehn Jahre alt geworden und er empfand es, was das für ein Unterschied ist, ob man achtzehn oder neunzehn zählt. Auch nahm er bereits den Schnurrbart wahr, was die Toni nicht recht glauben wollte, bis er sein Gesicht einmal recht tapfer an ihren rothen Wangen rieb.
Die kleine Buttertoni behauptete bei jeder Gelegenheit, daß sie auch schon gegen die Zwanzig ginge; doch zählte sie in Wahrheit erst über siebzehn ein halb Sommer, deßohngeachtet sprang im Laufe dieses Sommers ein Busenhäklein um’s andere auf.
Es kam der Mai. Die Heerden zogen mit frischgeputzten Schellen angethan wieder in’s Freie und mit ihnen die Halter und Halterinnen, die Kühjungen, die Ochsenwarte, die Senninnen.
Der Melchi trieb jeden Morgen seine Ochsen und Kälber zu den jungen Matten des Hochbodens hinan. In einer Thalung derselben stand ein Schachen mit sehr alten Fichtenbäumen und einigen Föhren, welche den Hirten in Zeiten böser Wetter[S. 187] als Schirmbäume dienten. An diese Baumgruppe schloß sich auch ein junges, grünes Wäldchen aus Tannen und Lärchen, das sehr dicht und dunkel war und auf dessen sanftem Moosboden der Melchi gern ein wenig ruhte, wenn ihm auf der freien Höhe zu sengend, oder auch der Wind zu scharf wurde. Nicht drei Schritte sah man von sich, wenn man in diesem Dickicht lag, sah auch nicht ein groschenbreites Scheibchen von dem blauen Himmel. Kohlschwarze Amseln schwirrten durch das Reisig und riefen: Tack, tack! zir, zir, hast was bei Dir?
Mitten d’rin in diesem jungen, dichten Gestämme fühlte sich unser braver Hirt wieder einmal ganz als sein eigener Herr. Da konnte er auf dem Rücken liegen, oder auf dem Bauch, auf den Füßen stehen oder auf dem Kopf, wen ging’s was an? Da zog er wohl auch mitunter sein Geldbeutelchen heraus und sah das lebkuchene Herz an und betrachtete das Bild mit dem Pärchen, das im Rosenkörbchen saß, und las die Ueberschrift, die längst überholt war, und schleckte endlich ein wenig an dem süßen Kuchen.
Die kleine Toni hatte es nicht so gut; sie mußte, wenn in der Butterkammer nichts zu schaffen war, unten auf der Heukehr die Ziegen weiden und hatte außer den paar Johannisbeersträuchen und Erlstauden gar keinen Schatten. Sie nähte, sie strickte für sich und für ihn. Aber die Sonne brannte heiß auf die Finger. Mehr als einmal sehnte sie sich nach dem Schirmschachen.
Was sich im Schirmschachen zugetragen.
Am Pfingstmorgen war’s. Alles, was aus dem Gehöft fortkonnte, war hinab in den untern Gäu zur Kirche gegangen. Der Melchi und die kleine Toni führten wie gewöhnlich ihre Heerden auf die Weide.
Auf dem Anger, bevor sie sich trennten, blieb der Bursche stehen, bohrte mit seinem Peitschenstock einen Grashalm in die Erde und sagte, stets auf den Grashalm blickend: „Toni, sind Deine Ziegen recht überschwenglich? Halten sie sich gern auf in der Heukehr?“
„Das ist gewiß,“ lachte das Mädchen, „sie suchen Dir alle Sträucher ab und es fangen die Sträucher erst an zu blühen.“
„So, sonst hätt’ ich gemeint, Toni, Du könntest sie heut’ ein wenig gegen den Hochboden hinauftreiben.“
„Du, das ist aber auch wahr,“ versetzte das Mädchen ernsthaft, „Du meinst der Hexen wegen? Nicht? Ja, hast Du noch nichts erzählen gehört, daß am Pfingstsonntag die Hexen auf die Weide kommen und die Kühe und die Ziegen ausmelken? Ja, das hab’ ich oft gehört und die Kühe und Ziegen thäten nachher das ganze Jahr eine blutige Milch geben. Ja, es ist gar kein Spaß und ich fürcht’ mich frei. Und dann sollt’ Eins heut’, kommt man schon nicht in die Kirche, einen Rosenkranz beten.“
„Freilich, und das können wir thun,“ sagte der Bursche, „und oben im Schirmschachen ist ein schöner Platz dazu. – So um die Zeit, wenn’s Neun schlägt, wirst wohl beim Schachen sein können...“
Der Grashalm unter dem Peitschenstock war gründlich zerquetscht. Einen heißen, aber scheuen Blick noch gegen das Mädchen und der Melchi leitete seine Ochsen dem Hochboden zu.
Die Sonne stand erst einige Spannlängen hoch über den fernen Bergen, hinter denen sie hervorgekommen war. Sie schien so freundlich und warm und sog den Thau der jungen Gräser auf. Die Glocken der Heerde klangen hell und langsam die Höhe hinan. Die Ochsen schritten gar feierlich d’rein, die Kälber hüpften und scherzten.
Der neunzehnjährige Hirte ging hinterher und steckte seine Hände in die Hosentaschen. Er spitzte den Mund und wollte ein Liedchen pfeifen. Da versagte ihm heute der Athem dazu; in seiner Brust war ein heißes Regen und Bewegen. Er schritt hastig, aber mäuschenstill über den weichen Rasen, dann schüttelte er zuweilen das Haupt mit den aufquellenden Ringellocken und mit der Zipfelmütze, und dann riß er plötzlich seine Hand aus dem Sack, schlug sie dem nächsten Mannkalb auf den Rücken und rief: „Ja, mein lieber Scheck, so geht’s uns! Hätten wir Zwei Geld im Sack, ’leicht wär’ uns allerhand verboten.“
Als sie auf dem Hochboden angekommen waren, hub die Heerde sogleich an zu grasen. Der Melchior ging gegen den Schachen hin, an dessen Schattenlänge er merkte, daß es bereits acht Uhr vorüber. Langsam schlenderte er zwischen den alten Bäumen hin und her und lugte und spähte. Da roch er plötzlich Tabaksrauch und wie von einem Wipfel gefallen, wackelte das Sennermägdle daher.
„Was hat die Alte da zu suchen?“ fuhr sie der Bursche an.
„Ich? Einen Junggesellen,“ wisperte sie grinsend. „Kann mir’s denken, daß ich Dir unbequem bin – da im Schachen.“
„Gar nit, gar nit,“ sagte der Melchior trotzig.
„Nit? nu, nachher kunnt’ ich ja helfen, Rosenkranz beten!“
Der Bursche sah sie wild an.
„Melchior!“ versetzte nun die Alte, in der einen Hand das Pfeifchen haltend, mit der andern den Arm des Burschen fassend, „Du hast mir im vorig’ Herbst eine Gutthat erwiesen. Hast mir meine drei Thaler behütet; das gedenk ich Dir; Du hast keine Mutter und keinen rechten Freund auf der Welt, und desweg möcht’ ich Dir gern was Rechtschaffenes erzeigen. –[S. 190] Wär’ mir lieb, wenn Du Dich ein wenig da zu mir auf den Stock setzen wolltest.“
„Warum denn nit!“ sagte der Hirt, der durch den ernsten und weichen Ton der vorigen Worte völlig besänftigt war, „ich setz’ mich schon, aber Euren Stinktiegel müßt Ihr wegthun. Ein rauchendes Weibsbild kann mir gestohlen werden.“
„Hast schon Recht,“ antwortete die Alte, „aber bei mir ist’s halt was Anderes; ich darf das Feuer nicht ausgehen lassen! – Und das muß ich Dir erzählen, Melchior; gelt, Du wirst mir deswegen nicht bös sein?“
„Wenn’s was Gescheidtes ist, so hör’ ich zu.“
„Wirst mir’s nit glauben: ich bin einmal jung und schön gewesen,“ hub sie an. „Das Wörtl: Sennermägdle ist mir noch davon geblieben, sonst gar nichts. Zu derselben Zeit und in derselben Gegend ist ein lustiger und sauberer Tirolerbursch gewesen, dem haben meine seidenen Haare so gefallen. Ja, die seidenen Haare und wohl auch, was daran gehangen ist. Haben uns leiden mögen. Zu mir auf die Sennerei ist er oftmals gekommen; vor der Hütte im Schatten sind wir gesessen die längste Zeit, und was haben wir gethan? Aus meinen Lockenhaaren hat er Bänder und Zöpfe geflochten. Allbeide haben wir gemeint, wir wären brav; aber einmal sind wir doch zu lang gesessen. – Wie der Tiroler, was nenn’ ich seinen Namen! später wiederum in die Sennhütte kommt, sag’ ich zu ihm: Du, ich muß Dir was anvertrauen! und heb’ vor ihm zu weinen an. – Hat’s verstanden. Eine gute Weile sitzt er da an der Bank, stopft seine Pfeife und schlägt Feuer, bläst an und raucht. Er raucht, daß ich sein Gesicht gar nicht seh’, und sagt nicht ein einzig Wörtl. Da steht er jählings auf und geht gegen die Thür. – Wo willst[S. 191] hin? schrei ich auf. – Ein wenig hinaus, sagt er, bleib Du da! – Und wie er’s schon öfter so gemacht, wenn er was Eiliges zu thun gehabt hat, giebt er mir die Pfeife in die Hand: Froni, da, schau, daß mir dieweil das Feuer nit ausgeht. – Ich will auch nicht die Verzagte sein, nehm’ die Pfeife und thu’ ein paar Züge, daß sie nicht auslischt, bis er wieder hereinkommt. – Melchior,“ sie klopfte dem Hirten auf die Achsel, „Melchior, bis auf den heutigen Tag ist der brave Tiroler noch nicht hereingekommen, und so ist mir halt das Pfeiflein im Mund verblieben.“
„Ja,“ meinte jetzt der Bursche, „wie ist denn das gewesen?“
„Verlassen hat er mich!“ sprach das Sennermägdle; „damit ich ihm nicht nachlauf zur Thür hinaus, hat er das mit der Pfeife gethan. In sein Tirol wird er gegangen sein; ich hab’ ihn nicht mehr gesehen. In der größten Noth – das kannst nimmer glauben – hab’ ich das Kind geboren. In der Armuth, in der Verlassenheit, im Spott der Leute hab’ ich gelebt in einer Köhlerhütte; ich bin völlig allein, hab’ keine Hilf; mein Kind ist mir verdorben, und – Gott Dank, Gott Dank! – gestorben! – Jetzt hab’ ich die Tabakspfeife noch gehabt vom Tiroler, und verrückt, wie ich gewesen bin, hab’ ich gesagt: Ich will mein Wort halten und das heiße Feuer soll in Deiner Pfeife brennen, bis Du mir wieder zurückkommst. – Wär’ er gekommen, ich hätt’ ihm Alles verziehen; aber allein und unglücklich hat er mich gelassen. Mein schwarzes Haar, das mich zuerst in’s Unglück gezogen hat, das hab’ ich mir vom Haupte geschnitten, und alle Jahre hab’ ich das gethan zum traurigen Angedenken. Und auch er selber, gleichwohl er ehrlich und brav gewesen ist in seinen jungen Tagen, kann kein ruhiges Gewissen mehr ge[S. 192]habt haben. Einer einzigen Stunde wegen sind wir elend geworden Allbeide. – Die Pfeife – ja, es ist noch die seine – die hab’ ich mir angewohnt, und wie ich den Tiroler nimmer vergessen kann, so soll auch, so lang’ ich leb’, das Feuer da d’rin nicht ganz verlöschen. Und vielleicht kommt er doch noch einmal zur Thür herein; meine größte Freud’ im Himmel und auf Erden, wenn ich ihm könnt’ sagen: Da, mein Herzallerliebster, da nimm Deine Pfeife, sie brennt noch!“
Der Melchior war aufgestanden. „Ihr seid brav,“ sagte er heiser, „aber ich bin ein schlechter Mensch, ich hab’ mich mehr als einmal lustig gemacht über Eure Pfeife und über Euer geschorenes Haupt.“
„Da hast ja Recht gehabt, Du Tropf!“ rief die Alte. „Ich lach’ mich selber aus, aber ich halt’s; ich kann meine Reu und Treu nicht besser beweisen.“
Nach diesen Worten faßte sie wieder des Burschen Hand: „Melchior, jetzt wird’s bald Neun schlagen unten auf der Kirchenuhr. Sei mir ja nicht bös, daß ich da bin, aber ich wollt’ Dich nicht verlassen; es ist Deine gefährliche Stund’. – Hast mich nicht gesehen unten am Hof? Wie Du die Toni da zum Schachen her hast beschieden, bin ich nicht weit von Euch gestanden. – Jetzt will ich aber wieder davongehen; Du bist Dein eigener Herr. Nur das sag’ ich Dir, Melchior, gieb Acht, daß Du das Unglück nicht aufweckst, für Dich und für sie; es geht dann nimmer schlafen! – Und das ist der Dienst, den ich Dir erweisen kann; nimmst ihn, oder nicht. Jetzt behüt’ Dich Gott! Behüt’ Dich Gott!“
Sie hastete davon. Der Melchior Ehrlich stand allein im Schatten der alten Bäume.
Nicht lange hernach hörte er die Schellen der Ziegen. Die kleine Toni huschte dem Schachen zu.
„Hast Du sie auch gesehen, Melchi?“ rief sie dem jungen Hirten zu.
„Wen?“
„Die Hexe, die Pfingsthexe! Da über die Höhe ist sie hingelaufen, gegen die Hinteralm.“
„Das ist das – Sennermägdle gewesen,“ antwortete der Bursche zerstreut.
Sie gingen eine Weile zwischen dem Gestämm hin und wußten nicht, was sie einander sagen sollten. Beide blickten auf das braune Moos des Bodens.
„Daß aber da keine Pilzlinge wachsen!“ bemerkte endlich das Mädchen.
„’s ist noch zu früh an der Zeit,“ entgegnete der Bursche.
„Vielleicht dort im jungen Anwachs d’rin,“ sagte die Butterdirn.
Aber der Melchi wandte sich hinaus gegen die Lichtung, zog langsam die Mütze vom Kopf: „Ich denk’, Toni, wir heben an mit dem Rosenkranz.“
Falsches Geld.
Pfingsten war glücklich vorbeigegangen.
„Brav sein, dieweil!“ sagte sich der Melchior, „sie kann arbeiten, ich kann arbeiten; ’s wird geheiratet.“
Da stand wenige Wochen nach Pfingsten an einem Samstag-Abend die kleine Toni am Brunnentrog und wusch ihr rothes Röcklein. Am andern Ende des Troges saß der Melchior und rieb mit kräftiger Hand Ochsenfett in seine Sonntagsschuhe. Kam der alte, bucklige Hans mit seinen Kühen heim und brummte, weil ihn der Feierabend lustig machte, das Liedchen:
Man weiß nicht, ob es der alte Schalk mit diesem Vierzeiligen auf Jemanden abgesehen hatte, oder ob er thatsächlich an eine unvorsichtige Henne dachte. Die Buttertoni kicherte, plätscherte mit dem rothen Kittelchen, daß das Wasser bis zum Melchi hinspritzte, und sang:
Der Melchi horchte auf. Er hatte es sofort verstanden, der hölzerne Rothkropf hatte das Ringlein endlich ausgebrütet, oder vielmehr, das Mädchen hatte es in dem Vogel entdeckt.
„Sollt’s – nicht von Silber sein, Toni?“
„Hi, hi,“ lachte diese, „das Ringlein hat schauderlich die Gelbsucht.“
„Von Packfong?! O Du verdangelter Kapuziner, auch Du gehst um, Leut’ betrügen!“
„Ja, ja,“ rief die Toni und lachte nicht dabei, „was kann der Kapuziner dafür, wenn Du dummerweise seine Hergab’ für Silber hast gehalten. Du hättest aber auch so Einer werden sollen von der Gattung Kutten, die kein Geld im Sack haben dürfen, weil ihnen ohnehin all’ gut’ Sach’, die sie brauchen, zugesteckt wird.“
Sie ließ das Wasser gischten: der Bursche rieb doppelt heftig an seinem Schuh und war gar roth im Gesicht.
„Hätt’st mich nimmer gern, Toni?“ sagt er nun halblaut.
„Ei ja,“ sagte sie, „hast mir ja nichts gethan.“
Sie sah nicht mehr auf den Burschen hin, hub an, mit ihrem rothen Rock zu schwätzen, daß er ihr jetzt „weiß“ genug sei und daß sie ihn auf die Stange spannen werde.
Und als sie mit dem Waschkörbchen davon ging, schlug sie ihre Stimme über und sang:
Nun war’s doch wahrhaftig deutlich genug, die Butterdirn war aufgebracht.
Worüber nur? Weil der Ring im Vogel nicht von Gold oder Silber gewesen? Weil der Melchi kein Geld in der Tasche trug und ihr kein Taffetschürzchen kaufen konnte? – Nein, so klein denkt die kleine Toni nicht. Oder – hätte sie doch der Rosenkranz am Pfingstsonntag verdrossen?
Es verging eine Woche um die andere, die Butterdirn gab sich mit dem Melchior nicht mehr und nicht weniger ab, wie mit den anderen Mannsleuten, sie war lustig und lachte wie immer, aber ihr Lachen – wer ihm aufgepaßt hätte – scholl lauter und härter als sonst.
Der Melchior befliß sich zu zeigen, daß er ganz so sei, wie immer, und brummte seinen Ochsen zuweilen auch wohl das Liedchen vor:
Aber dann guckte er doch wieder einmal durch das Bohrloch in die Butterkammer hinein.
An Sonntagen, wenn die Toni zur Kirche hinabgegangen war, kam sie nun häufig später nach Hause als sonst, und im Hof gingen allerhand Neckworte herum vom Leisten, von der Ahle, von Schmier und Pech u. s. w., die auf die Butterdirn gemünzt waren und die der gute Melchior Ehrlich nachgerade nicht begriff.
Da stand der Bursche in einer Nacht aus seinem Bette auf und schlich gegen das Kammerfenster der Toni.
„Mein Dirndl!“ flüsterte er und klopfte an die Scheibe.
Sie schlief.
„Toni, hast mich denn nimmer gern?“
Sie schlief fest.
„Hätt’ ich Dir was Leids gethan, Toni, thu mir’s nicht verschweigen. Schau, ich bin Dir von Herzen treu.“
Jetzt öffnete sich das Fensterchen, aber anstatt aller Antwort kam der föhrenrindene Vogel mit dem Ringlein heraus. Das war auch eine Antwort.
Der Melchior sagte kein Wort mehr; er steckte das kleine Schnitzwerk in seinen Hosensack und ging langsam seinem Bette zu.
Am nächstfolgenden Sonntag wurde in der Untergäuer Kirche von der Kanzel verkündet: „Der Bräutigam Mirtel Gegerle, Schuhmacher in der Gemeinde Sterzen; die Braut Antonia Schwanner, bisher Dienstmagd im Hof auf der hohen Weid im obern Gäu...“
Man beglückwünschte die Braut, die als einfache Dienstmagd eine so gute Partie mache. Der Schuster Gegerle hatte ja Geld. Jung und schön war er zwar nicht, der Meister, hatte auch schon drei Kinder von seiner ersten und zweiten Frau im Hause; aber er kaufte seiner zukünftigen Dritten ein grünes Seidenkleid und gab ihr obendrein ein[S. 197] Antraugeld, das mehr ausmachte als ein ganzer Jahrlohn auf der hohen Weid.
„Ist auch gut,“ meinte der Melchior, „sie heiratet das Geld! mein Weib muß mich heiraten.“ – Einmal aber, als der Knecht die Sache so recht überdacht hatte, war er doch wild geworden, hatte sich in seinem Zorne die Zipfelmütze vom Haupt gerissen und sie mit den Füßen getreten. – „Geld!“ schrie er laut, „Geld! Wiederum ist es dieses Best, das mich will zugrunde richten. Meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder, meine Herzliebste hat mir das Geld gefressen!“
Der Bauer hatte es gehört. „Geh, Melchi,“ sagte er, „sei kein Narr. Geld muß der Mensch mit Geld wett machen! Wirst auch noch einmal was anfangen können, Junge; Du weißt, was Du bei mir liegen hast.“
„Mag nichts hören davon!“ schrie der Bursche und stampfte den Fuß auf den dröhnenden Boden.
Bei der Hochzeit der Butterdirn war der halbe Hochweidhof mitgewesen, auch der geknickte Zaunpfahl hatte nicht gefehlt, war sogar auf einem Ehrenplatz gesessen und hatte unerhört viel Braten und Krapfen verzehrt. Der Remini Dreihand war ein guter Freund des Bräutigams.
Der Melchior war am Hochzeitstage auf der Alm wie ein wildes Thier herumgerannt. Ueber die Heukehr war er gelaufen, wo die kleine Toni so oft die Ziegen gefüttert hatte. Aber als er am Schachen des Hochbodens vorüberging, da lachte er hell auf und die Bäume lachten mit. Eilig ging er der Hütte auf der Hinteralm zu, nahm das Sennermägdle bei der welken Hand und sagte: „Vergelt’ Euch Gott den Pfingstsonntag!“
Die Liebe blutet.
Jetzt gingen der Jahre eines und zweie und etliche dahin.
Der Melchior blieb auf der hohen Weid und war fleißig und verläßlich und arbeitete für Zwei.
In den ermüdendsten Bewegungen, im Heumähen, im Streutragen, im Brennholzspalten ging er voran und war thätig vom frühen Morgen bis in die späte Nacht. Der junge Mann meinte, das, was ihn immer so sehr in seinem Herzen drücke, sei nichts als dickes Blut, und das Blut müsse durch Bewegung und Schweiß gereinigt werden.
Er war völlig anders als sonst, er war nicht mehr heiter und gesellig, er war still und oft traurig, hielt’s mit Niemandem; ganz allein ging er um.
Vor dem Soldatenleben, das dem frischen Burschen bevorstand, hatte er sich sonst gescheut, nun wollte er am liebsten „ziehen fort auf’s weite Feld und streiten mit dem Feind“, wie’s im Liede heißt.
Den Bauer respectirte er stets als seinen Dienstherrn, des Weiteren hielt er seine Selbstständigkeit aufrecht.
Nur bei dem Sennermägdle saß er zuweilen in der Hütte. Jetzt mochte er auch ihre Tabakspfeife leiden. Andere Leut’ rauchen und wissen nicht warum; aber beim Sennermägdle hat’s eine Bedeutung. Und wie sie sich seit vielen Jahren ihr Haar vom Haupte schnitt als Zeichen der Reue und Treue, so wollte auch er, der Melchior Ehrlich, an seiner Satzung halten: keinen Heller von dem verfluchten Gelde besitzen sein Lebtag lang’.
Was war mit dem Lebkuchenherz geschehen?
Das trug der Bursche stets noch in seinem Geldbeutel. Was konnte auch das Herz für die Butterdirn!
Auch den föhrenrindenen Vogel ließ er nicht mehr aus seinem Sack, so lange er die blauleinene Hose trug; später, als er vom Bauer eine grauleinene bekam, mußte mit dem Burschen freilich auch das hölzerne Rothkehlchen übersiedeln. Das Rothkehlchen mitsammt dem Lebkuchenherz, das bereits eingetrocknet war wie die Mumie eines lieben Abgestorbenen.
So lebte und so trieb es der Knecht aus dem untern Gäu. Der schwarze Stier, der einst mit ihm heraufgekommen war, erfreute sich längst schon einer zahlreichen Nachkommenschaft auf der hohen Weid. Der Melchior war Junggeselle.
War es und wollte es verbleiben.
Der Jude wird verbrannt.
Auf dem großen Almhofe hatte sich die Zeit her Manches gewendet. Der kleine Fritz war zu einem Jungen herangewachsen, der für die Zuchtruthe des Vaters zu alt, für den Ernst der Wirthschaft noch zu jung war. Seinetwegen hatte das ganze junge Weibsvolk aus dem Hause müssen.
Der ältere Sohn des Bauers hatte es in der Stadt richtig zu einem Medicindoctor, und zwar zu einem Militärarzt gebracht, und sandte den Eltern allerlei Recepte nach Hause. Half aber nichts gegen das Alter. Die Bäuerin starb; der Bauer hatte nicht mehr die Spannkraft in sich, wie vorher.
Den Melchior hatte er längst zum Oberknecht gemacht und mehr und immer mehr kam die Wirthschaft der hohen Weid auf die Schultern des jungen Mannes zu ruhen. Nur alle Verkäufe und Einkäufe mußte der Bauer besorgen, weil sich der Melchior thatsächlich vor den Geldstücken scheute, wie ein gebrannter Hund vor glühenden Kohlen.
Zuweilen hinkte auch der alte Remini in den Hof; er machte sich immer irgend welche Geschäfte, entweder hatte er eine Botschaft auszurichten, die nirgends von geringerer Wichtigkeit war, als im Hofe; oder er fragte in seinen Angelegenheiten um Rath, den er hernach sicherlich nicht befolgte; oder er hatte dieses oder jenes auszuborgen oder zurückzubringen. In Wahrheit aber kam er nur, um Bissen und Brosamen, die in dem großen Hause abfielen, zu erschnappen oder zu erbetteln, rostige Nägel vom Boden aufzulesen und sonstige kleine Dinge, die man im Hofe für unbrauchbar hielt, mit sich zu nehmen. Er löste daraus stets ein paar Kreuzer und wollte so allmählich die Sorge „für seine alten Tage“ verringern, ein Bestreben, welches einem Remini Dreihand nimmer gelingen wird. „Ach,“ seufzte er oft, „mancher Mensch ist wahrhaftig zum Elend geboren. Mit mir stünd’s anders, hätt’ mich meine Mutter nach Amerika gehen lassen.“
„Ja, und warum hat sie denn das nicht gethan?“ fragte ihn der Melchior einmal zornig.
„Weil – weil sie mich nicht mitgenommen haben,“ antwortete der Geknickte und zog seinen dreieckigen Kopf ein, „purer Neid ist es gewesen, heller Neid von den Leuten, die dazumal ausgewandert sind. Die haben längst ihre Goldsäcke voll. Unsereiner muß bitter darben.“
Die Goldsäcke voll! Das war sein Denken und Streben, sein Glauben und sein Himmelreich.
O, Dir thät ich’s wünschen, alter Gauch, Du hättest die Goldsäcke voll und müßtest sie fortweg auf Deinem Höcker schleppen, daß sie Dich derb ritten und drückten! Das wären die Sorgen für die alten Tage! – So dachte der Melchior dem Alten einmal nach.
Nun, er, der Melchior selber, bot freilich Alles auf, um sich vor einer solchen Last zu bewahren.
Der Hochweidhofer wurde immer kränklicher; seine hohe Weid, die seine Kraft, sein Stolz, sein Leben war, wurde ihm immer gleichgiltiger. So ging er denn d’ran, das Gut seinem jüngsten Sohne zu verschreiben.
Zuvor aber beschied er den Melchior in seine Stube. Dieser nahm gar seine Mütze ab, denn der Bauer schien ihm blaß und krank zum Versterben.
„Melchi,“ sagte der Kranke, „wir Zwei haben noch was auf gleich zu bringen miteinand. ’s ist vier Jahr’ und drüber, daß Du in meinem Haus bist. Bist brav und ordentlich, bist letzt’ Zeit her meine rechte Hand gewesen. – Der Fritz merkt wohl auch, was er an Dir hat, und mir wird’s noch in der letzten Stund’ taugen, wenn ich weiß, Du wirst auch auf hinfür noch im Haus verbleiben. Hätt’s auch gern gesehen, daß Dich mein Sohn, der Doctor, des Soldatenlebens wegen untersucht und für untauglich erklärt hätt’, ’s wär’ leicht gegangen. Nu, wenn Du nicht willst! – Aber die alt’ Sach’ muß jetzt richtig gemacht werden, ’s könnt’ sonst leicht Anständ’ geben, wie’s schon geht bei den Leuten.“
Der Hochweidhofer richtete sich im Bette auf und that unter dem Kopfpolster ein kleines Packetchen hervor, das er schon früher bereitet haben mochte. Es war in weißer Leinwand und mit einer blauen Schnur umwickelt. Er hob es mit der Hand und schaukelte damit ein paarmal auf und ab, als ob er seine Schwere prüfen wollte. Dann sagte er mit leiser Stimme: „Melchi, das ist Dein Eigenthum.“
Der junge Mann erschrak fast und that seine Hände hinter den Rücken, daß sie ja nicht angreifen konnten.
„Melchi!“ fuhr der Kranke fort, „mach’ jetzt keine Albernheiten, jetzt ist keine Zeit dazu. Die Sache gehört Dein, Du hast sie redlich verdient und Du wirst sie noch brauchen! – Greif an, laß’ mich nicht so lang’ reden, Du siehst wohl, daß es mich aufregt.“
Der Melchior war gegen das Fenster gegangen und starrte nun in das Freie hinaus. – Draußen auf herbstlichem Gras hüpften gelbe Laubblätter umher; in der Stube lag ein todtkranker Mann, und da wird noch von Geld und Gut gesprochen...
Der Bursche schüttelte traurig den Kopf, er nähme nichts.
„So,“ sagte der Bauer darauf mit einer Gelassenheit, hinter der Wuth steckte, „so, also schenken, schenken willst Du’s dem Bauer von der hohen Weid!“
„Ich hab’ nichts zu schenken,“ versetzte der Melchior, „ich hab’s gut bei Euch gehabt; bei Euch im Hof ist meine schönste Zeit gewesen; ’s kommt keine solche mehr. Jetzt, wenn Ihr auch wollt versterben...“
Er wendete sich ab; die Zipfelhaube hatte er fest in die Faust geballt, jetzt fuhr er sich damit rasch über das Gesicht.
„Melchi,“ sagte der Alte, „geh’ her zu mir. Gieb mir die Hand. So, ’s thut mir gut, daß Du da bist. Mein Sohn, der streift in den Weiten herum. Der ist leichtfertig und unerfahren, ich will Dich bitten, daß Du ihm fort recht zur Seite bist. Uebrigens – kann’s auch mit mir besser werden; hätt’ ich nur erst den Winter überdauert! – Nu, wie’s Gott will. – Jetzt, Melchi, nimm das! Kränk’ mich nicht, nimm das. – Denk’ halt, ’s wär kein Geld d’rin – nur ein Angedenken –“
„Kein Geld!“ murmelte der Bursche. Darauf stand er eine Weile unentschlossen da und schließlich nahm er das Päckchen.
Aber beklommen verließ er die Stube. Er ging in die Kammer, dort öffnete er mit zitternden Händen das Packet.
Als der Inhalt offen dalag, schüttelte er den Kopf und lächelte trüb: „Hab’ mir’s gedacht, hab’ mir’s gedacht!“
Fünf Stück Hunderterbanknoten hatte er in der Hand.
Er sah sie blinzelnd an und begann so mit dem Papier zu reden: „Jetzt seid ihr da! jetzt seid ihr auch bei mir da? Wollt ihr mich auch haben? O, der Melchi, das ist der Unrechte! – Der Krug, der geht so lang’ zum Brunnen, bis er bricht – kennt ihr’s nicht, das Sprüchel? – Geld, wo ist meine Mutter, mein Vater? Geld! Du hast mir meinen Bruder verdorben, hast mir meine Liebste weggenommen! Du hast schon viele Leute zum Galgen geführt oder zum Narren gemacht. – Mein Leben und meinen Namen hast du zugrunde gerichtet, du verfluchtes, du vermaledeites Geld.“
Und während er knirschend diese Worte sprach, ballte er die Banknoten mit krampfigen Fingern zusammen; schon hob er den Arm, um den Ballen weit von sich zu schleudern, da hielt er plötzlich ein und ein Lächeln flog über sein bleich gewordenes Gesicht.
Er entwirrte die Blätter, legte sie glättend in Ordnung aneinander und steckte sie in seine Hosentasche.
Er hatte vorhin den alten Remini um den Hof schleichen gesehen; diesen wollte er nun aufsuchen.
Er eilte durch den Gemüsegarten und über die Matte quer hinab gegen den Waldrand. Und am Waldrande hockte der Alte bei einem frisch knisternden Feuer und schob Kartoffeln in die Gluth.
„Nu, Vetter,“ redete ihn der Bursche an, „wo habt Ihr heut’ die Erdäpfel gestohlen?“
„Ich? die Erdäpfel!“ stotterte der Geknickte, „gefunden –“
„Ha, ha, da drüben auf dem Acker unter der Erde, gelt! – Je nu, Gott gesegne sie Euch für die alten Tage. Ich hätt’ Euch nur fragen mögen, Remini, da, der Dinger wegen. Wißt, ich hab’ heut’ vom Hochweidhofer meinen Lohn erhalten, beiläufig so für vier oder fünf Jahr. Jetzt aber – Ihr wißt, man muß fort auf der Hut sein – bin ich so ängstlich und möcht’ genau wissen, ob die Banknoten da wohl auch gut und echt sind?“
„Na, na, das kennst Du gar gut!“ zischelte der Alte, aber als der Bursche das Geld hervorzog, da zuckten jenem die Finger, daß sie schier klapperten. „Laß ’mal sehen!“ Mit Hast und Gier erfaßte er die Papiere: „Drei – vier – fünf – hundert!“ er rang nach Athem, seine grauen, schielenden Aeuglein thaten, als wollten sie heraushüpfen auf die vornehmen Ziffern. „Blitz ’nein, Blitz ’nein,“ murmelte er fortwährend, „das ist viel!“
„Und echt wären sie?“ fragte der Bursche, indem er den Geknickten so recht von der Seite anlugte, um zu beobachten, wie die Leidenschaft in ihm wüthete.
„Echt, das ist gewiß, wie das Silber, wie das Gold, das dafür bezahlt wird!“ stieß der Remini fast fiebernd heraus, „ein schönes Geld, das! ein schönes Geld! – Der Tausend, Melchior, weit hast es gebracht, weit! – fünfhundert – auf einmal! das ist viel! – ist viel!“
„Wie man’s nimmt,“ versetzte der Bursche wegwerfend und langte wieder nach den Scheinen, „könnt’ auch mehr sein. Von fünfhundert aufwärts ist weiter, als von fünfhundert abwärts; könnt’ auch mehr sein. – Werdet aber wissen, Remini, ich bin kein Freund davon, brauch’s auch nicht.“
Bei diesen Worten zuckte gleich der lustigen Flamme des Feuers, vor dem er kauerte, eine Freudengluth über das[S. 205] aschenfarbige Gesicht des Alten. – Er ist kein Liebhaber davon? Braucht es nicht?... Der Remini ließ das Papier nicht aus den Augen.
„Echtes Geld, meint Ihr, Remini?“
„Wie nur was echt sein kann!“ krächzte der Geknickte begeistert.
Der Melchior schüttelte ungläubig den Kopf: „Will’s doch lieber versuchen. – Paßt auf!“
Hoch hob er die zusammengedrehten Banknoten und mit einem kräftigen Schwung warf er sie in das Feuer hinein.
Der Alte stieß einen gräulichen Schreckruf aus, dann tastete er mit beiden Händen in die Flammen, zog sie aber stöhnend wieder zurück. Das Papier zuckte, wand und ringelte sich in der Gluth, ein brauner Hauch zog über die weißen Blätter, jetzt brannten sie lichterloh, jetzt flatterte der graue Aschenflaum, jetzt zuckten die schwarzen Flöckchen zusammen und vergingen im Gluthpfuhl.
Der Melchior war mit gekreuzten Armen dagestanden; nicht lächelnd, sondern mit zuckenden Zügen und funkelnden Augen hatte er dem Verbrennen der Banknoten zugesehen.
Als die letzte Spur davon vergangen war, sog er einen langen, schweren Athemzug in seine Brust und hauchte: „Jetzt bist du gerichtet. Gott Lob, Gott Lob!“
Der Remini war einer Ohnmacht nahe gewesen. Aber auf einmal sprang er auf wie besessen, schlug seine Hände zusammen und schrie: „Du Narr! Du Wahnsinniger! Du Bösewicht! Jesus im Himmel, jetzt hat er das Geld verbrannt!“
„Das Geld? Nu, das Geld eigentlich nicht,“ versetzte der Bursche, „nur das Papier.“
„Vier lange Jahre gearbeitet mit schwerer Müh’!“
„Das wohl,“ sagte der Melchior, „aber die hätten diese Fetzen doch nicht mehr leichter gemacht. Und, Remini, jetzt sag’ mir einmal, wo ist denn der Schaden? Ist ein Stück Gut weniger auf der Welt, seit da die Asche fliegt? Ist meine vierjährige Arbeit auf der hohen Weid desweg verloren? Nicht ein einziger Nagel, den ich eingebohrt hab’, ist darum aus der Wand gesprungen.“
„Du hunderttausendfältiger Narr, Du selber hast den Schaden!“ rief der Remini.
„Das ist nicht bewiesen,“ sagte der Melchior, „ich hätt’ das Geld vielleicht in die Stadt geschickt, daß es Zinsen sollt’ tragen, ich wär’ ein Hirt gewesen auf der Alm wie vor und eh’ und hätt’ gelebt, wie die anderen Hirten leben, und wär’ zuletzt gestorben, wie die anderen Hirten sterben. Jeder Mensch braucht kein Geld, mein lieber Vetter Remini, und das Essen und Trinken und die Kleider wachsen aus dem Erdboden auf, und dem Erdboden ist das Geld zu schlecht, der muß Mist haben, Mist und fleißige Hände. Meine Scheidemünzen sind die Arbeitstage, mit denen ich der Welt das tägliche Brot abkaufe.“
„Jetzt hat der Mensch das Geld verbrannt!“ klagte der Alte noch immer, „ist aber das eine Schande, wo ja ohnehin das Geld gar so rar ist. – Du, Melchior! vor’s Gericht kommst! Aufhängen werden sie Dich!“
„Ha, das werden sie sicherlich bleiben lassen!“ lachte der Bursche. „O, gäb’ es nur mehr solcher Leut, die ihr Papiergeld thäten verbrennen dem Land zulieb! Das Land glaub’ ich, hat ja Nutzen davon, wenn man Papiergeld verbrennt. Ihr könnt es freilich nicht verstehen, wenn ich sag: dahier am Waldrand, unter dem freien Himmel hätte der Melchior Ehrlich, der Ehrenschmiedsohn, von seiner Jugend[S. 207] vier Arbeitsjahre seinem Vaterland geschenkt. Und er weiß, warum er’s gethan hat. – So, Vetter, und jetzt laßt Euch die Erdäpfel schmecken und denkt dabei: sie müssen echter sein, als die Banknoten; die sind verbrannt, die Erdäpfel sind nur gebraten.“
Der Melchior steckte seine Hände in die Hosentasche und trottete langsam davon.
Der alte Remini Dreihand hatte gar keinen Appetit mehr nach den Kartoffeln; endlich aber verzehrte er sie sammt den Schalen. Vielleicht war darauf doch noch irgend ein Aschenstäubchen von den verbrannten Hundertern kleben geblieben.
Die Liebe reift.
Der Bauer von der hohen Weid war noch im selben Herbste verstorben. Kaum lag er zwischen den sechs Brettern des Sarges, so dehnte sich der Junge aus – der Fritz. Er polterte und commandirte fürchterlich herum im Gehöft und nannte den „Bauer von der hohen Weid“ noch öfter, als sein Vater es gethan hatte.
Den Melchior beachtete er anfangs gar nicht; dann aber hieß er ihn nie anders, als den Halbnarren. Im ganzen Ober- und Untergäu war es offenbar, daß der junge Knecht aus Narrheit und Uebermuth seinen mehrjährigen Arbeitslohn zu eitel Asche verbrannt habe.
Viele kamen auf die hohe Weid, blos um den Narren zu sehen.
„Ist er schon selber zu dumm für ein Geld, so hätte er’s den Armen geben sollen!“ Das mußte der arme Bursche hundertmal hören.
Die Armen, die lagen ihm nun allerdings auf dem Gewissen. Er hätte Manchen aus Noth und Hunger retten können. – Ja, war’s denn aber seine Schuldigkeit, daß just er, der Dienstknecht, arme Leute aus Noth und Hunger retten sollte? – Aber er hätte es doch gethan, wäre sein Herz besser gewesen, als sein Kopf.
Ja, so rechten die Menschen vom Tage.
Keiner im ganzen Gäu hatte geahnt, was das Herz des jungen Mannes erfüllte und daß am Waldrande ein Gedächtniß- und Sühnopfer geschehen war für Eltern und Bruder. –
Auch in die Kreisstadt war die Banknotengeschichte gedrungen und die Folge davon war, daß der „Narr“ Melchior Ehrlich aus der Rekrutenliste gestrichen wurde.
Und so sind dem braven Burschen für die vier verbrannten „Arbeitsjahre“ elf andere geschenkt worden.
Der Melchior sah bald ein, daß unter der neuen Herrschaft seines Bleibens als „Narr“ auf der hohen Weid nicht länger mehr sein könne. Er nahm seine paar Sächelchen, schnitt einen guten Stecken aus dem Lärchenanwuchs des Schirmschachens und zog fürbaß.
Er zog in die Gegend von Sterzen hinab; dort kehrte er beim Schuhmacher ein.
Er hätte es nicht gethan, aber er hatte es gehört, was im Schuhmacherhause geschehen war. Der Meister Gegerle war an der Auszehrung gestorben. Darauf war ein Mann gekommen mit einem großen Schuldbrief und vielen Zinsbögen und hatte alles Hab und Gut der Witwe davonschleppen lassen. Dieser Mann war der Freund des Verstorbenen gewesen und hieß Remini Dreihand.
Jetzt stand die arme Toni da, hatte nichts als ein leeres Haus und die drei unmündigen Kinder ihrer Vorfahrinnen. Ihr grünes Seidenkleid war auch dahin; ihre Augen waren roth; oft in den langen Nächten, wenn sie im Bette saß und nähte, dachte sie an die schöne Zeit, da sie beim Bauern Butterdirn gewesen.
Trat denn eines Tages in dieses Haus der Melchior Ehrlich ein. Die Toni that einen hellen Schreckruf, der auf der hohen Weid für ein lustig Jauchzen gegolten haben würde.
Darauf stand sie wie versteinert still und wußte nicht, sollte sie rückwärts treten und sich verbergen in der leeren, finsteren Lederkammer ihres Mannes, oder vorwärts, und dem guten alten Bekannten die Hand schütteln.
„Melchi,“ sagte sie endlich leise, „Du suchst mich heim?“
„Such’ Dich nicht heim,“ antwortete der Bursche. „’s führt mich nur mein Weg vorbei, und weil ich hungrig geworden bin, so hab’ ich mir gedacht, klopfst an um ein klein Stückel Brot.“
Jetzt sprang das Weib mit Ungestüm über ihn her, nahm ihn um den Hals und rief: „Melchi! Alles, was mein Tisch kann bieten, soll Dir aufgewartet sein. Mich freut’s zu tausendmalen, zu tausendmalen!“
Der Melchior saß fröhlich bei Tisch und aß ein weniges von der Milch. Sie strich ihm Butter auf ein Stück Brot.
Er nahm’s und sagte: „Für das ganz extra mein Vergelt’s Gott! Gelt, das ist eigene Wirthschaft, das wird schmecken.“
Und er steckte bedächtig den Mund voll, daß er für eine Weile stumm war und die Toni Zeit hatte, sich aus ihrer[S. 210] kleinen Verlegenheit wegen der Erinnerung an eine abgelehnte Butterschnitte auf dem Hochweidhofe wieder zu erholen.
Zwei halb erwachsene Mädchen und ein kleiner Knabe waren im Hause. Dieser war bald mit Melchior gut Freund, stieg auf die Bank, auf welcher Letzterer saß, ließ die Quaste der Zipfelmütze tanzen, zupfte gleichwohl noch vorsichtig und sachte an dem Ringellockenhaar des Mannes, an seinem falben Schnurrbärtchen endlich, und zuletzt entschloß sich der Kleine nach langem Saugen am Zeigefingerchen zu dem verlockenden Wagestück, in den Kleidertaschen des Gastes ein wenig Sichtung zu halten.
Die junge Hausfrau suchte Alles aufzubieten, um die Armuth des Hauses möglichst zu verbergen – aber das böse Gespenst lugte doch aus allen Winkeln hervor. Der Melchior bemerkte nichts und war lustig. Und die Toni kam aus einer Verlegenheit in die andere; sie wollte mehrmals versuchen, so frisch und keck wie einst aufzulachen, aber es ging nicht mehr.
Plötzlich jedoch stieß ihrerstatt der kleine Knirps ein mächtiges Gejohle aus und hoch in seinen Händen schwang er – den föhrenrindenen Vogel.
Diese trautsame Erscheinung veranlaßte jedoch vorläufig nicht viel Heiteres. Die Toni legte ihr Haupt an Melchior’s Brust und schluchzte.
„Wie lang’ ist’s her, daß Dein Mann gestorben?“ fragte der Bursche.
„Gut über ein halbes Jahr.“
„Na, nachher wird das Flennen, mein’ ich, nicht mehr nöthig sein,“ versetzte der Schalk. „Und was meinst Du, Toni, weil denn dieser närrische Vogel allweg noch lebt – was meinst, wir fingen ihn noch einmal ein?“
Jetzt war das Lachen da. Es war wieder da, es war so hell und weich wie einst, es wollte nicht enden, und die Augen standen in hellen Thränen.
„Nein, das ist wahr!“ schluchzte sie endlich, „Du bist ein herzensguter Bub!“
„Weißt, Toni,“ sagte der Melchior, und war auch selbst verlegen geworden, so daß er mit seinen Schuhspitzen viel zu laut am Trittbrett des Tischschragens klöpfelte, „ich weiß jetzt mit meiner Zeit nichts anzufangen. Auf der hohen Weid freut’s mich nimmer und zu den Soldaten wollen sie mich auch nicht nehmen.“
„Hast einen Fehler?“ fragte sie theilnahmsvoll.
„Hier drin, meinen sie, müßt’s hinken,“ versetzte der junge Mann und stemmte seine beiden Zeigefinger auf die Stirn.
„Ich hab’ gehört, daß Du so theures Brennholz heizen thätest,“ bemerkte das Weib und machte sich mit dem Kleinen zu schaffen, den sie nach und nach mit Ernsthaftigkeit und Liebkosungen aus dem Stübchen schob.
„Festweg, Toni, brauchst Dir keine Sorg’ zu machen, das ist vorbei,“ sagte der junge Mann und klöpfelte; „unser Häusel thäten wir schon mit Scheiterholz auswärmen. – Wohl wahr, wir hätten die fünf Hunderter leicht anwenden können; aber für’s Erst’ hab ich meinen Zorn auslassen wollen gegen das Geld, das mir allerlei böse Tage gemacht und zuletzt gar mein Herzlieb davon geführt hat. Und für’s Zweit’, Toni, möcht’ ich gern wissen, was denn wohl der Melchior – frisch und gesund und bald dreiundzwanzig Jahr’ alt, bisher Halter auf der hohen Weid, just für sich, nach der Elle oder nach dem Pfund gemessen – werth sein kann.“
Er schwieg ein wenig, sie wußte auch nichts zu sagen. Nein, sie hätte schon was gewußt. Es war ihr wohl heiß um’s Herz.
Der Bursche zog sein Geldbeutelchen aus der Tasche; „’s ist nicht ganz leer, Toni,“ sagte er. Das Lebkuchenherz war drin.
„Und nachher, weißt,“ rief er und stemmte seinen Ellbogen fest auf den Tisch, „weil’s vorbei ist, was vorbei ist, so seh’ ich jetzt wohl ein, daß der Mensch ohne Geld halt doch einmal nicht recht wachsen will. Mir thut das in die Länge wachsen nimmer noth, aber in die Breite gehen möcht ich. Jetzt wär’ das schon recht, hätt’ ich mir vor Zeit das Geld nicht abgeschworen für all’ mein Lebtag. Was man schwört, muß man halten, und jetzt denk’ Dir, Toni, so steh’ ich da. – Hab’ mir aber schon was ausgetipfelt, Toni, wollt’ mir nur wer dabei helfen. – Heiraten muß ich, ’s giebt sonst kein Mittel für mich. Ich will auf dem Gütel arbeiten, oder im Tagelohn, oder draußen im Dorf, oder drin im Wald, oder auf der Alm. Ich schick mich in Alles, und mein Weib, das wird das Geld dafür in die Hand nehmen und damit machen, was sein muß. – Was meinst, Toni, ist der Rath zu brauchen?“
„Ja,“ sagte das Weib und räumte den Tisch ab, „zu brauchen – – zu brauchen ist er schon.“
„Und – und willst Du mein Geldbeutel werden?“ fuhr es dem Burschen heraus.
Wieder das Lachen und die Thränen – viele Thränen – lautes Schluchzen, so daß der Knabe draußen erschrocken zu seinen Schwestern lief: „Geht geschwind, der fremde Mann, der thut der Mutter was!“
Gutes Geld.
So hat sich’s zugetragen mit dem Geldfeind, mit dem Melchior Ehrlich – dem Ehrenschmiedsohn. Er hat sein altes Lieb, die Rothkitteldirn, geheiratet.
Ueber der Thür des Häuschens war ein hölzerner, grün angestrichener Stiefel gehangen; der mußte herab. Es wohnte kein Schuster mehr im Hause. Ein paar Gärten und Aecker waren dabei und die Wirthschaft war ein Bauerngütchen geworden. Die Leute drin arbeiteten mit Lust und Fleiß, und nach und nach füllten sich die Räume wieder, die der geknickte Zaunpfahl so hämisch ausgeleert hatte.
Von den Kindern des verstorbenen Gegerle ist auch nur Gutes zu sagen.
Die beiden Jungfrauen verheirateten sich, der Knabe kam auf die hohe Weid als Hirtenjunge, mit dem leichtlich die Idylle wieder anhebt. Es ist das alte leichtherzige Leben im Hofe auf dem Rochusberge, nur schier noch ungebundener als unter dem alten Bauer. Das Familienleben zwischen Mensch und Vieh wird einträglich fortgeführt. In der Butterkammer wirthet manch’ heitere Magd, über die Weiden der Heukehr springen und scherzen die Ziegen und die Kälber. Auf dem Hochboden steht noch der Schirmschachen und der Anwachs ist höher geworden und spendet noch immer den freundlichsten Schatten. Freilich wackelt das Sennermägdle allzu selten vorüber.
Aber es lebt noch, das Sennermägdle auf der Hinteralm. Es waltet die Heerden, es ist völlig frisch; es wartet immer noch auf den Tiroler und saugt und saugt an dem Pfeifchen, auf daß das Feuer nicht sollt verlöschen.
Einen traurigen Ausgang hat es mit dem alten Remini Dreihand genommen. Der ist eines Tages todt in seiner[S. 214] Klause gefunden worden; er hing am Staffel seines Bettes. Man wußte nicht, weiß es heute noch nicht, ob sich der alte Geizhals aus Sorge um „seine alten Tage“ selbst erhenkt hat, oder ob er durch Mörderhand erdrosselt worden. In dem wurmstichigen Schrank der finsteren Klause fand man nicht einen Heller Geld, aber unter der Bettstatt, tief in die schwarze Erde gegraben, wurde bei der Untersuchung ein Ledersack entdeckt, in dem altes, schweres Silber lag.
„Der,“ sagten die Leute, „der ist der Geldfeind gewesen; er hat es lebendig begraben.“
„Und der Menschenfeind dazu!“ riefen Andere.
Da erhob bei der Bestattung des alten Mannes der Pfarrer das Wort: „In jedem Menschenherzen schlummert ein Dämon. Möge Jeder denselben bekämpfen mit seiner Kraft und wachen! Des Herrn Gnade sei mit uns Allen!“
Das ehemalige Schuhmacherhäuslein auf der Sterzen mit den dazu gehörigen Grundstücken heißt jetzt das Ehrengut, nach dem Namen des Besitzers Melchior Ehrlich. ’s geht fröhlich drin zu; ein kleiner Melchi und ein kleines Tonerle purzeln auf dem Boden herum und schlagen johlend die Beinchen in die Luft und streiten wohl auch zuweilen mit Händen und Füßen um des Vaters bunte Zipfelmütze. Das Lebkuchenherz und das föhrenrindene Rothkröpfchen möchten sie auch wohl gern haben; aber diese Dinge hängen hoch oben im Winkel des Hausaltars, und die Mutter sagt: „Kinder, das kriegt Ihr erst, wenn Ihr groß seid!“
Die Toni weiß das Geld, welches ihr der Mann stets redlich in’s Haus schickt, prächtig zu handhaben und damit für die Familie allerhand Gutes und Liebes zu stiften. Da kommt der Melchior wohl auch zur Ueberzeugung, das Geld kann nur auf zweierlei Weise Unheil stiften: erstens, wenn[S. 215] es in die Hand des Boshaften und des Leichtfertigen geräth, zweitens – wenn es der Brave nicht hat.
Eines Tages – ’s ist noch nicht lange her – hat der Melchior eine sehr überraschende Nachricht aus der Hauptstadt erhalten. Der Sohn des Hochweidbauers, den er einst auf dem Hofe kennen gelernt hatte, theilt ihm mit, daß die Strafzeit des vormaligen Forstadjuncten Kilian Ehrlich zu Ende gehe und daß beschlossen worden sei, den talentvollen Mann in „des Kaisers Geldwerkstätte“ aufzunehmen.
„Juchhe!“ jauchzt der Melchior, „jetzt ist’s gut. Mein Bruder selber macht echte Banknoten. Her damit, ich kann sie brauchen!“


Wahrhaftig, wenn um die Hütte nicht einzelne, gelbe geringelte Ahornblätter herumgelegen wären, man hätte gemeint, es sei ein Juni-Abend.
Dieser Flechten- und Moosteppich, der sich über Erde und Gestein hinzog und sich an alle Glieder des Waldes schmiegte, mußte von den fleißigen Rosenfingern des Mai gewoben sein. Die hohen Fichten und Tannen hatten noch keine einzige ihrer Millionen Schmucknadeln, die sie vom Frühling erhalten, weggeworfen; sie standen gar stolz da in ihren dunkelgrünen Mänteln, jede hatte eine Krone auf, und sie standen so nahe beisammen, daß sie ihre Arme in einander verschlingen konnten. Selbst die kahlen Stämme hatten bis zu den ersten Aesten hinauf ihren Schmuck; ihre grauen und braunen Rinden waren so nett und verschiedenartig gezeichnet und geschnitzt, daß man meinte, die ganze Weltgeschichte sei in Holzschnitt da. Die kleine Wiese zwischen den hohen Bäumen, die rechts am Bache liegt und bis zur Hütte herausgeht, wollte auch noch Gutes thun; sie trieb mehr des jungen Grases, als die zwei weidenden Ziegen verzehren konnten, und am Rande des Wassers hatte sie einen zierlichen Wald von Farrnkräutern. Wie war denn dem kleinen Acker jenseits am Rain, den der Mirtl (Martin) durch[S. 217] Axt und Brand der Wildniß abgerungen, bis er, sorglich gepflegt, statt wilden Gesträuches volle Garben gab? Ihm war, als habe er noch zu wenig gespendet, und er trieb neue Keime.
Es war, wie an einem Juni-Abend, nur viel stiller und feierlicher; man konnte es weithin hören, wenn ein Ast seufzte. – Ein alter Ahorn stand auch im Gebirgsthal, aber der hielt sich hinter den drei Tannen, welche die Hütte, Mirtl’s Daheim, beschützten, verborgen, weil er keine grünen Blätter mehr hatte; diese waren ihm gestorben und abgefallen und nun hüpften sie in allen Farben und Ringelformen herren- und obdachlos im Thale aus und ein. Es kam heute dann und wann ein leiser Windstoß in das Thal, die Wolken waren weiß und „lämmerlich“ und gingen über das kleine, von hohen Bergen begrenzte Stück Himmel dahin, und vom Hochwald hernieder rauschte es.
Im Thale begann es bereits zu dämmern und der Mirtl saß auf dem Bänklein vor der Hütte und schärfte seine Axt mit einem Schiefer und befestigte sie dann an der Kraxen (Trage von Holz), auf welche bereits Mehlsack, Schmalzbutte, Hafen, Pfanne und verschiedene andere Gegenstände, wie sie der Holzknecht die Woche hindurch auf dem „Schlag“ benöthigt, gebunden waren. Mit dieser Beschäftigung fertig, stellt Mirtl die Kraxe in die Hütte, setzt sich behaglich auf die Bank und schlägt Feuer für sein Abendpfeifchen.
Mittlerweile hat sein Weib die Ziegen, die schon lange um die Hütte herum und sogar rückwärts auf das schiefe Rindendach gestiegen waren, in den Stall gethan, und war eben beim Melken für Abendsuppe und Frühstück, wenn der Mirtl morgen fortgehe. Dabei sang es einen „Almer“, den[S. 218] der Holzknecht vor dem Häuschen mit einer nicht unebenen Baßstimme schmunzelnd begleitete, bis ihm derweil sein Pfeifchen ausging.
Plötzlich klopfte es von innen an das kleine Fenster und hinter dem Glas wurde das gemüthliche Gesicht eines alten Mütterchens sichtbar: „He, Mirtl, wo sind denn heut’ die Kinder so lang’; geh’ schau ein wenig und bring sie heim; ’s geht auf einmal der Wind rechtschaffen kühl.“
„Nun, wird Euch schon zeitlang, Mutterl?“ entgegnete der Angesprochene, indem er aufstand, die Finger in den Mund steckte und pfiff. Nur der Wald gab Antwort, sonst blieb es still, bis Mirtl den Ruf wiederholte.
„Was hast denn, Mirtl, sind ’leicht die Kinder noch nit da?“ schrie die Melkerin vom Stall hervor; aber der Mann war schon auf und fort, er erinnerte sich, daß die Kleinen seit frühem Nachmittag nicht mehr um die Hütte waren. Es war schon dunkel. Auf der Wiese stand er still und blickte umher und horchte. Vom Lahmkogel hörte er das Bellen eines Rehes und im Hochwald rauschte der Wind. Sonst war Alles ruhig.
Dem Mann wurde bang, er pfiff noch einmal, dann rief er: „Hansl! – Julerl!“
Ach, der Wald, wie er immer höhnend nachsprach und wie er so schwarz und finster dalag, als berge er Unglück in sich.
Mirtl eilte weiter, er lief gegen die Schlucht und rief in Einem fort die zwei Namen. Vergebens. Es wurde finster. Der Holzknecht betete: „Jesus Maria!“ in seinen Gedanken, und dann wurde ihm leichter und er dachte, es werde doch nicht sein. Aus der Schlucht hörte er das Rauschen des Bächleins, das dort einen Wasserfall bildete.
Und mit dem Wasserrauschen schlug plötzlich der Laut einer Kinderstimme an sein Ohr. Dann horchte er und pfiff und schrie und hörte nichts als Wind- und Wasserrauschen. Mirtl eilte in die Schlucht, und auf einmal – o, welch’ freudiges Aufwallen! – ganz nahe hörte er die wohlbekannten, fröhlichen Kinderstimmen. Sie saßen am Bach, waren beschäftigt, aus den Steinchen und Holzstückchen ein Häuslein zu bauen und eine Mühle, wie sie der Anbauer weit draußen im Dorfe hatte, bei dem sie schon einmal waren mit dem Vater, als er Korn hinaus- und Mehl hereintrug. Jetzt wollte der Knabe auch noch das Wasser in die Mühle leiten, er war ja Müller und das Schwesterchen, das war der Vater, der das Korn brachte – „He da!“ rief er, da stand er vor ihnen. „Wart’ ich werd’ Euch helfen, wenn Ihr nit heimgehen wollt; marsch, gleich auf der Stell’; wißt Ihr nit, wann es Zeit ist und wo Ihr hin g’hört – ich möcht’ gleich die Ruthen nehmen!“
So zürnte der Vater und die Kinder rafften sich erschrocken auf. Sie hatten früher seine Stimme ja nicht gehört, weil das Wasser rauschte, und jetzt sahen sie es erst, daß es bereits dunkel war. Sie hatten ihn böse gemacht, wußten sich keinen Rath und schluchzten. Aber der Mann hob jetzt die Kleinen an seine Brust, und ohne ein Wort mehr zu sprechen, hielt er sie fest – fest. – Sie waren ja sein Alles – sie waren sein Alles auf Erden!
So trug er sie nach Hause, und daheim am Herdfeuer wurden die nassen Kleider der Kleinen und das Auge des Mannes bald wieder trocken.
Der Wind rüttelte am Fenster, und bei der Abendsuppe, die den Kleinen heute doppelt schmeckte, weil ja auch der Vater wieder gut war, meinte nun Mirtl, es würde[S. 220] schlecht Wetter machen, dann werde es diese Woche zum Holzen.
„Das ist mir schon allemal zuwider, wenn es zum Holzen ist!“ sagte das Weib halb wehmüthig, halb unmuthig, „man muß sich die ganze Woche grämen; ’s vergeht halt doch kein Jahr, daß nit ein Unglück geschieht.“
„Geh, geh, Waberl (Barbara), denk auf den Oberen!“
„Vergiß das Zellerkreuzl (ein Kreuzchen aus Maria-Zell) nit, Mirtl!“ mahnte die Großmutter, während sie die Kinder auszog und dieselben dann in’s gemeinsame Bettchen an der Ofenbank brachte.
„Und sonst fehlt nichts daheim?“ fragte der Holzknecht, indem er die braune Schwarzwälderuhr aufzog; – „daß ich nichts vergeß, morgen muß ich zeitlich auf – ein Salz ist noch?“
„Na, das werd’ ich schon machen, Mirtl; schau, daß Dir nichts abgeht. Nimm den Lodenrock und ein wenig Branntwein mit. Da steck’ ich Dir einen englischen Balsam und eine Kräutersalben ein, daß Du zum Fall doch was nehmen kannst. Den Tabak hast?“
„Bei Leib, den vergiß ich nit. Wenn ich nur einen Tabak hab’, um’s Andere frag’ ich nit viel. Eines muß ich Dir noch sagen, Waberl: gieb auf die Kinder acht – schau, ich bin heut so sterbens erschrocken, wie ich sie nit gleich gefunden hab’, ’s kann bald was sein! Und noch was, diese Wochen ist Niklo, draußen im Kasten unter’m Korn hab’ ich Aepfel und ein paar Lebzelten, die steckst den Kindern in die Schuh, und der Mutter hab’ ich ein Kopftuch gekauft, das legst ihr auf’s Fenster neben ihrem Bett. – Und Du, Waberl, kriegst zum Niklo erst Samstag was, wenn ich heimkomm’,“ setzte der Mann schelmisch hinzu und strich seinen Schnurrbart.
Bald darauf war der Kienspan im Holzknechthäusel verloschen. –
Julerl wurde zuerst wach. Sie sah, wie es so licht war in der Stub’ und draußen, und Alles so weiß. Sie wußte es gleich, sie sah es ja, wie sie noch immer herabfielen die weißen Vögelchen. Sie hüpfte vor Freude im Bettchen und zwickte den Hansl, daß er auch erwache, und flüsterte ihm in’s Ohr: „A Schneewerl hat’s g’schneibt, a Schneewerl hat’s g’schneibt!“
Und als die Kinder angezogen waren – Julerl durfte heute das neue Lodenjöppel, das sie von der Pathin im Dorf erhalten hatte, tragen – warteten sie gar die Suppe nicht ab, so eilten sie in den schneienden frostigen Tag hinaus. Der Knabe wollte des Vaters Griesbeil nehmen, weil es spitzig war, und mit demselben allerhand Dinge auf den feinen Schneegrund zeichnen; aber das war schon in aller Früh mit dem Vater fort, weit hinaus in den großen Raitschlag, wo heuer der Baron Wald schlagen ließ und dreißig Holzknechte beschäftigte. Das war ein wahres Vergnügen für die Kleinen, wie sich ihre Fußtrittchen und Finger so rein und nett in den weichen Schnee eindrückten und wie sich aus demselben allerlei Männlein formen ließen, die sie auf die Bank stellten, wo sonst der Vater so gerne saß. Viel Spaß machten die großen Flocken, die langsam um die dunklen Tannen tanzten, und von denen Julerl kaum erwarten konnte, bis sie herabkamen. Dann langte sie mit den Händen nach denselben oder hielt wohl gar das Gesicht so, daß die kalten, wunderlichen Blättchen auf ihre rothen, warmen Wangen fallen konnten, bis Großmutter sagte, daß das gar nicht gesund wäre. „Mußt die Flankerln in Ehren halten, Kind,“ sagte sie dann, „das sind[S. 222] Brieflein, die der liebe Herrgott im Himmel oben schreibt und zu den Menschen herabfallen läßt, daß sie auf ihn nit vergessen!“
Das fand nun das Mädchen so merkwürdig und lieb, daß sie es gleich dem Hansl sagen ging, worauf dieser nach einer recht großen Flocke haschte, um einmal ordentlich zu untersuchen, was denn darauf stünde; aber sie zerging ihm in der Hand, und er hatte nur einen hellen Wassertropfen.
Als die Mutter auf den Mittag Feuer anmachte und über das Dach des Häuschens blauer Rauch stieg, dachte sich Julerl, daß das eigentlich nicht sein sollte, weil ja die Himmelsbrieflein schwarz würden.
Das Schneien hielt an und die Kinder waren schon ganz naß, als sie die Großmutter zu Mittag in die Hütte brachte. Sie selbst fühlte Frost und bat die Waberl, ihr die Suppe heute an ihr Ofenbänklein zu bringen.
Nach dem Essen, als Waberl im Stall und am Herd fertig war, brachte sie einen Strohschaub und einen Bund Weidenruthen in die Stube. Daraus flocht sie Brot-, Zeug-, Näh- und Strickkörbe, die sie recht geschickt und zierlich zu formen verstand und welche für den Winter ihren Erwerb bildeten. Weit draußen, wo die hohen Berge aufhören und die Mürz fließt, wachsen die Weiden, und Mirtl brachte, wenn er von der „Rait“ kam, immer einen Bund davon mit.
Die Kinder mußten Späne klieben und das Mädchen versuchte sich mitunter auch im Flechten, was aber immer viel zu locker wurde, weil seine Finger noch zu schwach waren. Der Hansl machte sich an die Großmutter; sie sollte wieder Märchen erzählen, oder sonst was, sie konnte so schön, daß man sich gar nicht satt hörte, und die Kinder[S. 223] aufjubelten oder sich nach Umständen wohl gar zu fürchten anfingen.
Die Großmutter wußte Sachen, die sich in der Gegend zugetragen hatten.
Wie’s draußen aussah, das wußte sie freilich nicht; sie war ihr ganzes Leben in diesem Thale und kam nie weiter, als in’s Dorf und zur Kirche hinaus. Nur einmal, als sie noch jung war und in Zell eine „Ehrmesse“ (Primiz) gehalten wurde, war sie mit ihrem Manne dort. Das war so weit, daß sie unterwegs einmal bei fremden Leuten über Nacht bleiben mußten. Sonst hatte Großmutter von der Welt nichts gesehen und meinte, es werde auch nirgends so schön und gut sein als daheim im kleinen Thal bei den hohen Bergen. – Ihr Vater soll das kleine Haus vor der Schlucht, deren Felsen vor Wind und Wetter schützten, erbaut und sich von Wurzelgraben ernährt haben. Als er starb, erhielt sie das Häusl und heiratete einen jungen Mann, der oft in die Gegend kam, allerlei Kräuter sammelte und aus den Ameishaufen den „Waldrauch“ herauszog; mit letzterem trieb er Hausirhandel und setzte dieses Geschäft fort bis zu seinem Tod. Es war schon manches Jahr um, seitdem man ihn aus der Hütte fortgetragen hatte, da übernahm der einzige Sohn, der Mirtl, die Wirthschaft.
Aber der Mirtl befaßte sich nicht mehr mit den Wurzeln und Kräutern, sondern machte ein Flecklein Wald urbar, worauf Korn und Erdäpfel wuchsen. Am Bache, wo Wachholder- und Hagebuttensträuche wucherten, haute er diese aus und verbrannte sie an der Stelle, damit durch das Feuer auch die Wurzel getödtet werde. Darauf grub er den schwarzen Grund um und legte Gras- und Kräutersamen hinein, so daß in zwei Jahren fußhohes Futter wuchs. Jetzt brauchte[S. 224] er die Ziegen nicht erst in den Wald fortgehen zu lassen und sie den Gefahren vor Jägern und wilden Thieren oder eines Absturzes auszusetzen.
Wie Mirtl nun seine kleine Wirthschaft im Gedeihen sah, heiratete er ein armes Mädchen von Marwänden herüber, und die junge Hausfrau legte auch noch einen Gemüsegarten an und putzte das Häuschen heraus, daß es eine Freude war.
Da kam eines Tages der herrschaftliche Förster in das Thal und sah sich die Sache an und fragte den Mirtl, wer ihm denn erlaubt habe, hier auf fremdem Grund und Boden so zu wirthschaften. Der Wald und das Thal und Alles gehöre dem Baron von Scharfenthal und die Hütte stände nur aus Duldung da. Wolle er, der Mirtl, hier anbauen, so habe zwar der Baron nichts dagegen, nur müsse er sich zu Robot in den herrschaftlichen Waldungen verpflichten. Das hatte Mirtl zusagen müssen, sonst wäre ihm Alles weggenommen und zerstört worden.
Da nun aber draußen an der Mürz, wo der Baron Werke und Hämmer hatte, viel Holzkohlen verbraucht wurden, nahm der Waldherr Holzleute auf und schickte sie mit glänzenden Aexten in seine Hochwälder.
So hatte auch Mirtl – der nun nicht mehr gezwungen war, bei der alten Mutter zu Hause zu bleiben, weil sie und auch das Hauswesen die arbeitsame Waberl versorgte – im „Schlag“ Arbeit erhalten und erhielt Taglohn. Es that den Leuten daheim in der Hütte recht weh, wenn sie an den Hausvater dachten, der mit Schweiß und Lebensgefahr bei karger Kost die langen Tage draußen waltete und sich opferte für die wenigen Groschen, die er seinem Daheim brauchte, und zum Vortheile eines reichen Mannes, der mit dem abgekargten Lohn des Arbeiters seine Hunde fütterte.
Waberl blickte trüb in den schneienden Nachmittag hinaus. Sie ließ ihr Flechtwerk ruhen, sie flocht und wob ihre Gedanken in den Winter, in die traurige Zeit, die heuer so lang’ ausgeblieben und doch gekommen war.
„An was denkt Ihr denn, Mutter? denkt Ihr, daß der Winter viel schöner ist, wie der Sommer?“ Das sinnende Weib gab dem Knaben, der so fragte, keine Antwort. Es ging nun, der Großmutter ein Strohpolster unter das Haupt zu legen, weil diese bei ihrer Ofenbank eingeschlafen war.
Nun mußten die Kinder mäuschenstill sein, und sie schlichen auf den Zehenspitzen in das Vorhaus, wo sie wieder laut plaudern und scherzen durften.
Am nächsten Tag blieb die Großmutter im Bett, weil sie in Folge einer kleinen Verkühlung ein wenig unwohl war. Sie war aber recht heiter und unterhielt die Kleinen, die heute doch nicht mehr ausgehen konnten, denn der Schnee war schon so tief geworden.
Die langen Aeste der Tannen hingen schwer nieder und die Zaunstecken des Gärtchens hatten hohe Hauben auf. Nur zur Noth ließ sich der Schnee noch ausfassen, wenn Waberl vom Bächlein Wasser holen wollte. Das Bächlein war auch schon so verschneit, daß man es gar nicht sah und hörte, sondern es wie durch einen Kanal still dahin sickerte. Sonst war das Wetter nicht kalt, und es ging auch kein Wind, nur war der Himmel fortwährend grau und schwer.
„Aber die Knecht’ werden ja völlig nit arbeiten können,“ meinte Waberl zur Großmutter, indem sie mit einem Besen den Schnee von den Schuhen kehrte. „Dann kommt der Mirtl noch vor dem Samstag heim,“ entgegnete diese, „das Holzen geht doch nit.“
Großmutter blieb im Bett, es wäre ihr nur ein bischen kühl und schwach, und versäumen thäte sie ja nichts. –
So verging der erste Theil der Woche, und als es Donnerstag Morgens wurde, war eine große Freude in der Hütte.
Die Kinder konnten in die Schuhe nicht hinein.
Oh, sie hatten gar nicht daran gedacht, oder hatten geglaubt, er könne in diesem Wetter doch nicht kommen. Es war Niklo, und der heilige Bischof war in der Nacht da gewesen und hatte Aepfel und Lebzelten in die Schuhe gethan und der Großmutter ein schönes, buntes Kopftuch auf das Fenster gelegt. Julerl getraute sich die rothen Aepfel gar nicht zu essen, sie meinte, es sei schade, weil sie im Paradies gewachsen wären. –
Allein, so selige Freude heute auf den frischen Gesichtchen der Kleinen glänzte, so schwerer Kummer lag auf dem Herzen der Hausfrau. In Sorge stand sie mit der Schale Hollunderthee vor der kranken Großmutter und bot ihr zu trinken. Diese trank ein wenig und mußte immer wieder einschlafen, wenn sie geweckt wurde. Sie war so müde. Mitunter lispelte sie leise, daß ihr Sohn kommen möge, und daß ihr kühl sei. Dabei hatte sie eine glühende Stirne und heiße Hände. Waberl legte der Kranken Sauerteig auf, daß die Hitze vergehe. Die Großmutter ließ es geschehen, und einmal sagte sie, wie im Träumen, jetzt werde sie wieder jung und habe rothe Wangen wie vor vielen Jahren, als sie den Josl zum Mann genommen. Er sei zwar schon gestorben, aber sie werde ihn doch wieder nehmen.
Ueber Nacht war sie so geworden, und Waberl wußte sich vor Angst nicht zu helfen, und sie ging in den Ziegenstall und weinte und betete, daß ein Schreckliches doch nicht über[S. 227] ihr Haupt kommen möge. Mit Angst und Hoffnung sah sie dem Samstag entgegen. Wenn doch nur das Schneien aufhörte, daß nicht etwa alle Wege und Pfade – sie wagte das Weitere gar nicht zu denken, – und der Schneefall dauerte fort.
Es waren keine großen, breiten Flocken mehr, die da fielen, nein, es war wie ein dichter Nebel und Staub, was nun niederging, daß man selbst die nächsten Bäume kaum sehen konnte. Das Bänklein vor der Thür war längst unter Schnee, und Waberl meinte bei sich, jetzt müsse es doch bald aufhören, denn über das Bänklein sei der Schnee sonst auch in dem tiefsten Winter selten gegangen. Die zwei Nebenfensterchen in der Stube, die gegen die Schlucht sahen, waren bereits verschneit, und wenn man durch die anderen hinaussah, hatte man die gleiche Schneehöhe mit den Fenstern, so daß der Hansl einmal verwundert ausrief: „Mutter, unser Haus ist in die Erden gesunken!“
So war es Freitag Abend geworden und das Schneien hatte endlich aufgehört. Nun, da man wieder klaren Blick hatte, sah man erst die ungeheueren Schneemassen, die im Sonnenuntergehen gar rosig schimmerten. Fremde Vögel flatterten auf den Bäumen umher, wie man sie sonst nie in der Gegend sah, und sie hatten ein gar eigenes Gezwitscher.
Später wurde es ruhig und es ging der Mond auf. Auch die Sterne sah man; es war eine heitere Nacht.
Waberl saß am Bette der Kranken und blickte traurig auf die abgespannten Züge. Sie schlummerte, nur als jetzt der Mondschein langsam auf ihre Wangen rückte, erwachte sie und lächelte. – „Er sieht mich schon an,“ lispelte sie, „aber er hat ein bleiches Gesicht. – Die Sonne, die möcht’ ich wohl auch noch einmal sehen![S. 228]“Die Großmutter sagte dieses mit einem Ton, der die arme Waberl schier zum Tode erschreckte. Waberl verhüllte darauf das Fenster mit einem blauen Tuche, daß der Mond nicht so hereinscheinen konnte.
„Gelt, die Kinder schlafen schon?“ fragte dann die Kranke vollständig wach.
Sie ruhten neben in ihrem Bettchen, wie zwei Engelchen hold, und hielten sich umschlungen.
Die Großmutter griff nach der Hand ihrer Schwiegertochter: „Waberl, sei nit traurig; ’s geht Alles gut aus. Noch verlaßt Euch die alte Mutter nit, schau, ich hab Euch ja Alle gern. Bleibt nur so und schaut auf die Kinder, das bitt’ ich Euch! –“
Waberl schluchzte, die Kranke blickte ihr starr in’s Gesicht, dann lispelte sie: „Trinken!“
Die Tochter reichte ihr das Preißelbeerwasser, das kühlend und stärkend wirkt, und die Greisin nahm ein paar gierige Züge. „Jetzt ist mir besser, viel besser,“ hauchte sie, auf das Polster zurücksinkend – „geh, leg’ Dich nieder, Waberl, bist auch müd; ich werd’s schon sagen, wenn ich was will.“
Bald darauf schlief sie ruhig ein.
Waberl horchte dem Athem, er war viel ruhiger und geregelter. ’s wird doch wohl, dachte sich das besorgte Weib, mich deucht’, ’s wird ein wenig besser, – nein, da wär ich aber froh! ’s wird doch wohl; und morgen kommt ja der Mirtl. – Sie besprengte nun die Schlafenden mit Weihwasser und machte ein Kreuz über alle Drei. Bald darauf war der Kienspan im Holzknechthäusel verloschen.
Wie sie nun ruhten die vier Menschenherzen und träumten freudig und bang – und die Wanduhr tickte und der Mond[S. 229] strahlte still durch die Fensterlein; da zog ein Engel durch die Stube, drückte einen Kuß auf die Lippen der schlummernden Greisin und verhüllte das Antlitz. –
Ein leiser Windstoß, der am Fenster klirrte, weckte Waberl auf. Sie machte Licht, um nach der Kranken zu sehen. Diese schlummerte.
In der Stube war’s kühl geworden und Waberl wollte der Großmutter ihre Decke bringen. Die Großmutter hatte jetzt einen leichten Schlaf, keine Beschwerde im Athemholen.
So süß hatte sie schon lange nicht geruht, nie in ihrem Leben. Sie war eingegangen zur großen Ruhe.
Der Kienspan flackerte roth und düster, als wollte er ein bleich gewordenes Antlitz wieder färben....
Julerl lächelte im Traum und schmiegte sich an den Hals des Brüderleins. Und Waberl war hingesunken auf den Lehnstuhl und verbarg ihr Gesicht. Ihre Lippen zuckten, sie hatten keinen Laut, ihr Auge hatte keine Thräne – Alles, Alles im Herzen! –
Der Kienspan verlosch, aber die Kohle glimmte noch lange wie das Gedenken der Liebe an ein verblichenes Herz. –
– – – – – – – – – – – –
An den Fenstern blühten wundervolle Eisblumen und durch dieselben schimmerte die Morgenröthe.
Waberl ging und machte Feuer in dem Ofen und molk die Ziegen zur Suppe für die Kinder. Die Ziegen gaben heute weniger Milch als sonst; vielleicht weil Waberl nicht sang? Als die Kinder erwachten, sagte sie, sie sollten heute still sein und beten, es sei die Großmutter gestorben. Darauf durften sie die Leiche ansehen und Hansl sagte, sie sei nicht gestorben, sie sei ja noch da und schlafe nur. Dann küßte Waberl ihre Kinder und konnte endlich weinen.
Nun holte sie ihren Wachsstock aus dem Kasten hervor, und als sie die Leiche mit einem Linnen überdeckt hatte, zündete sie den Wachsstock an und stellte das kleine Crucifix dazu, das sonst auf dem Hausaltar stand. Dann that sie ihre Arbeiten, wie sonst jeden Tag, und dachte fortwährend an den Abend, wenn er kommen und es sehen werde.
Draußen ging ein kalter Wind und fegte an den Schneemassen und wehte ihn in alle Fugen und an die Fenster, daß es ganz dunkel wurde im Häuschen und das Wachslicht einen gar eigenen Schein an die Wand warf.
Die Kinder fürchteten sich und gingen zur Mutter in die kleine Küche. Dort kauerte sie am Herdfeuer und betete, und die lustig flackernde Flamme heimelte sie an und erleichterte ihr Herz.
So erwartete sie den Abend. Er kam, aber – Mirtl kam nicht. – Lange war die Stunde schon vorüber, um welche er sonst an die Thür klopfte, sein Weib und sein Mütterlein begrüßte und die Kleinen an den Schnurrbart drückte. Heute war diese Stunde schon längst vorüber. Er konnte ja nicht kommen, es war unmöglich; der Schnee lag klaftertief und vom Schlag bis zur Hütte hatte man im Sommer gute drei Stunden.
Vielleicht hatte er’s versucht, und er ist weiter gewatet und weiter, bis er immer mehr einsank, ermüdet ein wenig ausruhen wollte und einschlief und – verweht wurde. – –
Sie todt, und begraben mit ihr im Schnee, getrennt von ihm und von aller Hilfe und von allem menschlichen Trost!
Solche Gedanken folterten das arme Weibesherz. Waberl stürzte zum Fenster, riß es auf, als wollte sie zu Hilfe rufen die Bäume, den ganzen Wald und Erde und Himmel![S. 231] Dann schwankte sie wieder zur Herdlehne und zog die Kinder an die stürmende Brust, als seien sie nunmehr ihr Einziges und Allereinzigstes, an dem sie Gattentreue und Mutterverehrung, in unendlicher Kindesliebe vereinigt, zu verschwenden habe! –
Die Herdflamme war ausgegangen. Sie sah es nicht, sie hielt die Kinder in den Armen und barg ihr Gesicht in die jungen Locken. – Da klopfte es an der Thür.
Waberl sprang auf: „Da ist er, Gott sei Lob und Dank!“
Sie zündete einen Span an und ging zu öffnen. Die Thüre wollte nicht aus den Riegeln; von außen drückte eine zu große Schneelast an dieselbe. Jetzt wich sie: „Endlich bist Du da, Mirtl, grüß Dich zu tausendmal Gott!“ jubelte sie dem Eintretenden klagend entgegen. Dann stieß sie einen Schrei aus und der Span entfiel ihrer zitternden Hand.
Es war nicht Mirtl; es war ein fremder Mann.
Dieser sagte: „Beruhigt Euch, gute Frau; ich bitt’ Euch nur um ein Lager für diese gräßliche Nacht.“
„Ja, bleibt, aber mein Mann, – kommt er auch? Habt ihn nit gesehen; wißt nichts von ihm? Ich bitt’ Euch!“ jammerte Waberl.
„Ich kenn’ ihn nicht.“
„Ihr kennt ihn nit, meinen Mann, den Holzknecht Mirtl; ja, seid Ihr nit vom Dorf herein?“
„Mirtl! der Holzknecht Mirtl ist Euer Mann?“
„Nit wahr, ’s hat ihn nit verschneit! – oder hat’s ihn? sagt es nur gleich heraus, ich ertrag’ es schon – ich ertrag’ Alles! – Alles!“
Die Kinder weinten. Der Fremde suchte das aufgeregte Weib zu beruhigen und sagte, daß Mirtl nicht todt sei, daß[S. 232] er kommen werde, er habe ihn gesehen, auch gesprochen – im Schloß – im Dorf draußen, aber heute könne er nicht mehr kommen, heute nicht mehr. Grüßen ließ’ er sie. – Dabei war der Mann selbst aufgeregt und schüttelte mißmuthig den Schnee von den Kleidern, lehnte den Stock und ein Gewehr an die Wand und warf den Hut mit seinem hohen Federbusch auf die Bank, die ihm das nun etwas beruhigte Weib zum Niedersitzen hinstellte.
Der Fremde war ein großer, schöner Mann in eleganter Jagdkleidung und mit langem Knebelbart, an dem noch Eis hing. Die Kleinen fürchteten sich vor ihm, bis er jedem ein freundliches Wort gab.
Waberl stand am Herd und blies die Glut an. „Mögt Ihr doch eine Suppe?“
„Dank Euch; hab ein bischen Schnaps bei mir. Aber das ist Euch eine verdammte Geschichte, hab’s noch nicht erlebt so. Soll der Teufel alle Jägerei holen! – ’s war aber nicht so arg heut’ Morgens, und neuer Schnee, sagt man, ist des Hasen Weh’; ’s ging auch ganz vortrefflich bis in den Mittag hinein – schieß’ sogar ein Thier. Verlier’ ich Euch mein Gefolge und finde in diesem Höllengestöber die Spur von keinem Teufel. Meint Ihr, der Hund käm’ mir nach, oder ich hört’ wenigstens ’nen Schuß? – Nein. Ich geb’ Nothschüsse und verpuff mein Pulver bis auf den letzten Kern. Umsonst! Als ob sie alle die Erd’ verschlungen hätt’, die Sakramenter. Gab Euch ein gut Stück Arbeit, bis ich da vom Kamm ’rab komm! Ist doch der Schnee bald mannstief! Fall ein Dutzendmal bis unter die Arme ein und wie’s nun gar finster wird – mein’ schon, ’s ist aus mit mir – seh’ ich zum Glück das Licht Eurer Hütte. – Wie weit rechnet Ihr bis da zur Schlucht ’nein, Frau?“
„Mein Gott, hat unsere alte Mutter nit mehr braucht, als eine kleine Viertelstund. –“
„Und ich wat’ Euch gute zwei Stunden da ’raus. Sakra! Ich spür’ ja gar keinen Finger und keine Zehe mehr!“
„Zieht Euere Schuh aus und setzt Euch auf den Herd da – ich bring Euch Schnee herein, der zieht die Gefrür aus – so! Aber zieht doch den Rock aus, er ist ja pritschlnaß. ich geb’ Euch eine Joppen von mein’ Mann. – Mich deucht, wann der Mirtl doch nur auch da wär!“
„Kommt morgen! Ein paar Schneereif’, Frau, sind gewiß im Haus? sonst könnt ich kaum fort; es werden aber schon meine Leut’ kommen.“
So wurde geholfen und gesprochen und berathen. Hernach aßen die Drei ihre Suppe und beteten laut ihr Tisch- und Abendgebet. Dem Fremden kam das recht eigen vor, und wie die Kleinen so unschuldig aufblickten und noch ein Vaterunser für die Großmutter, die gestorben, und für den Vater, der nicht gekommen sei, beteten, bekam’s ihn wie ein Zittern im ganzen Leib, und als müsse er fort, in der Nacht noch, augenblicklich, und befehlen und erlösen. –
Nach dem Gebet fragte Waberl den Fremden, ob er gleich schlafen zu gehen wünsche, sie trage ihm Stroh in die Küche; oder ob er mit in die Stube gehen wolle, sie und die Kinder würden heute durch die Nacht aufbleiben, weil sie einen Todten hätten.
Das war eine neue Ueberraschung für den Mann und er wollte den Todten sehen.
Der Mann stand, fern von seinen Prachtgemächern und seinem Ueberfluß, in der Wildniß, mitten in einer Hütte voll Armuth und Noth und Grauen, und starrte in das stumme[S. 234] Todtenantlitz der Greisin und in die abgehärmten Züge seiner Wirthin und in die frommen Engelsgesichtchen der beiden Kinder.
Es war ein tiefes Schweigen, ein allgewaltiger Augenblick – der Mann sank wie gebrochen auf einen Stuhl und verdeckte mit den Händen seine Augen, daß er nichts, gar nichts mehr sehe.
Aber draußen um die Hütte herrschte ein fürchterlicher Sturm, ähnlich dem in seinem Herzen. Das Rauschen der Tannen, das Tosen an den Pfählen und Wänden der schutzlosen Hütte drang schauerlich an ein ungewohntes Ohr.
Aber Waberl hörte von all’ dem nichts. „Gelt, guter Herr,“ sagte sie, als sie die Erregung des Fremden gemerkt hatte, „gelt? Mein lieber Gott, er hat sie noch so gesund und wohlauf verlassen und im Fortgehen noch gesagt: Werdet mir nit älter derweil, Mutterl, und bleibt alleweil lustig! – Und jetzt ist ’s so. Nein, der wird aber hausen (sich grämen)!“
Hansl war auf dem Stuhl eingeschlafen und Waberl brachte die Kinder in’s Bett.
Der Fremde kauerte im Winkel hinter dem Ofen und horchte dem nächtlichen Sturm. Die Fenster waren verweht und verfroren. Waberl bat den Mann, daß er schlafen gehe und nicht etwa auch noch krank werde, er sehe so unwohl aus. Aber der Fremde sagte, daß er doch nicht schlafen könne.
Nach Mitternacht ließ der Sturm nach und man hörte ihn nur mehr von der Ferne wie ein dumpfes Nachdonnern nach einem Gewitter.
Dem Manne waren endlich die Augen zugefallen; aber Waberl saß bei der Leiche und betete. Die Lider waren ihr schwer – sie verlor sich und träumte unzusammenhängende Bilder aus heiteren Zeiten. Da hörte sie aus Fernem gleich[S. 235]mäßige Schritte, die immer näher und näher kamen. Waberl fuhr plötzlich auf. Sie hörte nichts sonst, als das Ticken der Uhr.
Das Weib schaute auf die schlummernden Kleinen und drückte auf die Wangen einen Kuß, in welchem alle Freude und aller Schmerz des Mutterherzens aufgelöst waren.
Der Fremde mußte schwere Träume haben, er war sehr unruhig und seufzte. Waberl war besorgt um ihn und dachte bei sich, wie es doch gut sei, daß er gekommen. Er war ihr ein Trost in diesen Schrecknissen, die sie allein wohl kaum zu ertragen vermeint. War es wer immer, er werde das ja endlich wohl sagen, er sei nun Hausfreund und müsse helfen, helfen, bis Mirtl da und Alles wieder besser wäre.
Es mußten dicke Wolken am Himmel hangen, es wollte in solchem Wetter nicht recht Tag werden.
Der fremde Mann erwachte auf seiner Bank, rieb sich die Augen und entsann sich seiner Lage. „Will denn diese gottverdammte Nacht kein Ende nehmen?“ murmelte er aufspringend und auf seine Uhr sehend. Sie mußte von der Nässe gelitten haben und stand. Die Wanduhr zeigte im düsteren Schimmer des Wachslichtes die achte Morgenstunde.
Waberl, die an der Wand herum gegangen war und die Fenster geprüft hatte, rang sprachlos die Hände.
„Was habt Ihr denn schon wieder?“ fuhr sie der Fremde an, „ob’s nicht licht wird in diesem Loch, frag’ ich Euch!“
Da wankte das trostlose Weib auf ihn zu: „Flucht nit, wir sind verschneit und verweht.“
„Verschneit? Was habt Ihr da gesagt! Verschneit und verweht?“
Er rannte wie wahnsinnig zu den Fenstern. Verschneit und verweht! Abgeschlossen von aller Menschenhilfe, gehüllt[S. 236] in ewige Nacht – lebendig begraben, – verhungernd – zerschmettert, wenn das Dach seiner unberechenbaren Last weicht und einstürzt. Verschneit und verweht! –
Und es blieb Nacht in der Hütte.
Der Fremde hatte sich ausgetobt. Jetzt saß er am kleinen Tisch und starrte sprachlos in die Flamme des Kienspans. Waberl mußte ihn trösten. Sie sagte, daß man durch den Rauchfang Tag schimmern sehe, und daß Mirtl schon kommen werde, um sie Alle zu erretten.
Da lachte der Mann auf. Es war fürchterlich, wie er auflachte und das Weib und die Kinder erschreckte. „Heute noch nicht,“ murmelte er dann.
Nun machten sie Versuche, ob denn nirgends ein Ausweg. Sie öffneten die Thür; eine Schneemasse stürzte in das Haus, aber es blieb dunkel über derselben. Sie mußten tief liegen. – Durch den engen Rauchfang hinauszukommen, war unmöglich. Alles Rathen und Anstrengen vergebens.
Die Kinder hatten zuerst ihren Spaß, daß es heute finster bleibe; sie löschten in der Küche den Span aus und spielten „blinde Kuh“. Als aber die Mutter sagte, daß sie beten sollten zum lieben Gott um Hilfe und Errettung, sonst müßten sie Alle mitsammen sterben, da wurden sie denn doch ein wenig traurig.
Waberl war ein starkes Weib und hatte sich Fassung errungen. Sie ordnete Alles neu an und dachte nach, wie es jetzt werden müsse. Lebensmittel waren im Hause, sie müsse nur sehr sparsam damit umgehen. Die Ziegen geben ja täglich Milch, und wenn’s darauf ankäme, auf ein paar Wochen Fleisch. Brennholz lag im Vorhaus, und wenn dieses verbraucht, wolle sie die Wand zwischen Stall und Futterkammer[S. 237] angreifen. Und endlich müsse doch ihr Mann und Hilfe vom Dorfe kommen.
Vor allem beschloß Waberl, die Leiche der Großmutter mit Hilfe des Fremden auf den kühlen Vorboden zu schaffen.
Nach alldem schmeckte bei Tisch die Erdäpfelsuppe recht gut, aber der Fremde aß nichts, sondern versuchte nur einmal aus seiner Pfeife, welche reich und zierlich beschlagen war, zu rauchen. Dabei hing er seinen Gedanken nach. – Wird er wohl kommen? Nein, vor drei Tagen gewiß nicht. O Hohn des Schicksals! Das ist zu viel! Laß’ mich doch nicht so elendiglich verderben. – Wird man mich nicht suchen? Hunderte werden es, aber sie werden mich in diesem Schneegrabe nicht finden.
Den andern Tag war der Fremde endlich heiter und spielte mit den Kindern und sagte, sie sollen ihn den Vetter Franz nennen; zu Hansl sagte er besonders, er werde noch sein Firmpathe werden. Waberl versicherte er, daß Mirtl in einigen Tagen ganz gewiß kommen werde und sie möge in der Weile nur auf das Feuer Acht geben und wohl nachsehen, daß das Wachslicht am Vorboden nicht Schaden thue.
Der Mann aß nun auch, wenngleich wenig, von der Milchsuppe und den Kartoffeln und trank zu Durst mit den Anderen Wasser von aufgelöstem Schnee. Dabei lächelte er wehmüthig und sagte, die Kinder streichelnd, sie würden mitsammen schon noch einmal was Anderes bekommen. Fluchen hörte man ihn nicht mehr.
So ging wieder ein Tag dahin und die Bewohner der Hütte gewannen den „Vetter Franz“ recht lieb. Er wußte Geschichten zu erzählen und wie es draußen in der Welt und bei den reichen Menschen zugehe. Er zeigte ihnen seine Sackuhr und sagte, daß das, woraus das Gehäuse gemacht,[S. 238] Gold wäre. Sein Gewehr mußte er ihnen auch zeigen und erklären, und er fragte, ob denn der Vater keines habe. Die Kinder sagten Nein, aber Waberl erzählte, daß Mirtl wohl einmal eines gehabt habe, als noch Wölfe im Gebirge waren und böse Leute in der Gegend herumstrichen. Da sei aber der herrschaftliche Förster gekommen und der habe es mit fortgetragen, weil Unsereins, der mit der Jagd nichts zu thun, kein Gewehr haben dürfe. Zwar aufrichtig: Der Mirtl hätte wohl noch eins.
„Es giebt ja eine solche Unmasse von Wild in diesen Bergen herum; Euer Mann wird doch die Gelegenheit so dann und wann benützen?“ fragte der „Vetter“.
„Zu brauchen hätten wir schon was,“ meinte das Weib.
Der Fremde sah dem Span zu, dessen Kohle sich so merkwürdig ringelte. Hansl war noch im Anschauen und Untersuchen der Uhr begriffen und fragte, „ob’s denn mehr solche Sachen in der Welt gäbe?“
„Bei allen reichen Leuten, mein Kind,“ gab der Mann lächelnd über diese junge Einfalt zur Antwort.
„Ei, so sag’ mir einmal, Vetter Franz, wie wird man denn ein reicher Mann?“
Was sollte der Fremde wohl darauf antworten? Aber Julerl that’s für ihn. „Ein reicher Mann, Hansl?“ meinte sie, „wenn man ein Schloß nimmt und braucht die Leut’ zum Roboten.“
Der „Vetter“ war ernst und nahm die Kinder auf seinen Schoß. Er küßte sie und that im Herzen ein heiliges Gelöbniß.
Seitdem es Nacht in der Hütte war, hatte der Zeiger der Wanduhr zehnmal seine Runde gemacht. Das Stückchen Himmel, das durch den Rauchfang hereinlugte, war trüb, so trüb wie die Gemüther der Hüttenbewohner, deren letzte[S. 239] Hoffnung im Erlöschen war. Aber sie waren ruhig und ergeben. Nur der „Vetter“ war wieder einmal wie rasend, er müsse fort, er könne hier nicht umkommen.
Und am sechsten Tag, als der Himmel blau durch den Rauchfang blickte, wurde es anders.
Waberl hatte es zuerst gehört und athemlos in der Stube verkündet. Dann waren sie Alle in’s Vorhaus gelaufen und hatten es wieder gehört. Dann wurde der Schnee vor der offenen Thür, der früher schwarz war wie die Wand, grau und licht und lebendig, eine Gestalt brach aus demselben hervor und im rosigen Tag stand Er da und fiel seinem Weibe um den Hals. – –
Es war ein freudiges Tagen! – bis Mirtl’s Blick bang umher zu irren begann. – Oben im Vorboden lag sie und vom Wachsstock brannte das letzte Stümpfchen. – Todt schon seit acht Tagen.
Der Holzknecht kniete an der Bahre und hielt die harte, kalte Hand fest umfaßt und starrte lange in das weiße Antlitz: „Mutterl! Das Wildpret war Euch vermeint gewesen, das ich in voriger Woche geschossen; hab’ Euch so lieb gehabt, und jetzt seid’s mir gestorben!“
Und wie der holde Tag durch die Thür strahlte und das harte Weh im Herzen sich aufgelöst hatte in Thränen, gedachte Waberl auch des Fremden. Der stand im Winkel hinter dem Herd. Als ihn der Mirtl sah und wieder ansah und sich die Augen rieb, hat sich das ereignet, was im Schlosse draußen noch heute durch ein großes Gemälde dargestellt wird.
Im Gemälde kniet der reiche und hochedle Baron Franz von Scharfenthal vor einem braunen, bärtigen Holzknecht und umfaßt dessen Kniee und blickt flehend auf in’s rauhe, treue Gesicht.
So hat es der Künstler dargestellt.
Auf der Rückseite des Gemäldes ist ein Fach und in demselben liegt die Urkunde. Sie lautet:
„Im Jahre des Heiles 1846, als der strenge Winter war, hat sich der Freiherr Franz von Scharfenthal auf der Jagd verirrt und sechs Tage und sechs Nächte in einer Holzknechthütte des Hochgebirges bei einer armen Familie, mit welcher er förmlich eingeschneit wurde, zugebracht. Er wäre alldort Todes gestorben, wenn nicht noch zu rechter Zeit der Vater der Familie und Besitzer der Hütte, vulgo Holzknecht-Mirtl, den der Baron einige Tage früher, als dies geschehen, wegen einer kleinen Wilderei auf zehn Tage einsperren ließ, von seiner Haft frei geworden wäre und mit anderen Gebirgsleuten die Bewohner der Hütte gerettet hätte.“
So hatte es der Baron aufschreiben lassen und das ist die Geschichte von dem Holzknechthaus. –
Draußen im schönen Thal, wo auf einem Hügel das prächtige Schloß steht, liegt heute zwischen wohlbearbeiteten und fruchtbaren Feldern ein stattlicher Bauernhof, und Knechte und Mägde schaffen in und um denselben. Der Bauer trägt einen tüchtigen Schnurrbart und arbeitet wacker mit, obwohl er’s nicht Noth hätte. Wenn er Abends heimkommt, halst er sein Weib und sagt: „Waberl, Du Herztausendschatz, grüß Dich Gott!“
Den Bauernhof hat der Baron dem Mirtl gekauft, und dieser braucht keine Robot mehr zu entrichten. Julerl, die Tochter hat einen Gutsbesitzer geheiratet und Hans ist Oberförster.
Für den Hof daheim sind schon noch Jüngere.
Der Baron hat viele graue Haare. Man sagt, er habe die ersten vom Holzknechthaus mitgebracht. Er ist auch sonst seit jenem Ereignisse anders geworden. Wenn er irgendwo[S. 241] eine arme Familie weiß, so hilft er und erkundigt sich, wie tief um ihre Hütte im Winter der Schnee liege. Und wenn er am Sonntagmorgen bei den Seinen auf dem Söller steht und den Mirtl und seine Gattin und Kinder festlich gekleidet mit den zwei Hengsten thaleinwärts fahren sieht, so grüßt er sie schon von weitem.
Wo fahren sie hin?
D’rin im Gebirg ist ein Dorf und eine Kirche und ein kleiner Gottesacker dabei, dort halten sie und pflanzen Blumen auf ein Grab und geben einem alten mühseligen Weiblein Geld, damit es dieselben ferner pflege. Dann setzt sich Mirtl mit den Seinen wieder auf das Gefährte und läßt’s weiter gehen – tiefer hinein in das Hochgebirge. Der Weg ist holperig und neben demselben rauscht und schäumt der Waldbach. Endlich kommen sie in ein enges Thal, wo das Wasser ruhig durch eine kleine Wiese läuft und zwischen den Tannen ein Stück graues Gemäuer steht.
Auf dem Gemäuer wächst wunderschöner blauer Enzian und anderes medicinisches Kraut. Davon pflückt sich der Mirtl ab und nimmt mit in’s große Thal hinaus. Es soll gut sein. Auch der Baron Franz von Scharfenthal braucht davon. Er kennt nunmehr in seinen alten Tagen kein heilsameres Kraut, als diesen blauen Enzian von der Stätte des Holzknechthauses.


Dort auf dem Hochpaß, wo der Waldweg vom freien, sonnigen Hügelland hinüber und abwärts in schattige Schluchten des Hochlandes führt, steht unter einer grauen, zerklüfteten Felswand ein hundertjähriger Lärchbaum.
Er steht einzeln auf einer kleinen umwaldeten Rasenweide. Sein knorriges Geäste strebt nach allen Seiten weit hinaus, als sei es in Wettstreit mit den sich unter dem Rasen hinschlängelnden hundertfältigen Wurzeln.
An der rauhen, vielfach zerklüfteten, harzigen Rinde des Stammes ist ein verwittertes Crucifix angebracht; es wächst schon Moos an den Armen und an der Brust des Gekreuzigten.
Auf dieses Crucifix richten sich die Augen eines Mannes, der im Baumschatten auf dem Rücken liegt, die rechte Hand als Kopfkissen gelegt, mit der linken einen Rosmarinstamm zerknitternd. Die Augen des Mannes sind groß und dunkel, auf seinen bleichen Wangen und Lippen liegt es wie ein schweres Leid. Der junge, schwarze Bart ist ungepflegt – über die langen Haare kriecht eine Kreuzspinne.
Der Mann gewahrt es, er hält den Rosmarinstamm gegen die Stirne und das Thier kriecht über denselben auf seine linke Hand. Diese zittert, es entfällt ihr die Pflanze. Das Thier krabbelt gegen den Elbogen und endlich auf die Brust.
„Ein großes Glück kommt zu mir, denn eine Kreuzspinne sitzt mir am Herzen!“ murmelt der Mann und seine Brust wogt hoch auf.
Aber die Spinne krabbelte darüber hinaus und verkroch sich wieder im Grase.
Der Mann richtete sich etwas empor, strich sich die Locken aus der Stirne und that einen Blick gegen die Himmelsbläue und abwärts gegen das heitere Hügelland, wie es da lag im lichten Spätherbsttag.
Dort über die bewaldeten Anhöhen herauf und über die Felder und die Wiesenau war er gegangen. Hinter jenem bläulichen Waldstrich ragt eine funkelnde Nadel empor – die Thurmspitze des Städtchens.
Dort war der Wurzelgraber Martin heute gewesen, dort hatte er seine Wurzeln und Kräuter verkauft und einen guten Erlös eingezogen. Dort war heute Kirchweih und auf dem Kirchhof waren am Vormittag viele Menschen versammelt, an der Mauer des Pfarrhofes hatte ein junger Priester gepredigt. Er predigte von dem Frieden und von der Liebe – von dem Reiche Gottes auf Erden. Und dort im Städtchen war Lust und Musik an allen Ecken und Enden und beim „goldenen Rößl“ hatte Martin die Nothburga zum Tanze geführt, und dort hatten sie heute den Wegmacher Niklas erschlagen.
Niklas ging gestern mit Martin über das Gebirge, auf daß er heute im lustigen Städtchen seinen zwanzigsten Geburtstag feiere; – jetzt liegt er starr und einsam beim Wirth in der Scheune und hat über der Stirne eine lange Wunde. Vom Tanzboden klingen Pfeifen und Geigen und Jauchzer und Jodler herüber, dort winden und flechten sich die Reigen, Herzen an Herzen – sie leben und sind fröhlich.
Es möge klingen und schallen und freudig sein – der junge Priester predigte vom Reiche Gottes auf Erden. –
All’ das ist für den Mann unter dem Lärchbaume nun vorbei und versunken, nur die funkelnde Nadel der Thurmspitze ragt noch empor über dem fernen, bläulichen Wald.
Niklas war Martin’s Freund und Nothburga’s Bruder; Nothburga war Martin’s – Freud und Leid.
Die Sonne sank hinter die Felsen, auf der Hochweide war es schattig, nur draußen auf dem Hügellande war es noch goldig und auf den weißen Straßen zogen Wagen und festlich geschmückte Menschen. Ueber einzelnen Gehöften wehten Fahnen des abendlichen Rauches und die Thurmspitze funkelte und funkelte, als wäre sie ein lebendiges Flämmlein, und weit draußen hinter all dem zog sich das bläulichgraue Band der Hochebene hin.
Viel Leben wogte und athmete da unten, aber kein Ton und kein Schall drang herauf zum einsamen Hochpaß. Nur ein gezogenes, gleichmäßiges Ticken zitterte in der Luft, das kam von der hölzernen Uhr der Waldkapelle, welche in der nahen, von jungem Dickicht bedeckten Schlucht stand. Die Uhr hatte vor zehn Jahren Martin’s Vater, der alte Veit, geschnitzt; es war sein letztes Werk.
Das erzähle ich, weil Martin wohl daran gedacht hatte, als er so da lag unter dem Lärchbaum und sein trübes Auge zum Kreuzbild wendete.
Jetzt erhob er sich, griff nach seinem grünen Filzhut und dann machte er einige rasche Bewegungen mit den Händen, daß er die Trägheit abschüttle.
Martin war ein schöner junger Mann in Alpentracht. Aber – wie die Natur schon oft spielt – er war ein Anderer als Andere. Es lag eine besondere Kraft in ihm – in seiner[S. 245] Seele. Er fühlte diese Kraft, aber er wußte nicht, wie sie in ihm entstanden war und was sie wollte. „Aus mir wär’ was geworden, wenn mich mein Vater in die Schul’ geschickt hätt’!“ Das sagte er oft und mit Bitterkeit. So wie er heute dalag unter dem Baum, so lag er oft, und da hatte er schwere tiefe Gedanken, wie sie sonst der Alpensohn nicht hat; er suchte nach der Kraft, die irgendwo in seiner Seele lag, wie nach einem Schatz, und er wollte sie heben. Sie lag drückend auf ihm, er rang mit ihr, aber er konnte sie nicht fassen, nicht lenken und leiten. – Dann hielt er oft seine beiden Hände lange vor die Stirne und rief aus: „Ich werde noch wahnsinnig!“
Oft war er schon ausgelacht und ausgespottet worden, und wenn er von Zeit zu Zeit gar Einen fragte: „Sag’, hast Du denn noch nie darüber nachgedacht, wie das ist, da sind so viele Millionen Menschen in der Welt und keiner ist glücklich? Ein klein wenig glücklich ist Mancher, aber Keiner ganz; bei Manchem fehlt gar nicht viel, aber es fehlt.“ Wenn er so fragte, so erhielt er die Antwort: „Narr, so schlaf’!“ oder: „Narr, so sauf’ Dir einen Rausch!“ – Und die so antworteten, waren noch nicht die Dümmsten.
Indeß, Martin schlief nur wenig und einen Rausch hatte er sich noch gar nie getrunken. Er zog nur im Gebirge umher und grub Wurzeln und Kräuter. Und wenn er sich auf einen Stein setzte, um auszuruhen, so kamen ihm immer wieder die Gedanken und er murmelte: „Es liegt wo – es muß wo liegen!“
Als sein Vater auf dem Todbett schwer danieder lag, stand er an demselben Tag und Nacht und that Alles, um ihn zu trösten und zu erquicken. Er war betrübt, aber er sagte: „Es muß einmal so sein und da kann Niemand dafür.“
Und als sich Martin einst einen Splitter in den Arm gestoßen hatte und sich in Schmerzen wand Tag und Nacht, und als die Leute sagten: „Ach, der arme Wurzelgraber Martin, ’s ist zum Todterbarmen, wie der leiden muß!“ rief er aus: „Wer kann dafür? Deswegen fällt die Welt ja nicht zusammen und Euch hindert gar nichts, daß Ihr lustig seid!“
Später aber, als von einem blutigen Krieg, der draußen gewüthet hatte, die Krüppel heimhinkten, da stieß Martin einen Fluch aus: „... du Gotteskreuz in der Mörderhöhle! Dafür, daß diese jetzt ein unglückseliges Leben tragen müssen, die Bettler – dafür kann wohl Jemand! Das haben die Menschen angestiftet! – – Wo liegt denn das Mittel, daß sie Alle in Fried’ und Freud’ zusammen leben? Die Erde wäre doch groß und schön genug dazu und Liebe ist auch da, es käme nur darauf an, sie auf das Rechte zu lenken.“
Der Wurzelgraber ging einsame Wege.
Als Martin einmal an einem Sonntagsmorgen der Nothburga begegnete, die, das Gebetbuch und einen Blumenstrauß in der Hand, zur Kirche ging und ihn im Vorübergehen mit ihren blauen Augen heiter anblickte, da blieb er stehen, sah dem Mädchen nach und sagte zu sich: „In der könnte es liegen, in der!“
Seitdem sah er Nothburga oft, bis er einmal zu ihr hintrat und sie fragte: „Nothburga, hast Du mich so lieb wie alle anderen Menschen?“
Darauf sagte das Mädchen: „Du einfältiger Wurzelgraber, ich hätte Dich gar lieber, wenn...“
In diesem Augenblick flog hinter dem Gebüsch ein Wildhuhn auf und die Rede der Nothburga kam nicht zu Ende. –
Heute zur Kirchweih waren sie unten im Städtchen und zusammen beim Tanz. Als Martin das Mädchen an die Brust drückend sich durch den Tanzboden wand, dachte er bei sich: Ich hätte es, jetzt mögen auch die Anderen schauen, daß sie fertig werden!
Da entstand im Vorhaus ein Streit zwischen mehreren Burschen wegen einer Tänzerin, er wuchs und wuchs, Wein und Eifersucht waren auch im Spiele, – ein schwerer Keil sauste hin und der Wegmacher Niklas, der Bruder Nothburga’s, taumelte und stürzte an der Treppe nieder. Sein Schwesterlein rief er noch, aber als dieses kam und seinen blutströmenden Kopf in die Arme faßte, da starrten es seine Augen wohl noch an, aber diese waren steif und bewegten sich nicht mehr.
Nothburga hatte einen frischen Rosmarinstamm an der Brust, den gab sie nun ihrem Tänzer Martin: „Da, nimm ihn, er ist nicht für mich – sie haben meinen Bruder erschlagen!“
Und Martin nahm ihn, ging fort aus dem Haus und aus dem Städtchen und über Thal und Hügel – immer aufwärts gegen den Hochpaß. Er war verwirrt.
Dort, unter dem Lärchbaum brach er erschöpft zusammen, als ob auch ihn ein Keil getroffen hätte, dann starrte er zum bemoosten, verwitterten Crucifix auf und flehte im Herzen: „Vater unser, zu uns komm’ Dein Reich!“
Dann zerknitterte er den Rosmarinstamm und dann kroch die Kreuzspinne über sein Haupt und zu seinem Herzen.
Es begann bereits zu dunkeln und vom Hügelland herauf zogen verlorene Klänge einer Gebetglocke.
Martin brach sich vom Lärchgeäste einen Stock, schritt über den Paß und langsam abwärts gegen die Waldschlucht. Plötzlich stand er still und horchte. Ein Uhu krächzte. Der junge Mann schauerte und eilte schnell weiter durch den Hohlweg. Wieder blieb er stehen und that einen gebrochenen Aufschrei. Unten in der Schlucht sah er Lichter flimmern und diese bewegten sich und kamen des Weges entlang ihm entgegen.
Martin verbarg sich unter dem Hang, er zitterte und betete leise.
Und die Lichter kamen näher – ein Gemurmel zitterte durch die Abendstille. Menschen zogen den Hohlweg heran und einer unter ihnen trug auf dem Arm einen kleinen Sarg. Sie sprachen mit gedämpften Stimmen ein Gebet.
Den Letzten, der vorüber kam, fragte Martin, wer die kleine Leiche sei?
Sie war das Kind einer fremden Bettlerin, vor wenigen Stunden erst in einer Waldhütte geboren. Weil der Wurm starb, bevor man ihm Wasser auf das Haupt gegossen, hatte es kein ander’ Begräbniß.
Sie gruben nun in weichem Moosgrund ein Gräblein und legten das Kind der Bettlerin hinein. –
Martin eilte hinaus durch die Schlucht.
Das war heute ein wunderlicher Tag! – Wenn je ein Mensch das Reich Gottes auf Erden entdecken wollte, so müßte er so suchen und sehnen und forschen und verlangen wie der bleiche Bursche, der durch die dunkle Waldschlucht wandelt.
– Ein großes Glück kommt zu ihm – das Glück für alle Menschen, sonst ist es auch kein’s für den Einzigen, der es mit Allen gut meint.
Nie noch rang Martin so mit seinen Gedanken und Gefühlen, als heute; in seinem Herzen glühte es, in seinem Kopfe glühte es. Heim eilte er in seine Hütte und als er die Thür fest hinter sich verschlossen hatte, zündete er einen Kienspan an.
Unter dem Tische der Hütte lagen ein paar Ballen von getrockneten Wurzeln und Kräutern. Diese hatte Martin gesammelt, untersucht und ausgeforscht, aber das, was er suchte und immer suchte, er fand es nicht unter den Gewächsen. Und doch soll ein Kräutlein wachsen auf Erden, in dem es ruht, tief verwahrt und verschlossen, das Heiligthum – denn es ist ja für Alles, für Alles ein Kräutlein gewachsen, nur nicht für den Tod. Unmittelbar neben dem Tisch war ein verworrenes Strohlager, fast zu breit und weit für einen einzigen Müden; es hat auch schon Nächte gegeben, wo dem Burschen auf demselben einsam war. Ueber diesem Bett hingen Heiligenbilder unter Glas und daneben war eine Bretterstelle, auf welcher große, dickbändige Bücher lagen und lehnten – Bücher mit seltsamen Worten und Zeichen aus alten Zeiten.
Martin war in stillen Sommertagen und in wüsten Winternächten oft stundenlang vor diesen Bänden gesessen und hatte geblättert und nachgesonnen über die Zeichen und Geheimnisse, doch keine Lösung und Erlösung hatte er gefunden.
Martin kannte ja keinen einzigen Buchstaben, das s ausgenommen, welches aussieht wie eine Ringelnatter unter den Tannen- und Fichtennadeln des Waldbodens.
Martin hatte gehört, daß ein Buch geschrieben worden sei auf Erden, in dem es ruhe, was er suchte.
Martin legte den Arm auf ein Buch, sein Kopf sank auf denselben nieder und er begann bitter zu weinen.
So weint der ringende Menschengeist, dem das Wissen verschlossen und das Forschen verboten ist!
Endlich stieß Martin das vergilbte Buch in die Ecke, sprang auf, raffte nach Hut und Stab und verließ die Hütte.
Es war der Mond aufgegangen und im dunklen Waldesgrund lagen silberne Tafeln und Fäden und Punkte. Martin schritt darüber hinweg – in diesen bleichen Strahlen lag es doch nicht, was er suchte. Er hatte sie schon gefragt in stiller Mitternacht; er hatte die Sterne angerufen; hatte am Tag der Sonnwende aus dem Windröschen und dem Sesamkraut ein Feuer gemacht und durch den aufsteigenden Rauch in die Sonne geblickt – aber verschlossen blieben die Himmel. Und doch träumte ihm einmal, es gäbe ein Lichtlein im Weltenraum, und das Licht führe zum Heiligthum, das er suchte. –
Und siehe, als der Bursche so durch Wald und Hag dahinschritt, da sah er auf der Haide ein Lichtlein.
Er eilte ihm träumend zu. Eine Hütte stand dort; Martin sehnte sich nach Menschen.
Und als er zur Hütte kam, da fand er in derselben ein Weib einsam und verlassen auf einem Strohbund liegen; das schluchzte gar sehr, weil man ihm sein Kind fortgetragen hatte hinaus in ein fremdes Grab.
Martin setzte sich an die Thürschwelle.
Der Kranken that es wohl, daß ein Mensch bei ihr war, zu dem sie reden und klagen konnte.
Sie war ein armes Weib, war an der Seite ihres Mannes herumgezogen fast schon in der halben Welt; das Volk gab Brot und die Lebensluft dazu gab Gott. Vor einundzwanzig Jahre hatte sie ihrem Manne das erste Kind[S. 251] geboren und in zwei Jahren darauf auf geheimnißvolle Weise verloren. Der Knabe spielte am Wiesenraine, als sie vor dem Schloßthore eines reichen Mannes Lieder sang, und als sie ihn rief, kam er nicht, und als sie ihn suchte auf der Wiese, auf dem Felde, im Walde – in der halben Welt suchte, fand sie ihn nicht.
Er blieb verschollen bis auf den heutigen Tag; wer ihn fände, am linken Fuß fehlt ihm eine Zehe, das wäre das Wahrzeichen.
Ihr Mann war auch schon zur Ruhe gegangen. Aber bald nach dem Begräbniß des Gatten merkte sie das neue Leben unter dem Herzen; bangend und hoffend zog sie weiter und bettelte sich durch mancher Herren Länder. Hier in der Waldhütte übernachtend, kam die Stunde, das Weib gebar und verlor wieder, und Holz- und Köhlerleute trugen das Kind in den Wald und legten es in ein Grab.
„Und jetzt geh’ ich,“ schloß das Weib ihr Erzählen, „und singe, wo ich Witwen und Waisen finde, meine Gesänge.“
„Gutes Weib,“ entgegnete Martin, „wenn ich singen könnte, ich ging’ mit Euch, vielleicht läge das, was ich suche, im Singen.“
„Im Singen, lieber Mann, liegt Lust und Noth! – Ihr sucht ein glückliches Leben, ein Weib, eine Kinderschaar, ein friedliches Alter; o, bleibt daheim, das Alles liegt in Euren Bergen, bleibt daheim!“
„Daß Ihr mich versteht, Weib, ich suche nicht mein Glück, ich suche das Glück der ganzen Welt – das Reich Gottes auf Erden!“
„Das Reich Gottes auf Erden!“ rief die Bettlerin auflachend und sich emporrichtend, „ei, da sucht wieder einmal[S. 252] ein Blinder nach der Sonne, die ihn einst geblendet hat. – Glaubt das einer armen Bettlerin: das Weltglück, wir wissen nicht, wie es aussieht, darum ist alles Suchen vergebens.“
„Aber ich hab’ einen Priester predigen gehört, der sagte von einem Reiche Gottes auf Erden.“
„Es ist auf Erden, ja, und ich weiß auch wo: es ist in dem Herzen eines Kindes, das schlummert.“ –
Wer jetzt den Mond betrachtet hätte! Langsam zog er hinter ein Wölklein und statt der lichten, freundlichen Scheibe sah man am Himmel ein dunkles Herz mit silbernen Rändern. Und das Herz wurde ein scharfes Dreieck und zackte sich aus, – es wuchsen Arme und Glieder und diese streckten sich nach allen Seiten und – jetzt kroch über das dunkle Himmelsgewölbe eine riesige Spinne dahin.
Und wer jetzt in Martin’s Herz geblickt hätte!
Dort wurde ein Märchen wach, wie es einst in einer stürmischen Herbstnacht die Großmutter erzählt hatte. – Im Herzen des Kindes! – Ja, hier liegt ein Geheimniß, eine Zaubermacht – im Herzen des Kindes liegt Himmel und Glückseligkeit – Alles. Und darum hat jener Zauberer, von dem die Großmutter erzählte, ein Kindesherz geraubt und verzehrt sammt dem Geheimniß und der Macht, und er ist allmächtig geworden bis auf Eines. – Ei, dieses Eine – seinen eigenen Namen hat er vergessen und nicht mehr gefunden – er war namenlos. – Vielleicht auch das nicht, wenn er das Geheimniß zu Nutz und Frommen der Menschheit angewendet hätte. – –
Endlich, endlich gefunden, du bleicher Bursche – im Herzen des Kindes!
Ach, Martin, das Märchen der Großmutter war lehrreich; der Zauberer war namenlos geworden, er hatte den Namen Mensch verloren, er hatte ja eine unmenschliche That begangen. Martin, und wie hast Du es so unglücklich falsch verstanden mit Deinem einfältigen Wesen!
Martin bebte, er hielt sich an dem Thürpfosten und wie im Lippenkampf preßte er die Worte hervor: „Auch im Herzen eines Kindes, das todt ist?“
„Auch in dem,“ sagte die Bettlerin.
Der Wurzelgraber erhob sich und ging über die Haide.
Der Mond stand wieder frei und klar am Himmel, als Martin mit einem kleinen Spaten, den er zum Ausgraben von Wurzeln und Kräutern zu verwenden pflegte, von dem Hochpaß, wo der Lärchbaum steht, niederstieg durch den jungen Wald gegen die Schlucht.
Es ist drückend zu erzählen, wie der Mann gekämpft hatte mit seiner Muthlosigkeit, mit seiner Gespensterfurcht, wie er die Stunde beschwor und sich einsegnete mit allen Kreuz- und Wunderzeichen.
Dort stand die Kapelle.
Der Mond war hinter die Felsen gezogen.
Behend und geräuschlos, wie sonst nie, eilte der Wurzelgraber. Plötzlich trat er auf lockeres Moos und sein Fuß stieß an ein Kreuzlein, das im Boden stak. „Hier!“ sagte er und kauerte sich nieder. Fester faßte er den Spaten in die Hand und noch einmal rief er alle guten Geister an. Aber in dem Augenblick, als er das Eisen in den Boden graben will, beginnt es auf dem Thurme der nahen Kapelle zu rasseln und zu klappern, als ob hundert Todtengerippe tanzten.
Martin sprang auf und floh in das Gebüsch.
Das Geräusch währte eine Zeit fort und wiederhallte seltsam im Walde. Endlich war es wieder still.
Vielleicht ist das Uhrwerk abgelaufen, – kam es dem Wurzelgraber in den Sinn, aber er zitterte an allen Gliedern und die Kniee wollten ihm zusammenbrechen. Er beschloß nun, mit seinem Werk zu warten, bis der Tag anbreche.
So blieb er im Gebüsch versteckt, bis der erste Vogelsang wach wurde, bis es graute und sich lichtete und bis über den Ebenen das Morgenroth aufging.
Jetzt begab sich Martin wieder an die Stelle, wo das Kreuzlein stak. – Hier liegt das Kind der Bettlerin begraben ... Das Herz eines Kindes, das schlummert, – das Geheimniß, die Zaubermacht, das Reich Gottes.
Emsig warf Martin das Moos und die Erde aus, mit dem Spaten und mit allen Fingern grub er und endlich stieß er auf den kleinen Sarg.... Den scharfen Spaten stemmte er zwischen die Fugen – es krachte und der Deckel sprang ab.
Da lag es nun, in Lumpen, winzig und bleich und steif, das Menschenkindlein, zusammengekauert, die Händchen über die Brust gekreuzt, wie im Mutterschoß.
Leise rauschte es in den Blättern und Nadeln, auf allen Wipfeln sang und klang es – das Morgenroth strahlte in das Gräblein.
Martin’s Antlitz war fahl, seine großen Augen rollten unstet, zum erstenmal war es ihm, als sei das, was er nun begehen wolle, eine ungeheuerliche That.
Aber im Herzen des Kindes liegt es, und jener Zauberer nahm es heraus und wurde allmächtig! Und die Großmutter hatte die Geschichte so oft erzählt und im Gebirge wurde viel von derlei gesprochen.
Im Beinkleid, am rechten Oberschenkel hatte der Wurzelgraber seine Messerscheide stecken. Nach dieser griff er nun und zog ein schmales, langes Messer hervor, wie es die Gebirgsbewohner als Taschenklinge bei sich tragen.
Als Martin die zarten Händchen der Leiche von der Brust wegziehen wollte, fiel es ihm ein, daß auch die Finger eines neugebornen Kindes etwas Wunderbares an sich haben. Diebe brauchen das; wenn sie in irgend einem Hause, wo sie sich zur Nachtzeit zum Raube eingeschlichen, so ein Fingerchen anzünden, so brennt das wie ein Kerzlein, und so lange es brennt wird kein Mensch im ganzen Hause wach.
Aber nein und nein, Martin war kein Dieb, er schauerte vom bloßen Gedanken; er wollte ja nichts sonst von der armseligen Leiche als das Herz, in dem das Reich Gottes liegt.
Zu diesem Zwecke nun schiebt er die steifen Händchen zurück. – –
Zwei Holzhauer, die von ihrer Hütte zum Tagewerk an der Kapelle vorüber kamen, fanden den Mann so.
Zuerst sahen sie ihm von der Ferne zu, wie er in der Grube kauerte und die Erde auswarf. Endlich erkannten sie den Martin und meinten, er grabe Wurzeln; aber so tief gräbt kein Wurzelgraber ein.
„Er hebt wohl gar einen Schatz!“ sagte Einer zum Andern.
„Wäre schon recht, dann müßte er mit uns theilen.“
Jetzt zog er das Messer aus der Scheide; die beiden Männer schlichen näher hinzu und da sahen sie neben dem Erdhaufen das Grabkreuzlein liegen.
„Heiliger Gott!“ lispelte einer der Holzknechte, „der scharrt ja ein Grab auf!“
„Dummes Zeug! Wer läg’ denn da begraben?“
„Wohl gar das Bettlerkind, das sie gestern bestattet haben. Ich hör’ sie trugen es in den Wald. Doch, was wollt’ er damit? – Dieser Martin ist ein sonderbarer Mensch!“
„He, Martin!“ riefen sie laut, „was machst denn da?“
Dieser fuhr zusammen, lehnte sich dann über das Särglein und stotterte: „Ich? – machen? – Wurzelgraben.“
Aber die Holzhauer hatten es bemerkt, was hier vorging, und sie verständigten sich schnell, was nun zu thun sei.
Der Bursche wollte entfliehen, aber die Männer hielten ihn fest und sagten: „Martin, Du hast da was angestellt und jetzt kommst Du mit uns, wir treiben Dich in die Stadt.“
Da fiel Martin auf die Kniee und beschwor, daß er nichts Böses gewollt und gethan, er werde es schon sagen, warum er das Grab aufgescharrt – es sei vielleicht verboten gewesen, das sei ihm selbst so vorgekommen, aber er meine es nicht schlecht und sie möchten ihn nur machen lassen, es geschehe zu Aller Nutz und Frommen.
Aber die Holzknechte sagten: „Du bist ein schlechter Mensch, Martin, oder ein Narr, und Du mußt mit uns.“
Einer löste einen Strick von der Trage, auf der er den Lebensunterhalt für die Woche gepackt hatte, und wollte damit dem Wurzelgraber die Hände binden, allein dieser bat weinend, daß man ihm das nicht anthue, er gehe schon auch so mit wenn er Strafe verdient habe, so leide er sie auch.
Und nun führten sie den bleichen Burschen abwärts gegen das Städtchen.
Das Grab im Walde blieb einsam; es ging die Sonne auf und erhob sich über die Wipfel, und als die Mittagsstunde kam, schien sie auf das Särglein.
Es war nach Tagen.
Martin saß traurig in einer Kammer und zählte die kleinen, sechseckigen Scheiben am Fenster. Die Kammer war wohl größer und wohnlicher wie seine Hütte daheim im Walde, aber die Thür war verschlossen.
Eine Kreuzspinne war ihm zum Herzen gekrochen – und nun saß er im Gefängniß!
Er mußte einen großen Fehler begangen haben, das war ihm jetzt klar, aber, wenn er nur beweisen könnte, daß er kein schlechter Mensch sei! Wenn doch nur die Thür nicht versperrt wäre, damit er zeigen könnte, daß er auch freiwillig bliebe und seine Strafe leide.
Ein Mann brachte ihm täglich Suppe, Gemüse und Brot, machte ihm das reinliche Strohbett, und als es einmal draußen regnete und der Wind im Hollunderstrauch vor dem Fenster schwirrte, feuerte er gar in den kleinen Blechofen. Es kamen die ersten Wintertage, wüster und heftiger schlug der Wind an das Fensterchen und pfiff schrill durch die Fugen; endlich wurde es ganz grau vor den Scheiben und Flocken tanzten und der Schneestaub legte sich in die Fensterwinkel. Da kam der Wärter öfter und machte Feuer in dem Ofen. Das kam dem Burschen liebreich vor, so arg mußten es denn die Menschen doch nicht haben auf ihn.
Und dennoch schlug Martin seine rauhen Hände oft heftig vor die Stirne und stampfte in Verzweiflung mit dem Fuß. – Wenn ein Mann im Gebirge arbeitet, tagtäglich von seiner Kindheit an arbeitet – und mit einemmale muß er ruhen und unthätig sein, müßig bei gesunden Gliedern, muß dasitzen zwischen den Mauern, und draußen harret die Arbeit – das ist eine Pein für den an Thätigkeit gewöhnten Mann.
Martin litt diese Folter.
Sein ganzes Wesen ging dahin, daß er wieder daheim auf seinen Höhen sei, dort wolle er arbeiten und graben und seine Hütte vergrößern, und Nothburga zum Weib nehmen. Alle Welt möge gehen, wie sie geht, sie sei des Glückes nicht werth.
Einmal bat Martin den Wärter, dieser möge ihm Stroh bringen, er wolle Strohschuhe flechten, aber der Wärter brachte ihm keinen Halm. Da weinte der Bursche und klagte: „Das thun sie mir zur Pein an; mir wär’ es tausendmal lieber, sie gäben mir nur Brot und Wasser, aber Arbeit dazu!“
Eines Tages wurde es anders. Ein Gerichtsdiener trat mit dem Gefangenenwärter ein und befahl dem Wurzelgraber, daß er folge. Martin that es freudig, denn nun durfte er wohl wieder heim in seine Wälder. Aber in der Vorhalle nahm der Gerichtsdiener ein Kettenschloß vom Gesimse und legte es dem armen Burschen an die Hände. So führte man ihn in das Freie, wo es so blendend weiß und licht war, und wo doch der düstere Winter lag. Sie führten ihn durch einige Gassen der Stadt und über den Marktplatz. Menschen drängten sich heran, daß schier der Weg versperrt wurde, aus allen Fenstern sahen Leute und Viele zeigten mit Fingern auf den Wurzelgraber und riefen: „Dort geht er, das ist der Leichenräuber!“
Leichenräuber! – In seinem Leben war dem unglücklichen Aepler kein plötzliches Leid so zu Herzen gedrungen, als dieses schreckliche Wort. Jetzt erst ging ihm das Licht auf und sein Todesurtheil hatte er jetzt gehört. Nun war Martin überzeugt, daß dieser Gang in Ketten sonst nirgends hinführe, als hinaus vor die Stadt zum Hochgerichte.
Er wäre zusammengebrochen mitten auf dem Marktplatz – aber der Gefängnißwärter stützte ihn.
Sie kamen am Hause vorüber, wo Martin vor wenigen Tagen mit Nothburga getanzt hatte, wo sie den Niklas erschlugen. Ach, das war ein unheilvoller Tag und eine unglückselige Nacht!
Ja wohl, unglückselig, wenn Einer das Reich Gottes sucht und er findet das Hochgericht!
Ein Wegweiser ist geschrieben und aufgerichtet, aber gar Mancher hat ihn übersehen und Mancher kann ihn nicht lesen und deuten und geht den Weg des Verderbens! –
Endlich führten sie den Wurzelgraber in ein Haus und über eine breite, steinerne Treppe in einen großen Saal. Der Saal war durch ein Eisengeländer in zwei Räume abgetheilt. In einem dieser Räume standen und drängten viele Menschen, in dem andern saßen an einem langen, grünen Tisch ernste Männer in dunkler Kleidung. Einige Fenster des Saales waren durch Vorhänge verhüllt. Auf dem grünen Tisch stand zwischen zwei brennenden Wachskerzen ein Crucifix. Vor dem Tisch war ein einzeln dastehender Stuhl ohne Lehne. Zu diesem Stuhle wurde Martin geführt und dort nahm ihm der Gerichtsdiener das Schloß von den Händen.
So stand er da, der bleiche Bursche mit den großen, dunklen Augen, den wirren Haaren und dem ungepflegten Bartanflug. Das Zittern seiner Mundwinkel verkündete einen unendlichen Schmerz und das Auge flehte die Männer in dunkler Kleidung an, daß sie diesen Schmerz von ihm nehmen möchten.
Aber die Richter blieben kalt, nur sagten sie zu einander: „Noch so jung, noch so jung!“
Da lag ein Stoß von Papierblättern und auf diesen stand Alles geschrieben. Der gerichtliche Befund der kleinen Leiche, die Aussage der beiden Holzhauer, wie sie ihn an jenem Morgen an der Waldkapelle neben der Leiche trafen, von dem Wahne des Mannes, das Reich Gottes zu suchen, und von noch Anderem stand auf den Blättern. Da wurde jetzt aus diesen vorgelesen, dann wurde gesprochen, und es sprachen Einzelne und sie sprachen durcheinander, laut und leise, und Martin stand da und verstand von Allem kaum ein Wort.
„Wie alt ist Er jetzt – Er?“ fragte der Vorsitzende plötzlich, „hört Er nicht, ich frag’ wie alt?“
Der Wurzelgraber schrak aus seinem Brüten auf. „Wie alt,“ stotterte er, „das weiß ich gar nicht recht, ich soll in die Welt gekommen sein in dem Jahr, wie der große Sturmwind gewesen ist.“
„Hat Er noch Eltern?“
Martin schüttelte den Kopf.
„Nicht also?“
„Meine Mutter hab’ ich nicht gekannt und meinen Vater hat vor zehn Jahren der Brand umgebracht.“
„Was hat Er denn immer gemacht?“ fragte der Richter.
„Was wird Unsereiner auch machen! Mein Vater hat mir nichts lernen lassen können, nur die Wurzeln und Kräuter hat er mir angesagt, und sobald ich stark genug gewesen, bin ich das Wurzelgraben angegangen.“
„Kann Er davon leben?“
„Das just wohl!“
„Ist Er militärpflichtig? – Ich meine, ob Er sich schon einmal hat stellen müssen?“
„Ja, ich war wohl einmal, aber da haben sie mich wieder heimgehen lassen.“ –
So ging es fort. Oft war Martin verwirrt und antwortete gar nicht, und als das Verhör zur betreffenden That an der Waldkapelle kam, zitterte er und rief: „Ja, ich hab’s gethan, aber ich hab’s nicht schlecht gemeint.“
Endlich fragte man ihn gar nicht mehr und der Staatsanwalt stellte den Antrag: schweren Kerker auf zehn Jahre!
Da stand ein Mann mit langem, braunem Vollbart auf, der abgesondert an einem Tischchen saß und bisher nur wenig gesprochen hatte. Dieser hielt nun eine lange Rede. Er legte noch einmal den Thatbestand dar, sprach dann von dem unbescholtenen Vorleben, von der nichtigen Erziehung, der Erscheinung und den Verhältnissen des Wurzelgrabers und schloß endlich seine Rede:
„Wir haben, meine Herren, keinen Verbrecher vor uns, sondern ein unglückliches Opfer des Aberglaubens, das wir wohl tief bedauern, aber nicht richten können. Wir Alle, die wir uns heutzutag’ der Humanität und Bildung, des lichteren Geisteslebens erfreuen, ständen ohne Erziehung und Schule auf der Stufe, auf welcher unser Angeklagter steht. Der Unglückliche hier wäre durch eine entsprechende Ausbildung ein herrlicher Mensch geworden, edler und besser vielleicht, als einer. Der Mann hier trägt viel Menschenliebe im Herzen, das zeigt sein Streben, ein Weltbeglücker werden zu wollen. – Wer unter uns hat als begeisterter Junge in den Studentenjahren diesen Wahn nicht getheilt, freilich mit weniger Consequenz, weil wir bald sahen, daß es ein Ideal ist und unter den leidenschaftsvollen Menschen auf Erden nicht verwirklicht werden kann. Diese Aufklärung aber in dem Sinne ist unserem Manne hier nicht geworden, weil er keine Ausbildung und keine Lebensschule genoß, und so hielt er starr und fest an dem Wahne und verfolgte sein ideales Ziel[S. 262] mit Aufopferung seines eigenen Wohles. – Dazu kam der Aberglaube. Auch wir haben als Kinder Fabeln und Märchen geglaubt und würden sie noch glauben, wenn wir nicht durch ein Aeußerliches, durch die Schule und die Erfahrung eines Anderen überzeugt worden wären, denn die eigene Vernunft arbeitet sich aus dergleichen gar schwer heraus. Der Mann aber ist nicht durch ein Aeußeres eines Anderen überzeugt worden, im Gegentheile, seine Umgebung hat den Aberglauben in ihm nur noch mehr bestärkt und bestätigt. – Sie geben mir zu, meine Herren, daß ein Verbrechen, wie Mord, Brandlegung u. s. w., von einem Ungebildeten aus Aberglauben begangen, nicht so schwer in die Wagschale fällt, als wenn dasselbe von einem Gebildeten aus Haß und Rache verübt wird. Nun ist aber der gegenwärtige Fall kein Mord und keine Brandlegung, er ist kein Akt des Hasses und der Rache, nicht einmal der Eigenliebe. An einem Todten hat sich der Angeklagte vergriffen, in dem Wahne, den Lebendigen das Glück zu geben. Wollen Sie das, meine Herren, sühnen, wie ein Verbrechen? Wohl heißt es: Laßt die Todten ruhen! Aber machen Sie einmal dem anatomischen Kabinet einen Besuch, dort wird die sogenannte Ruhe auch gestört und entehrt – die Todten werden zergliedert, zerstückt – zum Vortheile der Lebendigen. – Ich behaupte nicht, daß es kein Verbrechen ist, die Gräber zu öffnen; es ist Leichenschändung und Leichenraub geschehen, diesen die vollste Strenge des Gesetzes! Der gegenwärtige Fall ist ein anderer und in Bezug auf das bereits Gesagte zu entschuldigen. – Erwägen Sie den Fall noch einmal, meine Herren, und erwägen Sie meine Worte, die ich aus der Tiefe meines Herzens für den unglücklichen Mann hier gesprochen habe. Richten Sie über das Vergehen eines Verirrten nicht, wie über ein Verbrechen.[S. 263] Die hier in Verhandlung stehende That ist nichts als ein unwissentliches Vergehen gegen die Sitte; betrachten Sie dieselbe als solches, meine Herren, und lassen Sie den armen Mann nun gewitzigt sein und heimziehen in seine Berge!“
Nach dieser Rede war es still im ganzen Saale. In Martin’s Auge hing eine große Thräne; er stürzte hin vor den Vertheidiger, umschlang seine Füße und rief: „Der ist mein einziger Freund in der Welt!“
Aber dieser wehrte kühl ab und ohne noch ein Wort zu sagen, setzte er sich an seinen Tisch. –
Die Richter erhoben sich von ihren Sitzen und traten in ein Nebenkabinet.
Der Staatsanwalt und der Vertheidiger, die sich anscheinend eben feindlich gegenüber standen, gingen jetzt zusammen und plauderten in einer Fensternische. Das Volk war unruhig und erging sich in Muthmaßungen über das zu erwartende Urtheil. Die Kerzen brannten matt und ruhig neben dem Kreuzbild und Martin saß auf seinem Schemel und starrte zu Boden.
Endlich, nach einer geraumen Zeit öffnete sich die Thür des Kabinets, die Richter traten heraus und der Vorsitzende verkündete das Urtheil.
Da Sturm und heftiges Schneegestöber wütheten, so wurde dem Wurzelgraber gesagt, er könne noch einen Tag in dem Hause bleiben, in welchem er in der Untersuchungshaft war, und man wies ihm eine wohnliche Stube an. Ein Mann brachte auch Stroh und Bindwerk in die Stube, daß er, wenn er wolle, Strohschuhe flechten könne. Aber Martin ließ das stehen, er sah immer nur durch das Fenster in das[S. 264] grau verschwommene Wehen und Wogen des Schneegestöbers hinaus. Das Fenster hatte kein Gitter, die Thür war nicht verschlossen, der Ofen war warm. Er war kein Gefangener, er war Gast und morgen lichtet sich der Himmel und es geht heim zu.
– Aber wenn doch eine Schuld in dir läge, Martin, und wenn sie dich morgen von dieser Stube wieder in den Kerker führten? – Daheim steht deine Hütte, daheim harrt Nothburga; die Hütte ist verlassen, Nothburga denkt deiner in Lieb’ und Schmerzen. Und all die Menschen halten dich für einen Missethäter! Wer soll da noch säumen eine ganze lange Nacht, wer soll da nicht heim und wenn Spieße vom Himmel fielen? –
So sann Martin, als er durch das Fenster sah.
Und als es zu dämmern begann, da hielt es der Bursche nicht mehr aus, fest zu knöpfte er seinen Rock, tief in die Stirne drückte er seinen Hut, dann schlich er fort aus der Stube, aus dem Hause wie ein Dieb.
Die Gassen des Städtchens waren leer, überall lag hoher, lockerer Schnee, ein schneidender Wind wehte dem Dahineilenden Flocken und Eisnadeln in das Gesicht. Aus den Fenstern strahlten Kaminfeuer und Abendlichter, Martin eilte davon, so gut es ging. Außerhalb des Städtchens war bald kein Weg und kein Steg mehr zu erkennen, aber der Wurzelgraber schritt rüstig über den Schneeboden dahin, gleichgiltig, ob auf Weg oder Feld oder Haide, die Richtung wußte er ja und er wußte auch wohin.
Stundenlang irrte er durch die Gegend und er kam nicht weiter; noch die Mitternachtsstunde hörte er von der Thurmuhr des Städtchens schlagen. Aber Martin war muthig, es ging ja heimwärts. Endlich kam er zum Wald und auf[S. 265] demselben lag ein Schneegewölbe und das gab einigen Schutz gegen den Sturm. Freilich war es gar finster unter den Aesten und die Wipfel rauschten unheimlich und hie und da fielen Schneeklumpen zu Boden, aber Martin achtete das nicht, er war ein Sohn des Waldes und hatte so manchen unwirthlichen Winterabend im Freien zugebracht. So ging’s fort zwischen den Stämmen und Sträuchern über Stock und Wall. Plötzlich aber kreischte Martin auf und sank fast in den Boden.
An seinem rechten Arm hatte ihn eine Hand gefaßt.
„Ei, das ist wohl gar der Leichenräuber!“ rief eine Stimme.
Eine männliche Gestalt stand vor ihm – wie aus der Erde aufgetaucht war sie gekommen.
„Beruhige Dich, Bruder,“ lachte die Gestalt, „ich kenne ja Deine Geschichte und ich weiß, daß Du unschuldig bist. Steh’ auf, Narr, wir halten uns zusammen, daß wir aus dieser Mördergrube kommen, ich hab’ Frost und Hunger. Wir wollen einander beistehen, wir haben das gleiche Geschick. Solltest Du mich noch nicht gesehen haben, so sage ich Dir, daß wir die letzten Wochen her in einem Hause gewohnt haben. Ich ließ mir von Dir erzählen und hätte nur gewünscht, mit Dir zusammen zu wohnen. Ich bin ein ehrlicher Kerl und unschuldig haben sie mich hingehalten, alberner Händel wegen, an denen ich mich gar nicht betheiligt habe. Erst in den letzten Tagen kam meine Unschuld an’s Licht und man ließ mich frei. Jetzt freilassen, jetzt zur rauhen Winterszeit! Was soll ich anfangen, ich bin nicht von hier und ich habe keinen Erwerb. Kaum die nöthige Kleidung habe ich, so daß sie mich im Zwilchrock fortgehen ließen. Was soll’s nun werden mit mir, wenn ich nicht gute Menschen finde!“
Wie diese Worte mit Lachen begonnen hatten, so hörten sie mit Weinen auf.
Martin hatte sich von seinem Schreck erholt – das war ja kein Bösewicht, der ihn überfallen wollte – ein armer Nothleidender war’s, ein Hungernder, ein Frierender. Brot hatte der Wurzelgraber keines, aber einen dichten Lodenrock, und den bot er dem Fremden bereitwillig an.
„’s ist eine Gewissenlosigkeit,“ sagte dieser, „wenn ich von Dir Rock und Hut nehme, aber wenn mir der Frost nicht schon bis an’s Herz ginge und wenn ich nicht wüßte, daß Deine Güte zu mir aus wahrer, christlicher Liebe kommt, so würde ich die Kleider nicht annehmen.“
Der Fremde nahm Martin’s Rock und Hut und warf dem Wurzelgraber die leichte Zwilchjacke und die Wollenhaube dafür hin, wie er sie aus dem Arrest mitgebracht hatte. Martin zog diese Kleider ruhig an, dann lud er den Fremden ein, daß er mit ihm gehen möge, er kenne die Gegend, er führe ihn aus dem Wald und in eine Herberge. So gingen sie weiter, Beide sprachen wenig. Ueber ihren Häuptern krachten die Aeste, einzelne brachen sogar und stürzten rauschend nieder.
Endlich kamen sie auf einen freien Platz, der mitten im Walde lag. Der Sturm hatte ein wenig nachgelassen, es war der Mond aufgegangen und er senkte sein Halblicht durch das graue Gewölke, das über den Baumwipfeln dahinjagte.
Der Fremde zog den Lodenrock eng zusammen und lehnte sich an einen Baum, er war erschöpft. Der Mond schien einen Moment in sein Gesicht, das war noch jung, aber sehr bleich. Martin stand neben seinem Gefährten und hauchte sich in die Hände.
Plötzlich horchte der Mann am Baume auf. Von der entgegengesetzten Seite des Angers war es zu hören, wie Pferdetraben.
Martin fiel wieder in Angst, aber der Fremde murmelte in sich hinein: „Geköpft wie gehangen, ein Teufel!“
Das Pferd trabte langsam heran, auf demselben saß eine von Schnee halb eingehüllte Gestalt.
– Da reitet ein nächtlicher Wanderer durch den Wald – das geht sehr langsam, das Roß ist müde, der Reiter schläft wohl gar.
Der Mann am Baume lauerte. „Sieh’ einmal,“ sagte er dann leise zu Martin, „ist das ein Leichtsinn von dem Mann, jetzt schläft er auf dem Pferd und erfriert. Man muß ihm beistehen und wecken, doch früher müssen wir sehen, mit wem wir’s zu thun haben. Jetzt, wenn das Pferd ganz nahe gekommen sein wird, so fasse Du es vorsichtig beim Zügel, ich werde den Mann wecken, daß er doch nicht erstarrt.“
Und als das Pferd ganz nahe war, faßte es Martin am Zügel und in demselben Augenblick stürzte sein Gefährte herbei und riß den Reiter nach rückwärts zu Boden.
Ein Hilferuf, ein Pistolenschuß, ein Aufschrei. Zwei Männer lagen im Schnee und rangen, ein Dritter lag in seinem Blute. Das Pferd wieherte, schlug aus und herum in einem weiten Halbkreis lief es, daß der Schnee hoch aufstaubte und der Boden dröhnte.
Endlich gelang es einem der Ringenden sich aufzuraffen, den andern von sich zu schleudern, sich auf das Pferd zu schwingen und im vollsten Galopp davon zu rennen.
Auch der Zweite erhob sich, schüttelte den Schnee von Kleidung und Bart, sah dann dem dahin eilenden Pferde nach und schüttelte den Kopf. „’s ist ein Glück, daß mich der[S. 268] Hallunke nicht erwürgt hat,“ brummte er, „das Knie preßte er mir lang’ genug in den Hals. Die Uhr mag er denn haben und mein Brauner, der wird mir schon wieder kommen. – Ach Gott, da hab’ ich ja Einen erschossen!“ rief er aus, als er unseren Martin auf dem Boden liegen und sich winden sah.
„Gerade durch’s Bein,“ wimmerte Martin, „und jetzt kann ich gar nicht weiter!“
„Du Allmacht, das ist ja der Wurzelgraber Martin!“ sagte der beraubte Mann, „aber wie kommst Du doch um des Himmels Willen unter die Straßenräuber?“
Der Arme jammerte und that den lauten zitternden Ruf: „Jetzt, was ist geschehen?“
Der Andere stand einen Moment sinnend da. „Martin,“ sagte er dann gedämpft, „steht’s so mit Dir? Nein, wenn ich gewußt, daß Du es bist, ich hätte nicht geschossen, aber sei nur ruhig, ich werde Dir das Blei schon wieder herausziehen. Mit dem Verbinden aber müssen wir’s schnell machen, dann nehm’ ich Dich mit hinaus in das Dorf.“
„Nein, in’s Dorf nicht, wenn ich Euch bitten darf, tragt mich hinein in die Stadt zum Gericht, sie werden Euch’s lohnen!“
„Zum Gericht später, jetzt komm’, ich trag’ Dich schon in’s rechte Haus.“
„Aber, ich weiß nicht, wie das ist; seid Ihr angefallen worden? Zuletzt ist wohl gar – ach, ich weiß nicht und ich versteh’s nicht – Jesus, ich bin wahnsinnig geworden!“
„Ruhig, wir müssen eilen, Dein Blut fließt in den Schnee und in Hochdorf liegt Jemand in Sterbensnoth!“
Als dieser Mann dem Unglücklichen das rechte, verwundete Bein verbunden hatte, hüllte er ihn in seinen Mantel, faßte ihn auf den Rücken und trug ihn durch den Wald.
„Ihr seid gar der Arzt von Dernau?“ fragte Martin unterwegs einmal.
„Ja, Martin.“
„Dann kenn’ ich Euch. Aber das werdet Ihr Euch von dem Martin nicht gedacht haben, das! Doch bei Gottes Kreuz und Leiden, ich hab’s nicht gewußt und nicht gewollt – –“
Er sprach nicht weiter; so heftig war der Schmerz, den er litt, daß er kaum die Kraft hatte, sich an dem Nacken seines Trägers festzuhalten.
Bergauf und thalab ging’s, über Hügel und durch Schluchten; kaum daß der Arzt in Nacht und Schnee den unsichern Fußsteig traf. Auf den Anhöhen hatte der Sturm Bäume geknickt, und man konnte es von nah’ und ferne noch hören, wie sie zusammenbrachen. In den Schluchten lag tiefer Schnee und die Aeste der Bäume drückte er nieder, daß sie den Wandelnden mit seiner Last oft und oft den Weg versperrten. Der Wolfswald ist eine unwirthliche Gegend, die Leute gehen nicht gerne durch denselben in solchen Stunden. Nur der Arzt von Dernau, der fast täglich in’s Hochdorfer Armenhaus jenseits des Waldes muß, hat den nächtlichen Ritt schon unzählige Male gemacht; freilich das, wie heute, ist ihm früher noch nie begegnet.
Der Arzt stand oft still und stellte seine Last auf einen Baumstock, dann trocknete er sich die Stirne. Es war ihm heiß trotz des eisigen Schneewehens.
„Ihr richtet Euch zugrunde!“ sagte Martin einmal leise, „lehnt mich da unter die Tanne und wenn Ihr nach Hochdorf kommt, so schickt mir ein paar Männer herüber, ich werde derweilen nicht erfrieren.“
„Martin, da würdest Du sehr krank werden!“ entgegnete der Arzt und schleppte seine Last weiter und weiter. Er zwang[S. 270] und kämpfte sich über Gestock, Gefälle und zusammengewehten Schnee und erreichte endlich die Lichtung, wo die Felder beginnen.
Und als er über die Felder hinschritt, da wurde es im östlichen Gewölke lichtgrau und auf dem Boden, wo der Wind den Schnee weggefegt hatte, sah man immer deutlicher die Steine und Halme. Und wenn Wind und Schneewehen für Augenblicke ruhig waren, so konnte man vor sich im Thale einzelne Lichter sehen und das Geklapper des Korndreschens vernehmen.
Als der Arzt gegen das Dorf kam, begegneten ihm Männer mit Aexten und Sägen.
„Grüß Gott, Doctor! heut’ zu Fuß?“ sagten Einige und hoben ein wenig ihre hohen Filzhüte.
„Dank Euch Gott!“ entgegnete der Mann, „geht schon in’s Holz?“
„’s wird wohl sein. Du heiliger Josef, was schleppt Ihr denn auf Euerem Rücken daher?“
„’s ist ein Kranker aus dem Walde,“ sagte der Arzt und schritt langsam weiter.
Warum hat er’s den Leuten nicht alles erzählt, daß sie den Räuber verfolgt hätten? – Der Mann kannte sein Pferd.
Im Dorfe selbst begegnete ihm Niemand. In einigen Bauernhäusern hatte man Licht in der Stube, in anderen war es dunkel. Hie und da krähte ein Hahn.
Der Wind hatte nachgelassen, aber Schneeflocken fielen nieder und legten sich dicht und dichter auf die Strohdächer auf alle Pfähle, Brunnentröge und Zaunstangen. Und was sich an den Rücken des mühsam einherschreitenden Mannes schmiegte – kaum war es unter dem Schnee mehr zu erkennen, was es war.
Endlich, gegen Ende des Dorfes, etwas abseits vom Weg, stand ein altes Gebäude aus Stein mit Erker und Thürmchen. Das Dach stand an einzelnen Stellen weit hervor, die Fenster waren groß, aber vergittert. Ueber dem weiten, doch geschlossenen Thor an der Mauer war ein Gemälde, den barmherzigen Samariter darstellend, wie er den unter Straßenräuber gefallenen Mann auf die Schulter ladet.
Diesem Hause ging der Arzt zu und zog am Eingange die Glockenstange.
Bald öffnete sich das Thor und die Schließerin, ein altes Mütterchen, streckte dem Ankömmling die Hand entgegen: „Gott sei Dank, weil Ihr doch endlich nur da seid!“
„Gibt’s was?“
„Ach sonst nichts, aber –“
„Was macht die Kranke?“
„Mein, die ist rechtschaffen passabel, seit Mitternacht hat sie einen guten Schlaf; aber Ihr, was ist Euch denn geschehen? Nein, dieser Schreck, da kommt das Roß allein...“
„Das Roß? Mein Pferd ist gekommen?“
„Jesus Christus, wer hockt Euch denn auf dem Nacken, Doctor?“
„Laßt mich nur erst in die warme Stube und richtet Eis,“ sagte der Arzt.
Jetzt kamen auch andere Leute herbei, Männer, Frauen, theilweise in Binden und an Krücken. Alle schrieen: „Nu schaut’s, da ist er ja; Gott sei Lob und Preis, weil er nur da ist!“ –
Und als der Mann im Zimmer war, ließ er seine Last auf ein Ledersofa gleiten und sagte: „So, Martin, jetzt sind wir daheim. Schau, für dieses Haus hast Du mir oft die Wurzeln und Kräuter gesammelt. Wie ist Dir, hast Du großen Schmerz?“
Martin zitterte und der Arzt nahm ihm den schneeigen Mantel und die nasse Zwilchjacke ab, dann rief er in ein Nebenzimmer, daß man frische Decken und ein Glas Wasser bringe.
„Aber,“ murmelte Martin, „das war doch ein höllischer Lump! Meinen Rock hat er auch!“ Dann nahm er einen Schluck Wasser.
Später sagte er zum Arzt: „Da habt Ihr mich jetzt so weit hergetragen und seid doch um zwanzig Jahr’ älter als ich.“
Und der Morgen, der durch die Fenster strahlte, zeigte es, der Arzt hatte viele graue Haare auf dem Haupte und im Vollbart; sein Gesicht war etwas durchfurcht und sehr gebräunt, und wenn er sprach oder lächelte, so lag auf demselben ein Zug – eigen und merkwürdig – eine wunderbare Handschrift der Seele. Die Gestalt des Mannes war groß und trug ein bequemes Winterkleid aus grauem Loden. Der Nacken war etwas gebeugt – wohl noch von der Last, die er in’s Asyl getragen! –
Im hohen, geräumigen, etwas alterthümlich eingerichteten Zimmer stand ein brauner Kasten. Diesen öffnete nun der Arzt und zog eine Lade heraus, in welcher viele Instrumente aus Messing und Stahl und verschiedene andere Gegenstände waren. Dann verlangte er von den zu- und abgehenden Personen noch dies und das und nahm hierauf dem Wurzelgraber die Binde ab, schnitt das Beinkleid auf und untersuchte, wie es mit dem Fuße aussah, welche Verheerungen sein Schrotschuß angerichtet hatte.
„Drei Körner stecken d’rin, Martin, aber wir werden sie schon heraus kriegen; ein wenig schmerzen wird’s wohl, aber ’s ist gleich vorüber.“
„Schmerzen, meint der Herr? Nein, wenn ich an Anderes denke, schmerzt sonst gar nichts. Ich thu’ Euch’s nur früher erzählen, wie’s gekommen ist, Doctor!“
„Hernach, hernach, lieber Freund, jetzt ist hohe Zeit, daß wir daran gehen.“
„Werdet das wohl selbst am besten verstehen, aber wenn’s nun so gäh mit mir sollt’ gar werden! – Ich will’s doch früher erzählen.“
„Wirst mir noch Alles erzählen, Martin, aber jetzt mußt Du ruhig sein.“
„So glaubt mir doch, daß ich Euch nicht angefallen hab’. Ich weiß gar nicht, wie das gewesen ist.“
Der Arzt reichte dem Wurzelgraber die Hand, dann begann er die Operation.
Sie war lang und mühvoll. Martin klammerte seine linke Hand krampfhaft an die Lehne des Sofas und die rechte hatte sich tief in seine Locken eingegraben. So lag er da, starr und ruhig – er bebte nicht, er klagte nicht; nur einmal, als das Eisen im Beine krachte, zuckten seine Lippen, aber dann drückte er sie fest zusammen, bis Alles vorüber war und der Arzt sagte: „Jetzt, mein Lieber, wird’s gewonnen sein; hast Dich brav dabei gehalten. Jetzt wirst Du eine Suppe essen und dann schau, daß Du einschlafen kannst, bis Mittag komm’ ich wieder zu Dir.“
Nach diesen Worten ging er und schrieb einen Brief an das Kreisgericht, den er sogleich durch einen eigenen Boten absandte.
„Schläft sie immer noch?“ fragte später der Doctor.
„Vor einer halben Stunde hat sie die Augen aufgeschlagen und nach Euch gefragt,“ berichtete die Wärterin,[S. 274] „seitdem schläft sie wieder. Aber jetzt sagt uns doch, das Roß hat Euch wohl abgeworfen? Gerade wie der Tag anbricht, kommt es allein in den Hof, es ist halb wild und der Peter mag’s völlig nicht in den Sattel bringen.“
Sofort erzählte der Doctor, wie er gestern im Laufe des Nachmittags dringende Krankenbesuche gehabt habe, wie er erst am Abend nach Dernau kam, dort ein paar Stunden ruhte, und wie er gegen Mitternacht aufbrach, um nach Hochdorf zu reiten, der Kranken wegen, die in der Krisis liegt. – Wie er nun im Schneesturm, fest in den Mantel gehüllt, durch den Wolfswald so dahin traben läßt, dabei schier einschlummert, bleibt das Pferd plötzlich stehen und er wird nach rückwärts zu Boden gerissen. Noch schießt er sein Pistol gegen eine Gestalt ab, aber schon drückt ihn ein Mann fest in den Schnee, entreißt ihm die Börse und die Uhr und flieht mit dem Pferde davon. Erst jetzt gewahrt der Beraubte den Verwundeten, den Martin, der vor einiger Zeit wegen einer sonderbaren Geschichte in den Arrest kam. Wie das zusammenhängt und wie der arme Bursche in die Hände von Spitzbuben gefallen ist, das müsse sich erst aufklären.
So erzählte der Doctor und dann ließ er mehrere Bauern von Hochdorf entbieten, in den Wolfswald zu gehen und die Gegend zu durchsuchen.
Im ersten Stock des alten Hauses war eine große Stube mit vielen Schränken und Betten und zwei grünen Kachelöfen, in welchen es recht lebendig knisterte.
Die Betten waren einfach, aber sehr reinlich und zu dieser Morgenstunde alle bereits geschichtet. Neben den Betten auf Lederstühlen saßen alte, krüppelhafte Männer und Weiber und sie sprachen leise zusammen und Jedes hatte eine kleine Beschäftigung.
Ein einziges Bett an einer Ecke war mit einer weißen Blache verhangen, daneben stand ein Tisch mit Tassen und Fläschchen.
In diese Stube ging nun der Doctor, nachdem er unten eine Fleischbrühe zu sich genommen hatte.
Wie er eintrat, humpelten Alle von ihren Plätzen herbei und gaben ihm die Hand. Er drückte jede und sprach freundliche Worte. Dann ging er zum Bett, das mit einer Blache verhangen war.
Langsam zog er diese seitwärts.
Im Bette lag ein Mädchen. Es lag da wie eine Leiche, eine Hand über der Brust, bleich das junge, liebliche Antlitz, mit geschlossenen Augen und losen, reichen Haaren. Das Mädchen, wie es dalag im Dunkeln, war schön wie eine weiße Blume in der Waldschlucht – wie eine Mondnacht.
Lange hielt der Doctor den Vorhang seitwärts und sah hin, und endlich beugte er sich langsam nieder zur Schlummernden, zu ihrem Mund, um zu fühlen, ob sie athme.
Und sie athmete.
Jetzt faßte er sanft ihre Hand und jetzt bewegte sich diese und das Mädchen schlug halb die Augen auf.
„Nothburga, hast Du jetzt geschlafen?“ sagte der Mann leise.
„Ah,“ hauchte die Kranke überrascht, „jetzt seid Ihr doch wieder da. Nein, ich hab’ nur so geträumt, – es kommt mir immer noch vor, ich seh’ ihn liegen mit der großen Wunde.“
„Ich werde Dir eine Schale Mandelmilch reichen, das beruhigt; schau, Du wirst jetzt bald wieder gesund sein.“
Nothburga richtete sich mit Hilfe des Arztes auf und trank einige Tropfen von der Mandelmilch. Dann blickte sie den Mann treuherzig an und sagte: „Und jetzt hätt’ ich Euch wohl wieder gern gebeten, daß Ihr Zither spielt.“
Der Doctor lächelte. Sogleich lächelte die Kranke auch, denn sein Lächeln war für die Menschen immer das, was ein Sonnenstrahl für die Veilchen ist.
„Ja, wenn ich Dir, liebes Kind, damit eine Freude mach’, so werde ich spielen. Mutter Anna, Ihr holt mir wohl gerne die Zither von meiner Stube, sie hängt neben dem Bücherschrank; der Schlüssel steckt an der Thür.“
Und ein altes Mütterlein, das nur die rechte Hand hatte – die linke nahm ihm vor Jahren der Doctor ab – humpelte jetzt fort und kam bald wieder mit dem Instrument zurück.
Auch alle Anderen waren leise herbeigekommen und stellten sich um das Bett und das Tischchen, an dem nun der Doctor saß und die Saiten stimmte.
Endlich tönten diese zusammen in harmonischem Vielklang, und als ein Liedchen zu Ende war, fragte der Mann etwas schalkhaft: „Gefällt das der Nothburga?“
Die Kranke lächelte und er spielte weiter.
Aber plötzlich brach er das Spiel wieder ab und heiter zu den alten Männern und Frauen gewendet, sagte er: „Was thätet Ihr sagen, wenn die Nothburga Frau Doctorin würde?“
Da lachten sie Alle und meinten: „Der Nothburga wäre das schon zu gönnen.“
„Ei, das wäre wohl kein Glück für die Nothburga. Ich bin ein Vierziger und bin grau und griesgrämig; ich gehöre hin, wo die Krankheit ist, und Nothburga blüht erst auf und gehört zum Leben. ’s wird schon Einer kommen, der das mitbringt, werde nur erst gesund, Nothburga!“
„Ach, so lang’ ich ihn noch liegen seh’ mit der großen Wunde,“ entgegnete das Mädchen leise und langsam, „und so lange sie den Martin nicht wieder zurückgeben und sagen: er ist unschuldig, so lang’ kann ich nicht mehr gesund sein.“
Der Doctor griff wieder in die Saiten, sang ein heiteres Lied und einen Jodler dazu, so recht derb und lustig, daß die Weiber sagten: „Na, und jetzt ist er wieder wie ein Bauernbursch oben im Gebirg.“
Nur das Ende war nicht so. Das letzte Ausklingen eines Jodlers hat ein so eigenartig, innig Lustiges, daß es nur der geborene Aelpler recht hervorsprudeln und austrillern kann; ein Anderer kann es nicht, das letzte Ausklingen gelingt ihm nicht.
Endlich erhob sich der Doctor und sagte zu Nothburga: „Und jetzt muß ich ein wenig arbeiten; die Josefa bleibt bei Dir. Bevor ich fort nach Dernau geh’, komm ich schon noch einmal. Wenn Du dann endlich etwas stärker bist, werde ich Dir was Lustiges sagen. Die Mutter Anna trägt mir wohl wieder die Zither auf meine Stube?“
Dann ging er, um sich nach Martin umzusehen.
Als er die Treppe hinabstieg, eilte ihm schon die Schließerin entgegen: „Ach, man meint, man findet Euch gar nicht, Herr, kommt doch gleich hinab in den Hof, sie haben einen Todten gebracht!“
Und als der Doctor hinab kam in den Hof, da standen unter einem Vordach Leute, die lebhaft miteinander sprachen und Alle nach einem Fleck hinsahen.
Dort, auf zwei ineinander geflochtenen Baumästen lag der Todte. Es war das Leichentuch noch darauf, das der Wald und der Winter ihm geschenkt hatte; man wollte nichts an der Leiche anrühren, nicht einmal den Schnee herabfegen, so lange nicht der Arzt kam.
Als dieser nun dastand, traten drei Bauernbursche, wie sie ihm am Morgen im Walde begegnet waren, heran und sagten: „Haben heut’ einen traurigen Fund gemacht!“
„Wir sammeln dürres Gefälle zu Brennholz,“ erzählte einer der Burschen, „und waten so im Schnee herum. Sagt auf einmal der Georg – Du, sagt er, da liegt auch ein nutzes (beträchtliches) Stück, das müssen wir heraus ziehen. Und wie er den Haken in den Schnee haut, sagt er: Das ist ja gar kein Holz! – Nein sag’ ich, was wird’s denn sonst sein? und hau auch in den Schnee. Jesus, schreit d’rauf der Georg, eine Menschenhand! und – ’s war nicht anders. Rechtschaffen g’schreckt hat’s uns und wir haben Keiner wollen angreifen. Sagt noch der Poldl: Ziehen wir ihn nur in Gottesnamen heraus, muß halt erfroren sein; zuletzt ist er gar nicht todt, er ist noch völlig weich. Und so haben wir ihn aus dem Schnee gezogen, haben ihm gleich Schuh’ und Strümpf’ herab gerissen und die Füße gerieben. Und wir haben ihn gerüttelt und noch stärker gerieben – nein, was wir gearbeitet haben! Aber ’s war halt aus und vorbei. ’s ist ein wildfremder Mensch, wohin sollen wir ihn denn tragen als in’s Armenhaus? Wir haben noch gerathen und hin und her geredet; der Doctor ist heut’ dort, haben wir gesagt, und der wird schon wissen, was zu machen ist. Ein rechtschaffen trauriges Geschäft! – Und da haben wir ihn jetzt.“
Sofort besichtigte der Doctor die Leiche. Es war ein junger Mann mit langen blonden Locken. Augen und Mund waren halb offen, von dem linken Mundwinkel über die Wange war eine röthlich braune Eiskruste – der Verunglückte mußte aus dem Mund geblutet haben. Hände und Füße waren blau angelaufen. Das Beinkleid war von grauer Leinwand, der Rock aus Loden. Um den Hals hing der Leiche eine Sackuhr mit zerbrochenem Glase.
Ohne ein Wort zu sagen, löste der Doctor die Uhr ab und legte sie nebenhin auf ein Brett. Dann untersuchte er Schädel und Hals.
„Erfroren ist der Mann nicht,“ sagte er, „es zeigt auf einen Fall, es ist das Genick gebrochen.“
„Du ewiger Heiland!“ schrie die Beschließerin plötzlich, „Doctor, das ist ja Euere Uhr und der ist gewiß Euer Räuber!“
„Mag wohl sein,“ sagte der Mann ruhig, „tragt jetzt die Leiche in die Todtenkammer, alles Andere werde ich schon besorgen. Den Gotteslohn für das Hertragen aber müßt Ihr Euch wohl beim Gericht holen.“
Und die Bursche hoben die Leiche und trugen sie in die Todtenkammer.
Der Arzt ging in das Zimmer, wo Martin war. Dieser lag in mehrere Decken eingehüllt auf dem Ledersofa und schlief.
Der Doctor stand sehr lange vor dem Schlafenden und sah ihn an. – Beide, die noch vor wenigen Stunden gemeinsam auf Verbrecherpfaden wandelten, schlafen nun. Beide sind gerichtet. Der Eine wird nicht mehr erwachen; sein Staub, der den Menschen einst Uebles gethan, wird Blumen und Rosen bringen. – Der Andere wird wieder erwachen zu seinem alten, elenden Leben, und sein Leben wird noch elender sein, als bisher. Elend am Geist, ist er nun auch elend am Körper – elend zum Erbarmen, unglücklich und immer unglücklich, bis zum Sterben. Und hat er nicht das Recht zu einem hellen, freudigen Leben wie jeder Andere? –
Langsam schritt der Doctor über die Treppe, ging in seine Stube und schloß sich ein. Zitternd klangen die Saiten in das Gemüth des Mannes:
Der Mann sah durch das Fenster hinaus in den Wintersturm. Das ist die Erde. – – –
– – – Und Nothburga ist so jung und schön, sie ist eines besseren Schicksals würdig. Und Martin ist ein Narr, er sucht das Reich Gottes unter den Menschen. Noch ist er jung – in seinem ferneren Leben wird er’s immer mehr einsehen, daß er vergebens gesucht, daß sein Jugendstreben eitle That eines Träumenden war, daß sein Leben ein verlorenes ist. Allen Halt einer Erziehung und geregelten Ausbildung entbehrend, wird er mit sich und Allem zerfallen. Das empfindsame, weiche Gemüth, sonst die erste Bedingung eines guten Menschen, wird diesem Manne zum materiellen und moralischen Verderben, denn es hat von seiner Umgebung doppelt tief die Eindrücke fanatischer, vorurtheilsvoller Gebilde aufgenommen, das Gegengewicht aber, eine freie, planmäßige Ausbildung entbehren müssen. – So ist er das geworden, was er ist, ein edles Wollen ohne Plan, eine redliche Seele im Wahn, eine Kraft auf falscher Bahn. – Zu sehr befangen in sich, wird alle äußere Einwirkung auf ihn erfolglos bleiben – er fährt einen seltenen Weg, aber er fährt rasch und rettungslos in’s Verderben. – ’s wär’ ein Glück für ihn, wenn’s aus wär’. – –
An diese Gedanken des Doctors reihten sich noch andere, schwerere, dunklere – endlich fuhr er rasch in die Saiten der Zither. Dann öffnete er einen Fensterflügel und ließ eisige Luft herein strömen. Eine große Schneeflocke fiel auf die Saiten und löste sich langsam und sanft auf dem klingenden Tonbrett...
Der Doctor schrieb Briefe an das Bezirksamt und das Kreisgericht. Dann ging er in seine Apotheke, die neben der Bücherstube war, und arbeitete eine Zeit.
Als es Mittag wurde, stieg er hinab zur Stube Martin’s. Dieser saß bereits auf seinem Lager und blickte wirr und verloren umher.
„Hab’ schier nicht gewußt, wo ich bin,“ sagte er zum Doctor und lächelte ein wenig. „Es ist mir gewesen, als hätt’ ich es schon gefunden; ich hab’ immer zu hoch geschaut, wo die Blumen sind und wo die Menschen lachen und weinen. Aber es liegt tiefer, Herr, es liegt tiefer, es liegt dort, wo die Blumen ihre Wurzeln haben. – Da schaut nur, ich liege unten, aus meiner Brust schlägt ein Keim hervor und dieser wächst herauf. Da wird er grün und weiß und roth und mitten im Kelche liegt ein Samenkorn. Da kommt ein Vöglein und dieses trägt das Samenkorn hinaus zu den Menschen; diese lachen und werfen es unter das Gestein. Aus dem Gestein wächst nach tausend Jahren ein Kraut, und das ist das Kraut für das Menschenglück. – In meinem Leben hab’ ich nicht so wunderlich geträumt! Wenn’s wahr wär’ und wenn’s halt doch wahr wär’, so möcht’ ich Euch wohl bitten, laßt mich hinab legen!“
Der Arzt faßte die linke Hand Martin’s und forschte nach dem Blutlauf, dann ließ er dem Kranken ein kühlendes Getränk bringen.
Später untersuchte er das wunde Bein, es war in Ordnung. Dann als Martin ganz wach und ruhig geworden war, sagte der Doctor: „Nun, Martin, magst Du mir erzählen, wie Dir’s bei Gericht ergangen ist und wie Du in den Wald und vor meinen Schuß kamst?“
Das Leben des Wurzelgrabers bis zu jenem Kirchweihfeste war dem Doctor bekannt; Martin erzählte also sein Schicksal von seiner Gefangennahme durch die Holzknechte bis zur Stunde, wo er veranlaßt durch den Fremden im Walde in der Absicht, den Reiter vor dem Erfrieren zu retten, das Pferd anhielt.
Sein Erzählen war ziemlich zusammenhängend und ruhig, und als er damit zu Ende war, sagte er heiter: „So und nicht anders war’s, und jetzt mein’ ich, ist mein Fuß auch gut.“
Der Doctor war nachdenkend. ’s ist auch nicht begreiflich, warum man Dem Bleikörner in das Bein jagen muß, der Einem das Leben retten will?
„Ich werde jetzt nach Dernau gehen, komme aber morgen wieder, um zu sehen, wie es Dir geht,“ sagte der Arzt, „sei schön ruhig und thue so, wie es die Pflegerin verlangt, dann wirst Du bald gesund sein, und wenn Du gesund bist, so werden wir zusammen vielleicht einmal was Fröhliches erleben.“
„Ich hätt’ Euch wohl noch um was bitten mögen, Doctor!“
„So sag’s nur gleich, Martin, sei zu mir ganz offen.“
„– Da hab’ ich auf der Kirchweih mit einem Mädl getanzt – Nothburga heißt es, und ich kenn’ es schon länger, es war die Schwester von Dem, den sie auf der Kirchweih erschlagen haben. Nothburga wird gewiß glauben, ich bin noch im Gefängniß und ich bin wirklich so schlecht, weil sie mich in’s Gefängniß geworfen haben. Wir haben sonst gar nichts miteinander, ich und die Nothburga, aber ich mag nicht, daß sie so schlecht von mir denkt, und da hab’ ich Euch[S. 283] halt bitten wollen, daß Ihr ein paar Zeilen für mich an die Nothburga schreibt; sie wohnt oben im Freiwaldgraben beim Wegmacher Hans, der ihr Vater ist.“
Der Doctor versprach, das zu besorgen, und verließ dann den Kranken.
Noch ging er in den Saal hinauf, wo viele Betten standen, und zu Nothburga. Sie lag ruhig auf ihrem Polster und hatte ein Gebetbuch in der Hand.
„Ich werde jetzt fortgehen und erst morgen am späten Mittag wiederkommen; sei immer hübsch ruhig, Nothburga, und thue, wie es die Pflegerin verlangt.“ Das sagte der Doctor noch zum Mädchen, faßte milde dessen linke Hand und hielt sie lange in der seinen, um den Blutlauf zu beobachten.
Dann gab er der Pflegerin, der Schließerin und Anderen Befehle über das ganze Hauswesen, besonders nachdrückliche über den Wurzelgraber und die Nothburga.
„Sollen diese hier genesen,“ sagte er, „so darf Eines von dem Andern vorläufig nichts wissen!“
So bestieg der Doctor seinen Braunen und ritt durch das Dorf. Das Schneien hatte aufgehört, Nebel lag über der ganzen, winterlichen Landschaft.
Der Doctor ritt nicht mehr durch den Wolfswald – dort waren ja alle Pfade verschneit und verweht – sondern er machte einen Umweg die Fahrstraße entlang. Diese war einsam und öde; nur dann und wann begegnete ihm ein Holzkarren, sonst wollte heute Niemand fahren.
Der Doctor ließ das Pferd langsam hintraben, hüllte sich dicht in seinen weiten Mantel und hing seinen Gedanken nach.
Seine Gedanken waren im Armenhaus zu Hochdorf, in seiner einsamen Stube zu Dernau und bei seinen Kranken in den zerstreuten Bauerngehöften im Gebirge, dann wieder waren sie draußen in der großen Welt und weit zurück in den längst entflohenen Jahren seiner Jugend.
Das Geschlecht der Grafen Preisheim war alt und berühmt, es hatte viel für das Vaterland geleistet. Als aber die große Zeit der deutschen Befreiungskriege kam, da konnte das Geschlecht seinen Mann nicht stellen; es war Niemand mehr davon da als ein achtzigjähriger Greis und dessen Enkel, ein Knabe mit goldigen Locken. Der Knabe war sehr kräftig und aufgeweckt und eines Tages nahm er das Schwert seiner Väter und wollte fort in den Krieg. Sein Großvater aber sagte: „Bleibe, Ludwig, Du bist noch ein Kind! Bis Du groß geworden sein wirst, werden schon noch andere Zeiten kommen, daß Du dem Vaterlande nützen kannst, bis dahin will ich Dich dazu erziehen.“
Der Knabe hing das Schwert in dem Waffensaale wieder auf, und dort hing es viele Jahre – Ludwig nahm es nicht mehr herab.
Bis in das zwölfte Jahr blieb Ludwig in dem Schlosse seiner Väter und genoß die Erziehung des Großvaters, dann ging er in eine ferne Stadt und lernte die Weltweisheit, die in den Büchern steht.
Neben ihm auf den Schulbänken saßen auch noch viele andere junge Menschen, die dasselbe lernten, aber von geringerer Abstammung waren als er. Nur noch Einer saß in der Schule, der sich Freiherr nennen ließ.
Als Ludwig vierzehn Jahre alt war, erhielt er von seinem Großvater einen Brief, in welchem folgende Worte[S. 285] standen: „Mein geliebter Enkel! Die schweren Kriegszeiten haben unser Vermögen zerrüttet und den größten Theil desselben verschlungen. Lerne mit Fleiß und Ernst, daß Du im Stande bist, durch Dich selbst was zu werden. Dein treuer Großvater.“ –
Ludwig las den Brief, legte ihn dann in sein Schreibfach und studirte.
Ein Jahr später kam wieder ein Brief und dieser enthielt folgende Kunde: „An Seine Edelgeboren, den Grafen Ludwig Preisheim. Mir obliegt die traurige Pflicht, Ihnen den Tod Ihres Großvaters, des Herrn Grafen Roderich Preisheim anzuzeigen. Derselbe entschlief gestern nach einem kurzen Krankenlager selig in dem Herrn. P. Johannes, Pfarrer.“
Ludwig las den Brief, stützte lange den Kopf auf seine Hand, legte das Papier in sein Schreibfach und rüstete sich zur Abreise.
Als er nach Tagen heimkam in seine Vaterburg, ging er in das Zimmer seines Großvaters, sah den Stuhl an, wo er oft gesessen, und das Bett, in welchem er gestorben war. Dann ging er auf den Kirchhof, wo die Ahnengruft war, dort kniete er lange auf dem breiten Stein.
Dann entließ er alle Leute, die im Schlosse waren, verkaufte dasselbe und deckte die auf dem Gute liegenden Verpflichtungen. Weit drin im Gebirge besaßen die Preisheimer noch ein kleines, altes Schloß mit einigen Grundstücken; das verkaufte Ludwig nicht, sondern stellte einen Verwalter in dasselbe.
Als nun Alles so geschlichtet war, reiste Ludwig wieder in die ferne Stadt und studirte. Er wählte sich die Naturwissenschaften und die Medicin.
Zeit und Zeit ging nun ruhig dahin und wenn die Ferien kamen, lud er immer einen oder den andern seiner Collegen ein, mit ihm in die Gegend zu reisen, wo das Schloß stand.
Als Ludwig in das achtzehnte Jahr ging, da trug sich mit ihm was zu, was sich mit allen Studenten zuträgt, wenn sie in das achtzehnte Jahr gehen.
Er verliebte sich.
Und gerade um dieselbe Zeit verliebte sich auch der Freiherr, der mit Ludwig in einer Classe saß. Beide suchten in den freien Stunden einsame Wege, dachten an ihre Herzenskönigin und besangen sie durch selbst erfundene Verse.
Auf solchen Wegen trafen die beiden Jünglinge einmal zusammen, gestanden einander, daß sie liebten, und schlossen als Schicksalsbrüder engere Freundschaft. Aber diese Freundschaft war von kurzer Dauer, bald klärte es sich auf, daß die Mädchen, welche sie liebten, zusammen nur ein Herz hatten und daß dieses Herz einer Gärtnerstochter gehörte, die sehr schön war.
Als sich dieses aufgeklärt hatte, trat der Freiherr hin vor Ludwig und sagte: „Wir wollen uns duelliren!“
Darauf entgegnete Ludwig: „Wenn das Dein Ernst ist, so bist Du ein Narr, wie Alle, denen derlei Ernst ist. Das Mädchen selbst soll sagen, ob es Einen von uns nehmen mag, und welchen; demgemäß wollen wir dann ruhig handeln.“
Auf diese Worte schrie der Freiherr: „Graf Ludwig, Du bist ein Feigling!“ Da der Graf von sehr schöner Gestalt und allerorts beliebt war, so glaubte der Baron voraussehen zu können, daß das Mädchen denselben ihm vorziehen würde.
Von dieser Zeit an mußte Ludwig immer allein gehen. Seine Collegen wollten nichts mit ihm zu thun haben, sie grüßten ihn kaum auf der Gasse, in Gelagen stieß Keiner mit ihm an und auf der Bank des Lehrsaales, wo er saß, saß sonst Keiner, als er. „Ein gräflich Blut und solche Feigheit!“ flüsterten sich die Jungen hinter seinem Rücken zu.
Das that dem Jungen weh, weil die Collegen ihn mieden und sein gräflich Blut beschimpften und weil er die Gesellschaft bedauerte, die von derlei falschen Grundsätzen noch so allgemein beherrscht wurde, die aber die gebildete und maßgebende heißen wollte und von der er lernen sollte. – Was der Bauer im Jähzorn thut und nach eingetretener Nüchternheit bereut, thut der Duellirende in kalter Ueberlegung und mehr noch – weil er glaubt, sein gegebenes Ehrenwort rufe ihn, schießt er todt. Ehrenhalber wird Einer wegen nichtsbedeutender Albernheiten der Flegeljahre zum Krüppel gemacht oder zu Tode geschossen.
Dergleichen dachte unser junger Gelehrter oft und oft und dergleichen gab ihm nach und nach eine andere Richtung.
Er sonderte sich immer mehr und mehr von dem Menschenkreis, in dem er lebte, und begann mit demselben zu zerfallen. Er widmete sich ausschließlich seinen Studien und als sich aus denselben ein vorzügliches Resultat ergab, kam er zum Entschluß, seinen Wirkungskreis als Mensch und Staatsbürger auf ein Feld zu stellen, das unbeleckt von der Aftercultur, einen dankbaren Boden für würdige Mannesthaten bietet.
Wohl nahm er nach seinen vollendeten Studien in einem großen Lazareth der Stadt eine Assistentenstelle an, erwarb den Doctortitel, lebte im Allgemeinen aber abgeschlossen ganz seinen wissenschaftlichen Forschungen und den Nothleidenden.
Da stand aber gegenüber dem Armen- und Siechenhaus ein großes Palais, in welchem tagtäglich glänzende Mahlzeiten, Bälle, Ballete, Concerte u. s. w. wechselten und die reiche, moderne Welt ihre Orgien feierte.
Die Gegenüberstellung dieser beiden Häuser verleitete unseren jungen Doctor zum Nachdenken und zu Reflexionen, die für ihn quälend waren.
So wahr und ernst die Aufopferung des jungen Arztes für die leidende Menschheit war, so dachte er doch endlich auch an sich selbst, wie sich seine Zukunft gestalten müsse, daß sein Leben und Wirken auch zu seinem eigenen Wohle werden könnte.
– Für dich, du Schwärmer – sagte er dann oft in Gedanken zu sich selbst – wäre eine Dorfgemeinde recht, draußen in irgend einem Bergwinkel bei einfachen Landleuten. Da könntest du ruhig leben, der Menschen Freund sein und sie dir zu Freunden machen, und da würdest du in Einheit mit der Natur dein Leben und Können und Wissen vervollständigen. Den Grafen ließest du hübsch hier in der Stadt, nur den Menschen nähmest du mit. Man meint, es müßte ja gehen! –
Und es ging.
Eine Zeitung brachte die Nachricht, daß in Dernau, einem großen Dorfe am Fuße der Alpen, eine Chirurgenstelle zu besetzen sei. Preisheim reiste in die Gegend, in welcher auch das Schloß lag, das ihm von den großen Besitzungen seiner Ahnen geblieben war, bewarb sich um die Stelle in Dernau, erhielt sie und zog nach wenigen Wochen für immer fort von der großen Stadt und gründete sein Haus und Heim unter den Bauern am Fuße der Alpen.
So lebte er nun in seinem kleinen Hause und in den ersten Jahren hatte er sehr viel Zeit zum Studiren. Es kam selten Jemand, der ihn zu einem Kranken holte; die Leute gingen lieber zu Winkelärzten und Curpfuschern, wie sie in der Gegend lebten, als zum fremden Doctor aus der Stadt, der immer einen schwarzen Rock anhatte.
Als aber die Zeit kam, in welcher der schwarze Rock seine Dienste nicht mehr versehen konnte, ersetzte ihn der Doctor durch einen grauen, wie ihn die Bauern und die Winkelärzte trugen.
Jetzt erst kamen sie – zuerst für einen Kranken, der von anderen Aerzten aufgegeben war, und als dieser genaß, auch für andere; bald wurde er zu Lungenentzündungen und zum Typhus gerufen. Und Preisheim hatte Glück; den Kranken gewann er das Vertrauen ab und den Gesunden die Herzen. Er war sehr gewissenhaft; er gab nicht allein den Kranken die Mittel, zu gesunden, sondern auch den Gesunden, um nicht zu erkranken. Freilich sagte der alte Todtengräber einmal, als ihm der Doctor einen heilsamen Trank gegen das Fieber zu bereiten lehrte: „Ja, da bringt sich ja der Herr selbst um’s Brot!“
Aber der Herr hatte immer ein’s zu essen; für Zwei hätte es auch noch ausgelangt, aber der Mann schien ganz darauf zu vergessen. – Ja, vielleicht wenn jene Gärtnerstochter da gewesen wäre! Unmittelbar vor seiner Abreise aus der Stadt hatte er sie noch einmal gesehen: wie er aus dem Siechenhaus trat, trug man sie hinein. Der Freiherr hatte sie geschickt. –
So klein und niedlich das Häuschen des Doctors war und so viel Arbeit es gab im Garten, in der Studirstube, in der Apotheke, die sich der Doctor selbst eingerichtet hatte,[S. 290] so schlug die Schwarzwälderuhr an der Wand doch Stunden, in denen es ihn schmerzte, daß er allein war. Da ging er wohl oft, die Hände auf dem Rücken, durch das Zimmer und dachte so nach über sich und über den Weltgang, und endlich ging er gar in das Stübchen seiner alten Haushälterin und sagte: „Hat die Barbara denn gar keine Arbeit für mich? Wenn nicht, so spiel’ mir die Barbara ein wenig was auf der Zither!“
Sie waren schon recht steif und ungelenk, die Finger der Alten, sie hatten schon viel gefaßt und gegraben im Leben, darum sagte Barbara auf des Doctors Bitte auch immer: „Mein’, das wird Euch aber gefallen, wenn ich klimpere! Lernt es doch selbst, Euere Finger sind noch gelenkig dazu.“
Und Doctor Preisheim lernte das Zitherspielen. Er spielte wohl die Lieder der Bauern, die Jodler und Almer, aber er spielte sie anders; er spielte schön, aber nicht ganz so lustig und frisch wie Andere im Dorfe, die es konnten. Es ließ sich bei seiner Zither nicht recht tanzen und aufjauchzen, man mußte zuhören, wie man dem Bachrauschen und dem Waldsäuseln zuhört, wenn man auf der Au ruht und träumt. Es war eigen beim Doctor, man sagte später, mit diesem Saitenspiel habe er Todtkranke kerngesund und Kerngesunde todtkrank gemacht. –
Das Schloß des Doctors lag nur wenige Stunden von Dernau im Orte Hochdorf. Der Mann ging öfters den Fahrweg, oder auch den Fußsteig durch den Wolfswald nach Hochdorf und sah das alte Mauerwerk von außen und von innen an. Außer dem Verwalter und einigen Dienstboten, welche die dazu gehörigen Felder bearbeiteten, wohnte Niemand im Schlosse. Düster und öde stand es da.
Der Doctor dachte oft nach, was damit anzufangen sei.
Ein Bauer wollte einen Theil des Gebäudes zu einer Heuscheune pachten, aber der Doctor war nicht damit einverstanden. Der Bauer sagte noch: „Nu, viel zu gut, mein’ ich, wär’ die Rumpelkammer just nicht dazu; es gehen ohnehin die Geister drin um!“
Und richtig, kaum ein Jahr vorüber war, gingen im alten Schlosse die Geister um – mitsammt den Leibern.
Sie waren dem Doctor auf seinen Wegen und Stegen nur zu oft begegnet mit ihren bleichen Gesichtern und hohlen Augen, zähnegeklappert hatten sie in kalten Wintertagen und an düsteren Abenden huschten sie um die Häuser herum und klopften an Thür und Fenster. Diesen Geistern hatte der Doctor das Schloß einrichten lassen, und das Schloß hieß nicht mehr Schloß, es hieß Armenhaus.
Da war ein Arbeitssaal und ein Schlafsaal und ein Speisesaal und eine Erheiterungsstube, und es waren noch andere Räume, wie sie für ein solches Haus nothwendig sind. Außerdem hatte sich der Doctor in der neuen Anstalt ein Studirzimmer und eine Apotheke eingerichtet.
So kam er nun oft des Wegs von Dernau her und wenn ein Krankes im Hause war, so kam er fast täglich.
Und nun, da der Doctor zwei Häuser hatte, mußte er auch zwei Zithern haben; denn die Bewohner seines Schlosses schenkten ihm’s nicht. Da kamen sie stets Alle um ihn herum und bestürmten ihn, daß er spiele; die Greise und die Mütterlein baten wie die Kinder, bis die Saiten klangen. Selbst der taube Josef, der nicht einen Ton hören konnte, erbaute sich und war heiter, wenn er dem Spielenden und den Hörenden zusah. „’s ist, wie wenn Ihr in der Kirche säßet,“ sagte er einmal, „so fromm schaut Ihr Alle drein. Kann er denn keine Tanzmusik?“ –
In heiteren Sommertagen, wenn es die Kranken zuließen, ging der Doctor gern in’s Gebirg.
Auf einer solchen Wanderung begegnete er einmal einem Knaben, der Kräuter sammelte und sie in große Bündel zusammenschichtete.
„Was machst denn Du mit diesen Blumen und Wurzeln?“ fragte er den Knaben.
„Die trag’ ich in die Stadt und verkaufe sie.“
„Willst Du sie nicht mir verkaufen? Ich bin der Arzt von Dernau.“
„Wohl, wenn Ihr der Arzt von Dernau seid, kann ich Euch die Kräuter schon verkaufen, aber Ihr müßt mir gleich das Geld geben.“
„Das versteht sich ja, aber was machst Du denn mit dem Geld?“
„Ich muß allerlei kaufen, es liegt mein Vater krank daheim, er hat im Finger den Brand.“
„Wie heißt Du denn?“
„Martin.“
„Nun, Martin, wenn Dein Vater nicht zu weit von hier ist, so will ich mit Dir gehen und ihn heimsuchen.“
„Da thäten wir Euch wohl ein Vergeltsgott sagen,“ entgegnete der Knabe gutmüthig, „aber mehr, als diese Kräuter kann ich Euch nicht dafür geben.“
„Närrchen, für das Mitgehen wirst Du mir nichts geben, die Kräuter zahl’ ich Dir schon.“
„Ja, was seid Ihr denn nachher für ein Arzt?“ rief der Kleine verwundert aus, „der Roßhardl, der Salben und Mirakelpflaster macht, hat für das Mitgehen zu meinem Vater zwei Gulden verlangt; aber wo thät ich zwei Gulden nehmen?“
Unterwegs zur Hütte des Vaters sagte der Doctor: „Ich wüßte ein Haus, Martin, in welchem Dein Vater bald gesund sein würde, und wenn es Euch recht wäre, so ließ’ ich ihn in dasselbe bringen, es thät Euch keinen Kreuzer kosten.“
„Und dürft’ ich auch mitgehen?“
„Ei freilich, bis er gesund wieder mit Dir in die Berge gehen könnte.“
„Herr Arzt!“ rief der Knabe treuherzig, „wenn Ihr uns das thätet, all mein Leben brächt’ ich Euch die Wurzeln und Kräuter und ich thät keinen Kreuzer von Euch nehmen – he, steigt da nicht auf das Frauenhaar, sonst bekommt Ihr Kopfweh!“
Der Knabe zog den Doctor, der eben im Begriffe war, auf Laubfarn zu treten, bei dem Aermel seitwärts.
Endlich kamen sie zur Hütte. Als aber der Doctor den Mann sah, wie er dalag auf dem kahlen Stroh in Armuth und Schmerzen, wie der kranke Finger dunkelbraun und die ganze Hand mit Blut unterlaufen war und wie es in der Brust des Armen zuckte und tobte, da sagte er nichts von dem Fortbringen nach jenem Hause, da sagte er nur: „Recht viel neugemolkene Milch trinken, guter Mann, recht viel Milch trinken! Und Du Martin, bleib’ heut’ und morgen schön beim Vater und reiche ihm Labniß. Da hast Du das Geld für den Kräuterbund.“
Dann saß er noch eine Zeit auf dem Holzstockel neben dem Lager, reichte endlich dem Kranken und dem Knaben die Hand, nahm den Kräuterbund und ging.
Als hierauf der Doctor unterwegs zu einer Kohlstatt kam, rief er dem Köhler zu: „Köhler, wenn Ihr Zeit habt, so geht hinauf in die Hütte zum kranken Mann, ’s ist nur der Knabe bei ihm und er wird sterben.“ –
Und siehe, nach wenigen Tagen trug man aus jener Hütte und durch den Wald einen Sarg. Der Knabe, der ihm folgte, weinte nicht, er blickte nur immer auf die Baumwurzeln.
Nach all dem vergingen Jahre. Martin wuchs auf und der Doctor begegnete ihm oft auf seinen Wanderungen im Gebirge.
Martin wohnte allein in der Hütte seines Vaters, er durchzog die Alpengegend und sammelte Wurzeln und Kräuter, welche er theilweise dem Doctor verkaufte, theilweise in das Städtchen trug. Wenn der Bursche dann Abends heim in seine Hütte kam, hatte er nicht selten ein sonderbares Geräthe bei sich, oft gar ein Buch – und er konnte doch nicht lesen. Wenn sich irgendwo im Gebirge ein Unglück zutrug und wenn ein Leid geschah, das sich die Menschen einander selbst angethan hatten, so bekam er immer Kopfschmerz und Brustleiden. Am liebsten ging er einsam durch den Wald, da trat er immer auf Steine und erhöhte Baumwurzeln, daß er keinen Käfer und keine Ameise und kein anderes lebendes Wesen zertrete.
Zum Doctor sagte er einmal: „Herr, Ihr seid studirt in der Arzneikunst, giebt es kein Mittel, das Blut im Menschen so zu machen, daß keine Wildheit und keine Falschheit in demselben liegen könnte?“
Der Doctor schwieg lange nach dieser Frage, endlich aber antwortete er: „In der Arzneikunst giebt es keines, aber es sind noch viele andere Künste auf Erden, vielleicht liegt es doch in einer.“ –
Die Fragen des Burschen waren überhaupt oft derart, daß der Doctor keine Antwort darauf hatte und sagen mußte: „Martin, sinne nicht an derlei Geschichten, das taugt nichts und es sind dadurch schon Leute verrückt geworden.“ –
Besser erging’s dem Doctor, wenn er auf seinen Spaziergängen zum goldlockigen Geismädchen kam. Das war eines Wegmachers Töchterlein, welches die Ziegen seines Vaters weidete. Als ihm der Doctor auf seinen Bergfahrten das erstemal begegnete, sagte er: „Kleine, wem gehörst Du denn zu?“
Aber die Kleine gab keine Antwort, wendete das Gesicht und lenkte gar mit ihren Ziegen vom Wege ab.
Bei der zweiten Begegnung sagte der Doctor: „Ei sapperlot, jetzt sag’ mir aber gleich, wie Du heißt und wer Dein Vater ist!“
„Nau,“ entgegnete drauf das Mädchen, „Nothburga heiß ich halt und der Wegmacher Hansl ist mein Vater!“
Seit dieser Zeit war die Bekanntschaft zwischen dem Doctor und dem Geismädchen. Und seit dieser Zeit versorgte Nothburga den Doctor mit Himbeeren, Erdbeeren und anderen Früchten, wie sie auf den Bergen wachsen und ein Arzt für seine Apotheke brauchen kann.
Jetzt, wenn sie sich im Walde oder auf der Au begegneten, rief schon immer das Mädchen den Doctor zuerst an: „Nu, wann führt Ihr mich denn wieder einmal zum Tanz? Wann schenkt Ihr mir denn wieder einmal einen Strauß aus Eurem Garten?“ Oder sie sagte: „Bader, Euer Zithernschlagen ist recht langweilig, wenn Ihr einmal heiratet, diese traurigen Lieder wird Euch Euere Frau nicht gelten lassen; aber jetzt müßt Ihr bald heiraten, sonst mag Euch Keine mehr!“
Wenn der Doctor dann nach derlei Begegnungen und Aeußerungen nach Hause kam, übte er sich in lustigen Alpenweisen, aber so frisch und freudig sie auch anfingen, nie gingen sie lustig aus, es war, als ob die Saiten mitten im Jodeln und Jauchzen auf einmal tief herzkrank würden.
Dann ließ er das Instrument ruhen, stand auf und sah so einmal in den Spiegel.
– Grau? – Ei, damit hat’s schon noch gute Weile. Zwar hier, das Haar säh beinah’ so aus! Je nu, so jung können nicht alle Haare sein wie die ihren. –
– Ja, Doctor, jetzt mußt Du Dich bald entschließen! ’s mag Dir wohl thun und ’s mag weise sein, wenn Du Eine von der Stadt nimmst, die frischt das Glatte, Feine wieder in Dir auf und Du kannst mitten auf dem Lande das Leben der Gebildeten haben, wie es einem Doctor ja doch ansteht. Hast Du aber der städtischen Gesellschaft wirklich entsagt, gut, so nimm Dir ein Weib aus dem Walde, da bekommst Du gleich die Treue und die Güte frisch von der Natur weg. Red’ mit der Nothburga einmal, Doctor?!
Und darauf, als der Doctor einmal mit der Nothburga reden wollte, sprang ihm diese schon freudig entgegen und plauderte: „Meinem Vater darf ich’s nicht sagen, meinem Bruder und meiner Gespannin, der Marie, kann ich’s nicht sagen, weil sie oben im Grubschlag sind und erst Samstag heimkommen, und jetzt, sagen muß ich’s doch wem und so sag’ ich’s Euch, aber plaudern müßt Ihr nicht!“
„Nun?“
Da zupfte sie am Halstuch und ganz leise sagte sie: „Einen Liebsten hab’ ich und einen recht schönen und großen noch dazu. Aber jetzt – schäm’ ich mich.“
Nothburga wurde roth und sah zu Boden.
„Nun?“ sagte der Doctor nochmals, dann schlug er mit seinem Stocke ein Steinchen hin und her, das am Wege lag.
„Ihr kennt ihn gar, er hat ein braunes Haar und gräbt Wurzeln!“
„Der Martin also?“
„Und das will ich meinen! – Aber er weiß es noch selbst nicht ganz – der klein’ Finger wird ihm’s aber schon sagen!“
Das Mädchen plauderte weiter und eilte endlich seinen Ziegen nach. Es war ein sehr wildes, ein sehr schönes Kind. –
An einem der nächsten Tage kaufte sich der Doctor ein Pferd, denn die Krankenbesuche mehrten sich und er hatte auch nicht mehr so oft Zeit, in das Gebirge zu gehen. –
Drei Tage nach der Kirchweih brachte man Nothburga in’s Armenhaus; sie war sehr krank und der Doctor mußte ihr zur Ader lassen. Sie hatte ein großes Unglück erlebt. Auf der Kirchweih erschlugen sie ihren Bruder und einen Tag später führten sie Martin in’s Gefängniß.
Diese Fälle hatten das arme Mädchen so aufgeregt, daß es in die schwere Krankheit fiel. Der Wegmacher-Hans war rath- und thatlos und so trug man die Kranke in’s Armenhaus zu Hochdorf.
Dort lag sie einige Tage im Typhus hoffnungslos danieder. Aber der Doctor kam täglich und war stundenlang am Lager der Kranken, bis endlich die Krisis vorüber und Nothburga gerettet war. In der letzten Nacht war’s, als Preisheim im Walde angefallen wurde und Martin in’s Armenhaus brachte. – –
An das Alles mochte der Mann gedacht haben, bis sein Brauner plötzlich im Dunklen stehen blieb.
Da schreckte er auf und haschte nach der Pistole, aber er ließ sie wieder zurücksinken in den Sack seines Mantels, er war ja mitten im Dorfe Dernau, gerade vor seinem Hause.
Leute nahten, die ihn herzlich begrüßten und ihn gar vom Pferde hoben. Sie standen mit Lichtern herum, da es schon finster geworden war, und sie fragten, wie das gewesen sei; sie hatten schon Kunde von dem Anfall im Walde. –
So warm und wohnlich die Stube auch war, so traulich die Lampe leuchtete auf dem gedeckten Tisch und so lustig die alte Haushälterin auch fragte und plauderte – der Doctor blieb wortkarg und verstimmt und ging bald zur Ruhe.
„Glücklich wär’ er da,“ sagte dann in der Küche die Haushälterin zu den Nachbarinnen, die sich noch spät nach dem Doctor erkundigt hatten, „aber ’s ist ihm doch was, ’s ist ihm was! Mein’, der Schrecken muß Einem ja frei die Seel’ aus der Haut jagen!“
Den andern Tag, als der Doctor seine Geschäfte in und seine Besuche um Dernau beendet hatte, ritt er wieder nach Hochdorf. Der Tag war heiter, der Schnee an einzelnen Stellen geschmolzen.
In Hochdorf befanden sich Männer aus dem Städtchen, die auf den Doctor warteten. Sie hatten die Nachricht gebracht, daß aus dem Strafhause ein gefährliches Individuum entsprungen sei, welches man erst vor wenigen Wochen eines Raubmordes wegen eingeliefert hatte. Mit diesen Männern ging nun der Doctor in die Todtenkammer und nach kurzer Untersuchung stellte es sich heraus, daß der im Walde gefundene Todte niemand Anderer sei als der entsprungene Sträfling.
Man wollte auch von Martin den Hergang der Dinge hören und verlangte, daß er zur Leiche gebracht werde, aber der Doctor sagte: „Wenn er noch fiebert, so kann ich es heute nicht gestatten.“
Er begab sich zu Martin, den er auf dem Sofa sitzend und an einem Kienholzstück schnitzend fand.
– So bei einer leichten Handarbeit kommen Einem allerlei Gedanken, heitere und alberne und vernünftige, aber nie so traurige und finstere wie in unbeschäftigten Stunden.
Martin dachte beim Schnitzen an Nothburga. – Ja, die Nothburga, wenn ich die einmal bekäm’, das wär’ schon recht und das wär’ ein großes Glück für mich. Und die Nothburga thät’s doch wohl begreifen, wenn ich ihr’s gut meinen wollte. Und wenn wir – wenn wir dann einmal kleine Leut’ kriegen sollten, dann ließ ich alles Andere draußen gehen und thät mir selbst so eine Welt einrichten und ’s müßt erlogen sein, daß ich da nicht das Glück hinein brächt’. Schön wär’s wohl und ich mein’ das wär’ für den Martin das Rechte; ja, die Nothburga! – Nein, wenn diese dumme Geschichte jetzt nicht mit mir wär’, ich thät sie zuletzt gar noch kriegen; mit ihrem Vater bin ich gut an. Die Nothburga freilich, die mag mich nicht, weil ich simulir’, das hat sie mir schon gesagt, aber ich mein’, wenn sie mich nähm’, ich thät an gar nichts mehr denken als an sie und ich könnt’ auch sonst an gar nichts mehr denken. Ja, die Nothburga! –
So dachte Martin und schnitzte.
Als er den Doctor eintreten sah, freute er sich und sagte: „Eine Arbeit muß ich doch haben und da schnitz’ ich halt einen Pfeifenkopf.“
„Wie geht’s mit dem Fuß?“
„Rechtschaffen gut, nur schmerzen thut er zu Zeiten und brauchen kann ich ihn nicht.“
„Das sollst Du auch nicht; Du sollst jetzt bei mir da ruhig gesund werden und dann in Deine Hütte heim gehen.“
„Ja, gesagt ist’s freilich leicht, gethan ist’s schwerer, ich muß in’s Gefängniß.“
„In’s Gefängniß wirst Du nicht müssen, Martin, es sind eben Herren von dem Gericht da, die Alles begleichen und mit Dir reden wollen. Und dann noch was, hast Du Scheu vor Leichen?“
„Sonst just nicht, aber Kindesleichen möcht ich nicht gern sehen.“
So ließ der Doctor den Wurzelgraber in das Speisezimmer tragen, wo die Gerichtspersonen versammelt waren. Martin gab ruhig Antwort auf die Fragen, die man ihm stellte.
„Ein Krüppel werd’ ich wohl bleiben,“ sagte er zuletzt, „aber ich gäb’ gerne meinen ganzen Fuß hin, wenn sie nur diesen Menschen wieder erwischen thäten; meinen Rock und meinen Hut hat er auch.“
„Um das hat er Dich geprellt, um seine Flucht zu begünstigen,“ sagte Preisheim, „denn dieser Mensch, mußt Du wissen, war ein entsprungener Sträfling.“
Der Wurzelgraber schlug die Hände zusammen. Da sucht er das Reich Gottes und geht mit Verbrechern um und entführt sie der Strafe!
Nun führten sie Martin in die Todtenkammer, und als man die Leiche vor ihm aufdeckte, sahen ihm die Männer in das Gesicht. Nach der ersten Ueberraschung war der Bursche ruhig und er sagte leise: „So schaut’s jetzt aus mit ihm?“
„Ist das der Mann, der Dir im Walde begegnete und Dich zum Anhalten des Pferdes verleitete?“ fragte einer der Beamten.
„All mein Lebtag, freilich ist er’s und meinen Rock hat er auch noch an!“ sagte Martin.
Nun erzählte der Doctor mit wenigen Worten, wie man den Flüchtling todt im Wolfswalde fand und daß er sich wahrscheinlich durch einen Sturz vom Pferd, das unter dem fremden Reiter wild geworden war, das Genick gebrochen habe.
Martin horchte, aber er hatte andere Gedanken; er hatte bemerkt, daß die Leiche an dem linken Fuß nur vier Zehen habe. Dieser Umstand hatte Sinnen und Brüten in ihn gebracht.
„Es ist gut,“ sagte einer der Gerichtsmänner, und der Doctor ließ Martin wieder zurückführen in seine Stube. Dann traf man Anstalten zur Fortschaffung der Leiche.
Der Doctor rechnete gut, wenn er Menschengemüther berechnete. Er glaubte, daß auf eine grübelnde, nach Gerechtigkeit schmachtende Seele, wie die Martin’s war, der vorliegende Fall irdischer Sühne einen günstigen Eindruck machen müsse.
Diesmal aber hatte er sich getäuscht.
Martin arbeitete nicht weiter am Pfeifenkopf, er hielt seine Hände über das eingebundene Knie und sah vor sich hin. „’s giebt denn doch ein Reich Gottes auf Erden!“ murmelte er, „der Uebelthäter entgeht nicht dem Gerichte. – Und wenn es über den Menschen eine Macht giebt, die auf Erden das Böse bestraft, so muß es auch eine Macht geben, die auf Erden das Gute belohnt. Wo ist diese Macht? – Und, Martin, hat dir nicht Jemand gesagt, daß Einem am linken Fuß eine Zehe fehle? Wer hat dir das gesagt und von wem?“
Der Bursche sann und sann. Endlich fiel es ihm ein; jene Bettlerin in der Köhlerhütte hatte vor Jahren ein Kind verloren, welches dieses Merkmal trug. „Vielleicht,“ so[S. 302] murmelte er wieder, „war dieser Mörder der Bruder jenes Wesens, das sie im Walde begraben und in dessen Herzen ich das Reich Gottes gesucht habe. Freilich, freilich lag’s darin, weil es ein Kindesherz war. Und ich Narr hab’ das anders verstanden – – die Kreuzspinne und der Zauberer im Märchen – ach Gott, ja, nun seh’ ich’s wohl, daß ich den Verstand verloren hab’, nun seh’ ich’s wohl!“
Der Arme begann heftig zu weinen und als gegen Abend der Doctor wieder kam, lag er im Fieber. –
Heiterer war es am Lager der Nothburga. Als das Mädchen den Arzt sah, lächelte es und sagte: „Jetzt werd’ ich doch noch einmal gesund, mir hat vom Martin geträumt, daß er ein schneeweißes Kleid anhat und daß er zu uns kommt.“
Der Doctor faßte ihre Hand: „Wie steht’s mit dem Puls, Nothburga? Ei, recht gleichmäßig. – Wenn er aber doch nicht käme, Nothburga?“
„Wer, der Martin? In Gottes Namen, wenn er nur unschuldig ist. Und Euch habe ich auch lieb.“
In derselben Nacht that der Doctor kein Auge zu. Er saß in seiner Stube und ließ die Sterne durch das Fenster scheinen. – Nothburga ist schöner als je.
– Nothburga wird gesund, sie wird leben und blühen, sie wird einen Mann glücklich machen, sie wird die Freude und die Weihe seines Hauses werden, sie wird ihm junge Menschen schenken, die seinen Namen weiter tragen. – Das Alles keimt in ihr, die jetzt durch mich der Gesundheit entgegen geht. Ich habe sie gerettet – wem gebührt nun das?
– Martin! Er ist nichts – nichts als arm, arm bis tief hinein in die Seele. Aber er ist jung und war Nothburga’s Spielgenosse und sie hat ihn lieb. Nothburga ist[S. 303] treu, sie wird ihn lieb haben, so lang’ er ist, aber sie wird mit ihm unglücklich werden, denn seine Seele ist voll Grübeln und Zweifeln und sein Herz hat kein Gefühl außer für seinen Wahn. Und er selbst wird fürchterlich darunter leiden, wird körperlich und moralisch zugrunde gehen und vielleicht ist es endlich gar der Selbstmord, in dem er sein Reich Gottes sucht. – Das Beste wäre, der Arme hätte es überstanden. – Giebt es nicht Fälle für den Arzt, in welchen es seine Pflicht wird...
Es wurde an die Thüre geklopft.
Wer mag das sein um Mitternacht?
„Herr Doctor, wacht auf!“ rief eine Stimme, „kommt zum Kranken!“
Der Doctor machte Licht und ging über die Treppe.
Martin lag in heftigem Fieber und in einer Art Fraisen bebte er am ganzen Körper. Der Arzt ließ ihm Eibischthee bringen, dann befahl er, daß man den Burschen zudecke und bei ihm bleibe.
Hierauf ging er in die Apotheke und bereitete einen Trank.
Später nahm er ein großes Buch und blätterte in demselben und sann. – Haben es die Berufsgenossen denn nirgends aufgeschrieben, wen sie still hinüber führen dürfen? – –
Und wie das heiß war in der Stube!
Der Doctor riß einen Fensterflügel auf. Kalte Winterluft strömte herein und löschte das Licht aus. Er zündete es nicht mehr an, mit gekreuzten Armen schritt er über den Boden.
Leben und Sterben! Wer ist Herr und Richter über die Geschicke der Menschen? –
Was flattert doch jetzt durch das Fenster herein? Es ist ein kleines, buntes Wesen, wie ein verlorenes Blumenblatt, dem fernen Maien entführt. Still kreist es um das Haupt des Mannes und läßt sich endlich nieder auf dessen Hand, die über der Brust liegt.
Ein Sphinx?!
Der Doctor erhascht das Thier, macht Licht und betrachtet es. –
„Deilephila Euphorbiae!“ rief er überrascht aus – „und du flatterst noch? Ja, weißt du nicht, daß wir morgen in den November gehen? ’s hat dich wohl schon recht gefroren da draußen und du hast doch noch nicht wollen schlafen gehen. Ei, du kleiner Falter, was willst du denn über den Winter auf der Erde? Ja freilich, leben willst du, und da bist du in mein Stübchen gekommen, daß ich dich bewahre. Nun, wollen ja sehen.“
Der Mann schloß das Fenster und ließ den Schmetterling frei.
– Und ist’s noch so kalt und spät, leben und nur leben! –
Der einfältige, geistesarme Martin ist bereit, sich aufzuopfern für das Glück der Mitmenschen. Ich geschulter, erfahrener Mann, den man den Gelehrten und Guten nennt, soll das ja auch können müssen! Preisheim, Du hast dem Geburtsadel Deiner Ahnen entsagt, gründe Dir einen eigenen in Deiner Mannesbrust! – Wohlan, es möge denn sein, ich entsage – ich opfere mich dem Reiche Gottes auf Erden. Martin wird geheilt und frei sein und in Nothburga’s Wesen wird seine Seele zur Ruhe kommen, in ihr wird er sich und sein Ziel finden. Und das wird die Auflösung sein, zu der ich ein umschleiertes, nach Glück und Frieden ringendes Menschenwesen führen will. Es leite mich der große Geist! –
Der Doctor zog am Glockenzug, eine Wärterin kam und holte den Trank für Martin.
Hierauf schickte sich der Mann an, zu Bette zu gehen. Als er das Licht auslöschen wollte, fand er vor demselben auf dem Tisch den Schmetterling mit verbrannten Flügeln.
– – – – – – – – – – – –
Es war am Morgen des elften November, als der Doctor Preisheim in die Stube trat, wo Martin Holzlöffel und Pfeifenköpfe schnitzte.
Er wünschte dem Wurzelgraber Glück zu seiner Genesung und zum Namenstag.
Diesem wurden die Augen naß und er sagte: „Doctor, das ist mir noch mein Lebtag nicht passirt, daß mir wer zum Namenstag einen Glückwunsch gesagt hätte. Vergelt’s Euch Gott, daß Ihr mir diese Freude gemacht habt.“
„Und da hab’ ich Dir noch ein Angebinde zu übergeben.“ Der Doctor hielt einen zusammengelegten Brief in der Hand, den er dem Burschen hinhielt.
Dieser wollte nicht angreifen: „Wüßte nicht von wem, wer thät denn mir einen Brief schreiben?“
„Das Gericht, Martin, ei, so sei ruhig, das Gericht schreibt Dir, daß Du frei bist von Schuld und Verdacht.“ Er öffnete das Schreiben und las es laut, dabei mußte er seine freie Hand hinter den Rücken halten, denn Martin wollte sie unzähligemale küssen.
Es war eine große Freude in der Stube.
„So wärest Du gesund und frei, Martin, was wirst Du nun machen?“
„Ja, ich werd’ halt jetzt hinauf in meine Hütte gehen und werde über den Winter schnitzen und Strohschuh’ flechten. Vielleicht thu’ ich dann einmal was Anderes auch noch, ’s mag wohl sein und man kann’s nicht wissen, aber Euch sag’ ich’s schon früher und Ihr müßt für mich reden. Schaut, ich möcht’ halt mit der Nothburga was anfangen. Da thät’ ich Euch wohl bitten, daß Ihr mein Brautwerber wäret und sonst auch – bin Euch viel schuldig geworden! Doctor, sagt’s jetzt, was Ihr verlangt, nach und nach werd’ ich Euch das Geld schon schicken!“
„Ich verlange nichts,“ sagte der Arzt; „mit dem Weltglück aber, lieber Martin,“ der Doctor faßte die Rechte des Wurzelgrabers, „mit dem Weltglück laß es gut sein. Es mag Jeder für sich sehen, daß er’s findet. Und wenn Du denn einmal durchaus beglücken willst, so thue es an einem Einzigen, besser ist es, einem Verschmachtenden den Trunk Wasser zu reichen, als Allen das Himmelreich schenken zu wollen. Und selbst, wenn Du dieses auch hättest, die Menschen würden es von Dir nicht nehmen, sie thäten Dich nur steinigen. Merke Dir das und arbeite für Dich und Deine Hütte; baue Dir ein festes, friedliches Daheim und mache es, unbekümmert um alle Stürme draußen, zu einem Reiche Gottes. – Sollte Dir aber doch wieder einmal ein schwerer Gedanke kommen, so geb’ ich Dir dagegen ein Mittel mit, das Dein Gemüth erleichtern und erfreuen und Dir helfen wird. Komm’ mit mir in meine Stube!“
Und als sie in seine Stube kamen, da saßen in derselben auf der Ofenbank – die Nothburga und ihr alter Vater.
Am Abend, als in dem großen Zimmer des Armenhauses die Lichter brannten, als Alle, die Lahmen, die Tauben und die Blinden um den Tisch herum saßen, und als die Verlobung vorüber war und Martin, hübsch herausgeputzt, seinen Arm um Nothburga schlang, sagte der Bursche:
„Jetzt erst weiß ich, warum mir damals auf dem Hochpaß die Kreuzspinne zum Herzen gekrochen ist!“
– – – – – – – – – – – –
Am andern Morgen ging Martin mit seiner Braut und mit seinem Schwiegervater in’s Gebirge; er hinkte wohl noch ein wenig, aber er stützte sich, wo es über Wurzeln und Gestein ging, ein bischen auf Nothburga.
„Magst Dich schon recht anhalten,“ sagte diese, „ich bin wieder kernfrisch und halt’ schon was aus!“
Der Doctor sah den Dreien lange nach, hernach gab er noch einige Anordnungen im Armenhaus und ritt dann einsam die Straße entlang gegen Dernau.
Diese Geschichte hatte eines Tages ein alter Mann erzählt. Ein junger Mensch schrieb sie auf, bevor er sie vielleicht noch recht verstand. Der gehörte zu denen, die – um in seinem Pathos zu reden – mit verbundenen Augen und auf Umwegen dem Reiche Gottes zustreben – den Idealen des Guten und Schönen.


In einem kleinen Thale der Wildniß stand eine einzige Hütte verlassen und verloren. Die gewaltigen Hochwaldbäume, aus denen die Hütte gezimmert war, trugen zum Theil noch ihre Rinden, unter welchen behende Käfer und nagende Würmchen hausten. Aber das Holz war hart geworden; länger als vierhundert Jahre war es her, daß dieser Hütte Gezimmer emporgesprossen war als junger, grünender, säuselnder, wohldufthauchender Wald. Das flache, steinbeschwerte Dach war vermoost, es wuchs ein hellgrüner Filz darüber, es wuchs Wildfarrn darauf und dort und da guckte ein Tannenwipfelchen hervor, das als beflügelt Samenkörnchen auf das Dach gehüpft war. Das wollte hier auf dem Dache verbleiben und gegen Himmel wachsen zu einem großen Baum.
Das Wild- und Waldleben hatte wieder Besitz genommen von dem Menschenbaue und flocht und wob ihn ein und zog ihn wieder sanft zurück in den Schoß der Natur.
Das Kostbarste an der Hütte waren die Glasscheiben an den kleinen Fenstern. Aber diese Scheiben waren altersgrau und schon erblindet; und längst vergangene Bewohner des Häuschens hatten etwa mit einem scharfen Nagel Kreuze oder Herzen in die Scheiben eingegraben, auf daß sie auch ein[S. 309] Denkmal hinterließen an dieser Stätte, die sie lebelang ihr Daheim genannt.
Ueber der sehr niedrigen Thür an der Wand war mit einer Kohle in einem dreieckigen Umriß das Auge Gottes gezeichnet. Dem lieben Herrgott war die ganze Sach’ anheimgestellt.
Felsmassen schlossen die Hütte ein. Seit die Welt steht, war kein Sonnenblick gefallen in dieses Thal, und wie der Morgen und der Abend auch glühen mochten oben an den luftigen Zinnen und Alpenhörnern, es war in dieser Tiefe nicht zu sehen.
Hier lebten und starben Leute, die außer dem Lichte an den Felstafeln all ihrer Tage keinen Sonnenstrahl gesehen hatten.
Einst standen sechs Hütten in der Thalschlucht. Sie waren da seit undenklichen Tagen, die Menschen wußten ihr Beginnen nicht. Die Bewohner dieser Hütten nährten sich durch einige Aeckerlein, die von den Vorfahren zwischen den grauen Felsblöcken und Schuttriesen waren ausgereutet worden, und sie nährten sich von den Ziegen, die auf den Matten des kleinen Thales Futter fanden.
Ihrer Tage mochten unzählige gewesen sein, aber sie vergingen und es kamen andere.
Da war – so haben die ältesten Leute des Alpenthales erzählt – ein weißlockiger Kräuterer niedergestiegen von Gestein zu Gestein bis in das schattige Thal. Die schneeweißen Haare dieses Mannes waren so lang gewesen, daß sie weit hinter ihm nachgewallt über Wände und Risse. Unten bei den Hütten hatte der Greis um Nachtherberge gebeten, aber die Leute hatten ihn hell ausgelacht und übermüthig geschrieen: „Geh, Du alter Eisbär, wickle Dich in Deine[S. 310] Haare ein, so hast Du Dach und Fach wohl für jegliche Sturmnacht!“ – Darauf hatte der Kräuterer nichts entgegnet, sondern war wieder aufwärts gestiegen von Gestein zu Gestein. Aber er war kein Kräuterer, er war ein Berggeist gewesen, der die Menschen hatte prüfen wollen, und als darauf die Nacht gekommen war, da ist er wieder herabgefahren gegen das Thal und seine langen Haare haben Felsen gesprengt, haben mächtige Furchen und Schründe gerissen im Gebirg – und Eis- und Schneelawinen sind niedergebrandet, und alle Wände ringsum haben gellend laut gelacht, und der größte Theil ist verschüttet worden mitsammt seinen Hütten und Bewohnern. – Und wie die übermüthigen Leute zuerst den Berggeist lachend verhöhnt haben, so hat der Berggeist zuletzt sie allsammt ausgelacht. – So die Sage.
Eine wilde Natur-Revolution muß wohl gewesen sein; ein graues Sandmeer lag nun im Thale und durch dasselbe hin wälzte sich der Gletscherbach, breit und zerrissen, und schwemmte nach allen Seiten hinaus. Heute ging da sein Bett, morgen dort, das ganze früher so bräutliche Thal gehörte dem Wildbach. Auf den Vorhügeln, wohl auch einst aus Schutt aufgebaut, blühten freilich noch die Eriken und wucherte das Gesträuch des Wachholders und der Alpenkiefer, aber mitten hinein hatte der Berggeist Felsstücke geschleudert, über die nun die Flechten woben und Eidechsen glitten. Von den schwindelnden Wänden nieder gingen schneeweiße Sandriesen und graue Schutthalden, in denen es allfort leise rieselte und rieselte. Wie viel tausend Jahre, bis das ganze, gewaltige Hochgefelse niedergerieselt sein wird in die Tiefen! Allein, wer rechnet hier mit Jahrtausenden, wenn sich die ungeheure Burg der Alpen nachbaut herauf aus dem Urgrunde der Erde!
Zwischen den Schutthalden zog sich wohl hie und da ein Streifen Erdgelände hinan, auf welchem Sträuche und verknorrte Fichten und Lärchen mühsam fußten. Und am unteren Ende einer solchen Wildwachszunge, die einige kleine Wiesenhänge wahrte, nicht weit von dem Thalsande des Wildbaches, duckte sich das alte, moosbewachsene Häuschen. Das allein war übrig geblieben von der kleinen Hüttengemeinde im Felsenthale, und das war die einzige und letzte Menschenwohnung weit und breit. Von zwei Wänden nieder lag und sickerte ein breiter, schwerer Schuttstrom; er würde längst niedergetost sein auf das arme Häuschen, wenn er nicht ziemlich hoch über demselben von einem Felshorn aufgehalten und nach links und rechts seitwärts geleitet worden wäre, so daß auf dem Hange unter dem Felshorn das Wildgesträuche wuchern und die Hütte stehen konnte. Diese Lehne war wie eine grüne Insel mitten in dem Steinstrome des Gerölles, und das Felshorn darüber war der Hort.
In der Hütte wohnten vier Menschen, das waren der Schründenhans, dem die Hütte gehörte, sein Weib, sein Kind und sein Bruder.
Sein Weib hatte sich der Schründenhans vor wenigen Jahren erst vom Waldgelände hereingeholt. Dort war es eine Köhlerdirn gewesen, deren Mutter eines Tages in die Gluten des Meilers gebrochen und jämmerlich zugrunde gegangen war. Ihr Vater war ein Wilderer gewesen, aber alljährlich kaum mehr, als ein einziges Reh hatte er sich angeeignet von den Hunderten, die im Walde mit ihm lebten, auf daß er und sein Weib und sein Kind das gut’ Stücklein Fleisch nicht ganz entbehren durften. Aber ein Wilderer war er dennoch, und einmal in der Mondnacht gerieth er mit den Jägern zusammen. Sie fielen über den Kohlenbrenner her,[S. 312] es entbrannte ein wildes Ringen, und zuletzt warfen sie ihn die Felswand hinab, daß der Stürzende den Wipfel eines Baumes knickte, der unten in der Tiefe stand. Keinen Athemzug hat der Kohlenbrenner mehr gethan. Der Mond ging nieder und die Sonne ging auf, und das Mädchen daheim sah allfort zum Fensterchen hinaus und wartete auf den Vater.
Da ging langsamen Schrittes der Schründenhans vorbei, der wußte von der Geschichte und sollte der Waise die Nachricht überbringen.
Aus dem Meiler zuckte ein blaues Flämmchen heraus. „Verlösche es nicht, Hilda,“ sagte der Hans, „es brennt auf der Welt sonst kein Licht für ihn.“
Hilda hat das Wort verstanden, hat nicht mehr nach dem Vater ausgesehen, hat sich verschlossen im Köhlerhause und hat geweint.
Nach Tagen kam der Hans wieder und sagte: „Hilda, ich habe mir gedacht, da Du jetzo keinen Vater mehr hast, so sollst Du einen Mann haben.“
Und nicht lange hernach zog Hilda mit Hans in sein Haus unter den Wänden. Ein Jahr hierauf hatte Hilda ihrem Manne einen Knaben geboren, der zur Zeit dieser Geschichte seine Nahrung noch an der Mutterbrust genoß.
Der vierte Hüttenbewohner nun war Hansens Bruder, der Jok. Der Jok war ein armer Mensch. Er wußte es aber nicht, wie sehr arm er war, er war blödsinnig. Er war ein Krüppel mit kurzem Halse und sehr langen Händen. Er war schon über die zwanzig Jahre alt und konnte noch nicht reden. Seine Stimme war wie ein Stöhnen und Röcheln. Das einzige Wort „Hans“ konnte er halbverständlich sagen. Mit seinem Bruder war er seit seinem ersten Lebenstage beisammen gewesen in der Hütte ihres Vaters. Mit seinem Bruder hatte[S. 313] er die ersten Forellen aus dem Wildbache gefischt; mit seinem Bruder hatte er die letzte Thräne der in Armuth und Kümmerniß sterbenden Mutter gesehen und die Segensworte des verscheidenden Vaters gehört. Diesen Bruder, der nun sein Alles und Einziges war, mußte der Jok unsagbar lieb haben, ihm nahm er im Tagwerke die schwersten Arbeiten unter der Hand weg; ihm schob er beim kaum erklecklichen Mahle, das sie gleich auf dem Lehmgrunde des Herdes zu sich nahmen, die besten Bissen zu. Und als der Hans das Weibchen in’s Haus brachte, lächelte der Jok glückselig, und als der Jok das neugeborne Knäblein sah, da stöhnte er vor Freude und haschte gleich mit beiden Händen nach dem kleinwinzigen Wesen.
Das Aufrechtgehen auf zwei Füßen hatte der Jok auch nicht gelernt, aber gern und behendig kletterte er mit allen Vieren wie die Ziegen und Gemsen. Ein Jägersmann verglich ihn einmal scherzhaft mit einem Ziegenbock. Darüber grinste der Jok freundlich; er hielt den Spott für eine Schmeichelei, denn mit den Thieren hielt er’s immer gern. Aber dem Schründenhans that der Schimpf weh, dem zuckte sein Herz und sein Auge und seine Faust: „Du Jäger, wen geht das Elend meines Bruders was an?“
Der Jägersmann schlich von dannen und brummte: „So Leut’ verstehen keinen Spaß.“
Wenn Gottes Sonntag war und die Beile der Holzhauer ruhten, ging der Schründenhans mit seinem Weibe hinaus gegen das ferne Walddorf, wo die Kirche stand. Zuweilen redeten sie gern ein wenig mit dem lieben Herrgott. „Vater unser,“ sagte der Hans, und legte seine rauhen, waldharzigen Hände recht innig zusammen, „nicht meinetwegen red’ ich, aber unser Bübel laß aufwachsen frisch und gesund, und daß es ein braver Mensch mag werden.“
Aber die Hilda wendete sich zum Frauenaltar: „Gegrüßt seist Du, Maria, und ein warm Pelzlein für den heurigen Winter thät mein Bübel wohl brauchen!“
Der Jok aber ging nie hinaus in das Walddorf; er hütete daheim stets das Haus und die Ziegen, und kletterte an den Hängen hin auf allen Vieren, und pfiff wie die Gemse, und bellte wie das Reh.
Von all’ den Bewohnern der wilden Oede war es seit jeher keinem bewußt geworden, daß sie mitten lebten in der Größe und Herrlichkeit der Natur, und daß um sie eine Gottheit in der Schöpfungswerkstatt ewig meißelte. Sie hatten kein Auge für die wilde Erhabenheit ringsum. Nur zu dem Felshorn, das dem Schuttstrom wehrte, blickten die armen Leute zuweilen auf, aber auch nicht, weil dieser Thurm als Wall ihr Beschützer war, sondern einer anderen Ursache wegen. Das Felshorn stellte nämlich in seiner Auszackung und Durchfurchung ein kolossales Bildniß vor, eine sitzende Frauengestalt mit einem Kinde auf dem Schoße.
„Da ist Unsere liebe Frau mit dem Christkinde herausgewachsen aus der Erden,“ so lautete der alte Glauben der Bewohner des Felsthales, den auch der Schründenhans in seinem Herzen pflegte.
Und wahrlich, allzu große Einbildungskraft gehörte nicht dazu, der Felsthurm war die Himmelskönigin mit dem Scepter und der zackigen Krone; von der Tiefe aus gesehen saß sie auf dem Throne und hielt das Kind.
Das Bild war etwas vorgebeugt und blickte gerade hinab in die Thalschlucht. Das Bild war den Bewohnern der Hütte der Hausaltar, zu dem sie gerne beteten. Die Leutchen konnten nicht daran denken, daß die sonderbare Felsstatue vielleicht Jahrtausende vor der Erwartung des Erlösers und der Geburt[S. 315] Mariens hier oben in den Stürmen der Urzeit gestanden haben mochte.
Nun aber war an dem Felsenbilde noch eine andere Merkwürdigkeit. Zur frühen Morgenstunde, wenn es oben in den hohen Wänden graute und sich die Tafeln sanft zu röthen begannen, klang von dem Marienbilde ein Ton herab wie das ferne Läuten einer Glocke. „Die Himmelschöre singen Unserer lieben Frauen den englischen Gruß,“ sagten da die Hüttenbewohner, und erhoben sich von ihrem Lager und beteten.
Der Ton kam von einer Spalte, welche zwischen dem Throne und dem Marienbilde klaffte und durch welche der Morgenwind blies. Das war nicht seit ewigen Zeiten so, erst seitdem die Hütten waren zugrunde gegangen im Felsenthale, sangen die Chöre.
Sollten aber nicht immerdar so singen und läuten. Da kam nun ein Sommer und ein Herbst, in welchem das liebliche Klingen der Aveglocke in ein tiefes Dröhnen und in ein klägliches Stöhnen übergegangen war.
„Hans,“ sagte da die Hilda einmal, „die Engel läuten nimmer. Was ist Unserer lieben Frau angethan, daß sie so bitterlich thut weinen?“
„Wohl, das hab’ ich auch schon bedacht,“ antwortete der Hans, „ich hab’ herumgesucht in meinem Gewissen, bin wohl recht sündig, aber dasselb’ kann ich sagen, schlechter bin ich nicht, wie eh’ vor Zeit. Leicht hab’ ich mein Bübel zu gern und thu’ es in allzu großer Lieb’ verderben.“
„Etwa ist es meines Vaters arme Seelen, die so thut weinen,“ meinte das Weib, „ich will neun Tag’ fasten und das Essen der blinden Bachwabi hinausschicken in das Waldland.“
Sie that das Buß- und Liebeswerk, auf daß ihr ermordeter Vater erlöst sein sollte, aber das Marienbild oben weinte und weinte.
Da sagte die Hilda einmal, am Ende sei gar die Zeit nahe, in welcher nach Prophezeiung der Vorfahren der Drache wieder hervorbreche, der in irgend einer Höhle der Felsen lauere.
An das dachte Hans nicht, obwohl der klägliche Ton von dem Bilde, der zur Morgenfrühe und gar zuweilen auch mitten in der Nacht zu hören war, ihm eine tiefe Besorgniß verursachte. Oft, wenn er nach der Tageslast im Schlummer ruhte, oder ein liebliches Bild aus Kindeszeiten träumte, erwachte er plötzlich und hörte das schauerliche Weinen.
Und eines Tages, da stieg der Hans die Halde entlang und kletterte hinan bis zu dem Felshorn, und an demselben empor, so weit es ging, und prüfte das Gestein. Die Hilda stand vor der Hütte, hielt die flache Hand über die Augen und blickte hinauf. Wie wenn über den Arm der Mutter Gottes und über dem Haupte des Jesuskindes eine Fliege krabbelte, so war von dieser Ferne ihr Mann zu sehen.
Als der Hans hierauf wieder herabkam zur Hütte, war er sehr schweigsam. Er setzte sich zur Wiege seines Kindes und wiegte. Er sagte dabei kein liebkosend Wort wie sonst; er sang kein Liedlein. Still und schier wehmüthig blickte er den lächelnden Kleinen an. Der Jok grinste zum Fensterchen herein und kicherte und that unverständliche Laute. Der Hans glaubte ihn zu verstehen und reichte ihm ein Stücklein Brot durch das Fenster.
Aber nicht Brot wollte der Jok, viel lieber an der Wiege wollte er sein; allweg wollte er das Büblein tragen und herzen.
Das Weib saß am Herdwinkel und sonderte in Körben die gesammelten Pilze und Kräuter, die für den Winter bereitet waren.
Als sie lange so still gesessen waren, sagte der Hans halblaut: „Da oben schaut’s nicht gut aus. Mein Großvater hat oft erzählt, er hätte nicht einmal seine flache Hand in die Felsenspalte legen können. Mein Vater hat schon leicht die Faust hindurchgebracht, und jetzt –“ der Mann brach ab, das Weib ließ die Hände in den Schoß sinken und blickte ihn fragend an.
„Jetzt,“ fuhr er endlich fort, „das muß schon ein flinkes Gemslein sein, will es die Spalte übersetzen.“
Die Hilda war bei diesen Worten rasch aufgestanden und hinaus zur Thüre gegangen. Bald kam sie zurück und setzte sich schweigend an die Arbeit.
Es kam der Herbst. Stetig rieselte der Bach hin über die Sandfläche; er hatte hier stellenweise Schluchten gerissen, Felsblöcke angeschwemmt, als wollte er ein neues Gebirge gründen im Thale. Im Sande funkelten hier und da winzige Sternchen, als hätten treue Körner die Sonnenstrahlen von den lichten Höhen mit herniedergebracht in die ewigen Schatten. Ein Wassersturz rauschte in einer der hinteren Schluchten. Der Jok stand zuweilen am Bache und sah hinein, und wunderte sich vielleicht, daß ewig das alte Wasser und doch ewig ein neues – und wo es denn herkommt, und wo es denn hingeht? Er lachte die Wellen aus. Dann legte er sich auf den Sand und starrte schnurgerade in den blauen Himmel hinein, so viel er davon zwischen den Berghäuptern sehen konnte. Dann lachte er wieder. Sagte die Hilda einmal: „Der Narr lacht und weiß es nicht, warum.“
„Wenn er nur lacht,“ antwortete der Hans, „der gescheidteste Mensch auf der Welt kann nichts Besseres thun als lachen.“
Freilich, der Hans selber lachte selten.
Es kam der Winter. Oben in den Felskanten und durch die Schluchten her brausten die Stürme. Es toste und wogte und stöberte in den Lüften, und die grauen Felswände ragten in den Nebel hinein. Es sauste der Wind um die Ecken der Hütte und er winselte an den Fensterchen; aber die Töne des Marienbildes waren verstummt. Alle Spalten und Schründe waren gefüllt mit Schnee. Kalte, trockene Luft rieselte nieder von den Mulden der Wände, und mit ihr manches Steinchen, das nicht just festgefroren war. An den steilsten Sandriesen hielt sich kein Schnee.
In der Hütte war Dämmerung und die längste Zeit Nacht. Das Herdfeuer knisterte, die Spanlunte im Eisenhaken flackerte und wollte nimmer ruhig brennen. Warm und trotz aller Einsamkeit traulich war es in dem Stübchen. Die Hilda pflegte ihr Kind; sie sagte ihm Worte von dem Vater, der für sie im Waldlande arbeite und allfort sein Kindlein liebe. Sie sagte dem Kleinen Worte von Gott Vater, der im Himmel lebe und seine Englein sende, daß sie den Vater auf Erden beschützten.
Da lächelte das Kind zu den Worten; und schloß es die Aeuglein, so sah es selbst den Himmel und Gott Vater darin, und die Englein flogen an den goldenen Felswänden hin und her.
Der Mannbruder pflegte stets die Ziegen und erzählte ihnen in seiner Weise seine Freude und sein Leid, wie er’s empfinden konnte. Die Ziegen nahmen Theil an Allem und gaukelten ihm mit ihren Hörnern vor und beleckten seinen Hals. Das that dem guten Burschen gar wohl.
Der Hans war im Tagelohn und half Holz schlagen draußen in den Herrschaftswäldern. Er wollte am liebsten Tag und Nacht arbeiten und immer ein doppeltes Tagewerk machen; er wollte sich ein Häuschen erwirthschaften im Walddorfe, wo kein grauenhaftes Felsgebilde ewig drohend schwebe über dem Scheitel seiner Familie.
Wie karg ist der Tagelohn im Walde, und jede Woche nur einen einzigen Stein, nur einen einzigen Baum zum neuen Heim konnte sich der Hans erwerben. Am Sonnabend, wenn er sich durch die Eisschluchten und Schneewehen seinem Felsenthale zukämpfte, that er immer einen scheuen Blick hinauf zum Frauenbilde am Hang über seinem Hause. Freilich war es da häufig schon dunkle Nacht und er konnte es nicht sehen, wie sich „Unsere liebe Frauen“ immer mehr und mehr von ihrem Throne nach vorn neigte.
„Es ist zum Erbarmen, Hilda, wie Du die ganze Woche in der Einschicht bist,“ sagte der Hans einmal.
„In der Einschicht bin ich nicht,“ versetzte das Weib, „ich hab’ das Kind, und der Jok thut uns hüten. Gieb Du nur Acht im Walde, daß Dich kein Baum mag letzen, und die Stege sind auch so vermorscht, gehst Du aus und ein in den Schluchten.“
„Warte nur, Hilda, zur Auswärtszeit (im Frühling) über’s Jahr heb’ ich an mit dem Hausbau; hernach leben wir draußen im Dorf bei den Leuten.“
Als ob er’s verstanden hätte, so jauchzte jetzt der Kleine und zappelte mit den Füßchen. Gar dem Weibe selbst zitterte das Herz; so klagend, sehnend, so eigen waren die Worte gesprochen – – – und leben bei den Leuten!
Es kam der Frühling. Wochenlang blies der Föhn und von den Bergschluchten hervor kam der „Maibrunn“, wie[S. 320] die Schneewässer des Frühjahres geheißen werden. Eine Schneelawine um die andere fuhr nieder von den Karmulden der Berge und begrub die größten Bäume unter ihrem Schutt.
Zur selben Zeit verfolgte der blöde Bursche ein Gemslein. Es war niedergestiegen bis unter das Muttergottesbild und nagte dort an einigen Fichtenreisern. Dann erhob es seinen Kopf, daß die krummen, scharfen Hörnchen gar nach rückwärts standen, und lugte herab auf das Hüttendach, unter welchem es die Ziegen meckern hörte. Es wollte ihm schier einsam werden zwischen den Schneelehnen und Felsen, es wollte niedersteigen zu Genossen. Das sah denn der Jok, und rechtschaffen flink, wie wenn er selbst eine Gemse wäre, kletterte er hinan, um das Thier heimzuholen. Es war nicht das erste, das er auf diese Weise heimgeholt hatte, und die Thiere mochten sich denken: der Jok da, der ist gut, der gehört mehr zu uns als zu den mörderischen Geschöpfen, die auf zwei Füßen gehen; der Jok, der thut uns nichts.
Und der Jägersmann hinwiederum durfte dem Jok nichts thun, holte sich dieser auch manches Stück Wild; denn was man mit den Händen fängt in der Wildniß, das verschreibt Gott dem Erwerber zu eigen.
Heute aber machte das Gemslein, als es den Burschen gewahrte, lange Füße die Lehne hinan; das Thierchen gestand es ja zu: der Jok mag ein ehrlicher Kerl sein, aber es traute nicht; wollte man es wirklich für den Ziegenstall oder vielleicht gar zu etwas weit Unerquicklicherem? Wer konnte es wissen!
Die Gemse war fort und der Jok stand oben beim Felshorn und starrte verdrießlich drein. Zuletzt kletterte er auf den Felsen, wie er es von seinem Bruder einmal gesehen hatte, und guckte durch die klaffende Spalte, in welcher Schnee und Eis und niedergebrochene Steine lagen. Er[S. 321] guckte eine lange Weile, und legte dabei den Kopf auf die rechte Achsel und auf die linke, und er röchelte und ballte die Fäuste zuletzt und war glühroth im Gesicht.
Als er hierauf zurückkam in’s Thal, wich er der Schwägerin aus; sie sollte es nicht merken können in seinen Augen, was er oben gesehen. Wozu der Schreck und die Angst, wenn die Sache verhütet wird? Er schlich in den kleinen Bretterschuppen, nahm Scheiter und Balken und eine schwere Axt, trug sie hinan auf den Hang und schlug die Blöcke durch Schnee und Gestrüppe in die Erde.
Was mag dem Jok wieder eingefallen sein? dachte das Weib bei sich, aber sie ließ den Burschen gehen und schaffen. Es wurde Abend, die Ziegen meckerten im Stalle; wo denn heut’ der Jok sei? Gar das Büblein in der Wiege ließ klug seine Aeuglein lugen, wo denn der Jok sei, der sonst gern daneben saß und mit den kurzen dicken Fingern Schattenspiele und sonst allerhand Schwänke mache, daß es recht zu lachen war. Der Jok war oben am Hang; die Hilda sah ihn nicht in der Dunkelheit, aber sie hörte die Schläge auf die in den Boden zu treibenden Blöcke. Die Schläge hallten in den Felsen, und als die Hilda rief: „Jok!“ so hallte es wieder nur in den Felsen, und das Pochen da oben währte die ganze Nacht.
*
**
Wanderer, die in das Walddorf kamen, erzählten, daß draußen in den weiten Thälern das Getreide schon hoch in Aehren schieße und die Apfelbäume blühten. Im Hochgebirge aber brausten die fahlgrauen, reißenden Fluthen des Wassers, und sie wälzten Eisstücke und Bäume und Steinblöcke aus den Schluchten. In den Schutthalden war es lebendiger als je; in die Mulden sickerten immermehr die Schneelasten der[S. 322] Kare und Schründe zusammen, und Wässerlein rieselten von allen Hängen in zitternden Schleierfällen, bis die ungeheuren Schneelasten in den Mulden in’s Schieben und Rutschen kamen und mit einem gewaltigen Donnern, Alles vor sich niederwerfend und mitwälzend, in die Tiefen fuhren.
Da hielten die Holzschläger draußen im Waldland ein bei ihrer Arbeit und horchten dem dumpfen Gedonner, das hier und dort durch die Felsschluchten brandete und an den hohen Wänden widerhallte.
Und an einem milden, leuchtenden Maitag war’s. Der Hans hatte am selbigen Morgen unter vermorschtem Gefälle das erste Vergißmeinnicht gesehen und es gleich auf seinen spitzigen Hut gesteckt. – Es knatterte da, es donnerte dort, aber das Waldland war sicher, und die Vöglein haben nie fröhlicher gesungen als an diesem Maitag. Gegen die Mittagsstunde hin erhob sich im Gebirge ein Krachen und Dröhnen, von allen Mulden stürzten Schnee- und Erdlawinen nieder, manche Felszacke löste sich von ihrem Grund, manches Gemslein wurde begraben in Schnee und Schutt, und aufgeschreckt von dem wüsten Lärm flatterten grauschimmernde Habichte und Steinadler durch die Luft und schwammen dem ruhigeren Waldlande zu. Wie lichtgraue oder bläulich schmutzige Ströme, sich untergrabend und überstürzend, in breiten, wogenden Tüchern oder in schmalen, schlüpfenden Schlangen, glitten die Lawinen nieder. Kein Baumwall hielt sie auf, die hundertjährigen Stämme brachen, ehe die Lasten noch kamen, blos von dem Drucke des Sturmhauches; nur an mächtigen Felsnasen schäumten die Schneewogen empor, daß das ganze Kar in eine Staubwolke gehüllt war; aber weiter unten sammelten sie sich wieder und fuhren mit eherner Gewalt unter dem Beben der Vesten dem Abgrunde zu.
Da blieben im Waldlande die Wildbäche aus, aber nur für kurze Zeit, bald hatten sie die Hochwälle der Lawinen durchbrochen und überfluthet und kamen nun wie Ungeheuer herangewogt mit Schutt und Eisblöcken, und Holzstämmen und Felsmassen.
Die Holzhauer schüttelten die Köpfe; das ist ein schlimmer Tag! – Etwan ist im Felsgebirge der Drache losgeworden!
Der Hans hatte lange ruhsam Scheiter gespalten und sich gedacht: ’s ist eben böse Auswärtszeit, aber über’s Jahr heb’ ich an in Gottesnamen, und im Dorfe ist keine Gefahr mehr, und bislang wird die liebe Frauen schon Hüterin sein. – Als aber das Getöse ärger wurde, da lehnte er die Axt aus der Hand und horchte; und endlich, als die Erde zu beben anhub von den tobenden Gewalten im Gewände, da that der Hans plötzlich einen großen Sprung und eilte über Stock und Stein hin gegen sein Felsenthal.
Schuttwälle und Gießbäche schnitten ihm oft den Weg ab, dann starrte er zuweilen in die Fluthen und vermeinte in den heranwogenden Holzblöcken Theile von seiner Hütte zu erkennen. Das Donnern auf den Höhen und das Tosen in den Tiefen wollte ihn betäuben, aber die Hutkrempen tief über die Ohren gedrückt und mit halb geschlossenen Augen wand er sich ruhelos weiter bis zu dem schroffen Felsenthore, das in sein kleines Thal mündete. Er bog um die Wand, er sah in den Felskessel – da wollten ihm plötzlich seine Füße und sein Athem versagen. Er sah am Hange das Frauenbild nicht mehr. Eine ungeheuere Sandriese ging nieder von den höchsten Gewänden und schnurgerade der Stelle des kleinen Hauses zu. Und das Haus stand nicht mehr da.
Der Hans stand, als wäre er selbst ein Steinbild geworden.
Erst nach einer Weile begann es wieder zu zucken und zu zittern in seiner Brust. Wie verloren wankte er dahin – er suchte die zerschmetterten Leiber der Seinen, er suchte die Trümmerstätte seiner Heimat.
Auf dem Platze, wo das Häuschen gestanden, lag ein Berg aus Schnee und Schutt still und starr, als ob er in Ewigkeit so dagelegen wäre. Aus ihm hervor ragte das niedergebrochene, kantige Felshorn.
Daneben hüpften ein paar Ziegen auf und ab und meckerten. Aber an dem Schuttberg in der Tiefe nagte schon der Wildbach, und jenseits des Wildbaches – der Hans fuhr sich mit beiden Händen über die Augen, er träumte doch nicht, er stand ja mit wunden Füßen im Gestein – aber jenseits des Baches stand sein Häuschen.
O Gott, da dachte der Hans wohl an keine Gefahr, er setzte über Gefelse, er sprang durch die Fluthen, er stand vor seiner Hütte. Sie war ein wenig schief und verschoben und einige Balken waren geborsten, aber sonst war sie unversehrt. Die Thür war offen.
Den Athem an sich haltend, trat der Hans ein. Die Hütte hatte kein Flötz (hölzerner Fußboden) und keinen Herd, und keinen Ofen mehr, nur die in sich zusammengefügte Zimmerung stand da. Und siehe, an der Wand kleppte das Wiegenbettchen, und darin schlief, sorgsam verhüllt und eingeschichtet, das Kind. Es erwachte nun vor dem hellen Schrei, den der Mann ausstieß; da faßte der Hans den Knaben in wildem Ausbruche des Gefühles und preßte ihn derb an seine Brust; den Gewalten der Elemente entgangen, wäre der Kleine schier von der Liebe des Vaters erdrückt worden.
Bald aber ließ der Mann das Kind wieder auf das Bettchen sinken, und sein Auge starrte, und seine Wangen[S. 325] erblaßten. Dort hinter der Thür, sich noch fest an einen Balken klammernd, kauerte sein Weib. Hilda war unversehrt aber – leblos.
So hatte es der arme Hans gefunden.
Hierauf kamen die Leute des Waldes zusammen, um das Wunderbare zu sehen. Jeder gab sein Erachten ab, wie das geschehen sein mochte. Viele meinten wieder, es sei der Drache endlich losgebrochen aus seiner Höhle und habe das Unheil angerichtet. Andere glaubten, daß das Häuschen und das Kind erhalten geblieben, sei ein Mirakel von dem steinernen Marienbilde, das jetzt im Lawinenschutte begraben lag. Ein alter Hirte sagte, nach seiner Meinung sei es so geschehen: Von den hohen Mulden sei eine große Lawine niedergegangen, habe das schon lockere Felshorn mit sich fortgerissen und sei ihre gerade Straße weitergefahren. Daraus habe sich nun ein mächtiger Luftdruck entwickelt, welcher der Lawine vorausgeströmt sei und das Häuschen durch einen plötzlichen Ruck an das jenseitige Ufer gesetzt habe. Das Kind sei wahrscheinlich durch die Wände geschützt gewesen, das Weib an der offenen Thür aber durch den Luftdruck erstickt worden. Es hätte sich bei Lawinenstürzen schon mehrmals auf ähnliche Weise zugetragen; der Luftdruck bei großen Abrutschungen vermöge ja ganze Urwälder vor sich niederzuwerfen und die größten Bäume und Felsklötze über tiefe Abgründe zu schleudern.
Die Leute sagten, es werde schon so gewesen sein, und gingen auseinander.
Der arme Hans blieb bei seinem todten Weibe und bei seinem lebendigen Kinde in der Hütte. Oft ging er vor die Thür hinaus und rief nach dem Jok. Die Ziegen kamen herbei und blickten ihn mit ihren eckigen Augen an: sie wüßten auch nicht, wo der Jok sei.
Wenn dann der Knabe schlief, saß der Hans still und einsam in der Hütte. Die erblindeten Glastäfelchen an den Fenstern waren nicht zerbrochen; der Hans betrachtete die dürftigen Zeichen der Vorfahren. Kreuze und Herzen, von sonst haben auch die Alten nichts gewußt, und dieses Erbe haben sie allen Nachkommen im Felsenthale hinterlassen.
Nach zwei Tagen kamen die Leute des Waldes wieder zusammen und trugen das Weib des Holzers fort aus dem Hause unter den Wänden und hinaus durch die Felsschluchten auf den kleinen Gottesacker des Walddorfes.
Hans stieg hierauf tagelang in dem Felsenthale umher und suchte seinen Bruder.
Er fand ihn nicht. Da schloß er sich einzig und ganz an seinen Knaben. Im Waldlande, in der Nähe der Holzgeschläge, in welchen der Hans arbeitete, haben sie sich aus dicken Baumrinden eine Klause gebaut.
In dem unwirthlichen Felsenthale hatten sie nichts mehr zu suchen. Drei Jahre nach dem Naturereignisse, im Hochsommer, verschmolzen und verschwemmten die letzten Reste der niedergestürzten Schneelawine, und da fanden sich neben dem zackigen Felshorn im Schutt halb begraben die Gebeine des armen Jok. Neben ihm lag noch die Axt und ein zugespitztes Scheit, und der Block, mit dem er in den letzten Tagen vor dem Unglücke an dem Hang Pfähle in den Boden getrieben hatte. Die treue Seele hatte das drohende Unheil geahnt und wollte durch solche Schutzpfähle das Haus des Bruders noch retten. Da sind die wilden Gewalten, die keine Lieb’ erkennen, über das Bruderherz hingefahren.
Im Felsenthale wächst heute kein einzig Hälmlein mehr – Alles Schutt und Gestein. Von dem letzten und einzigen Hause haben tosende Gießströme längst die letzten[S. 327] Reste davongeschwemmt, und an den Hochmulden steigen immer tiefer und tiefer die Gletscher nieder.
So sind aus diesen verlorenen Schründen die letzten Menschen verdrängt worden. Im Waldland draußen lebt heute noch der Hans als alter Mann. Er lebt still in sich und ist ergeben; nur im Frühjahre, wenn im Hochgebirge die Lawinen stürzen, hebt er an zu zittern und umfaßt seinen Sohn mit beiden Händen.
Sein Sohn, nun, das ist ein hübscher kräftiger Bursche geworden; vom frühen Morgen bis in die späte Nacht arbeitet er im Walde. Aber der Hausbau im Dorfe ist heute noch nicht begonnen. In der Dürftigkeit muß auch der junge Holzer sein Leben verbringen, darf vielleicht gar sein Herzenslieb nicht freien, weil er kein Daheim hat. Wen soll er darob anklagen? Etwa die hohen Berge? Er ging einmal von ihnen fort in’s Flachland hinaus, aber die bösen, die lieben Berge, sie zogen ihn zurück und grüßten ihn wieder mit ihrer Mühsal und Gefahr.
Wenn der Bursche daran denkt, wird es ihm manchmal schier krampfig im Herzen. Aber hinschleudert er den Gram, daß er in die Tiefe fährt wie eine Schneelawine, und hell aufjauchzt der Mann, daß es im grünen Walde und in den sonnigen Hochwänden des Gebirges vielfach widerhallt.

(Eine Hofgeschichte.)

Die Hofgeschichte beginnt mit demselben Hofe, auf welchem es an diesem Sonntage so geruhsam und still ist.
Man heißt ihn den Leeshof.
Die Musik klang nicht herüber vom Breitegger-Wirthshause, denn es lagen drei Berge dazwischen. Die Musik wurde dort im Thale aufgefangen von hundert leblustigen Menschen und frischweg vertanzt und verstrampft. Kirchweih- und Erntefest zugleich – da waren Alle dabei, um Gott zu danken in Lust und Jubel, und der Wirth goß Wein dazu.
Im Leeshofe war es das Viktel, welches haushüten mußte. Das Viktel hatte nichts gesäet und nichts geerntet, was soll es beim Tanz? Sie war erst neunzehn Jahre alt, ein Waisenkind ohne Kalbslederschuhe und ohne Liebhaber – was soll sie beim Tanz? Oder – sie wird doch nicht etwa so verdorben sein und einen Liebsten haben wollen, und sich von ihm Wein und was Warmes zahlen lassen, und mit ihm walzen wollen bis tiefnächtig?! Also, was soll sie beim Tanz?
Sie sitzt im leeren Hause allein in der Meierstube auf einem Betschemel, und die Sitzbank ist ihr Tisch, da bessert sie säuberlich ihre Werktagskleider aus und denkt so dabei an[S. 329] die vergangenen Zeiten, und draußen rieselt der Brunnen. Auf den weiten Feldern um den Hof stehen in langen Reihen hin die Garbenschöberchen des geschnittenen Kornes, weiter hin stehen zwischen grünen Gründen weißstämmige Birkenwäldchen bis an den Wockenberg, der sich breit und waldig erhebt, sich in dunkle Schluchten faltet und hoch zu Häupten eine kahle Felsenzinne trägt, welche eine große Fernsicht bietet und von vielen Touristen bestiegen wird. Heute ragt der Berg still, denn Alles, was jodeln und jauchzen kann, ist im Wirthshause zu Breitegg. Die Sonne scheint warm und hold vom nachmittägigen Himmel herab und die Vögel haben Feierabend gemacht.
Und die Viktel saß mitten in der Welt und nähte. Den falben Hanfzwirn hatte sie mit Pfannenruß gefärbt, weil die Joppe grau war, und ihre nußbraunen Augen waren feucht geworden, weil sie an traurige Sachen sann. Sie dachte an ihrer Mutter Sterben. Es war ja heute derselbige Tag wie vor einem Jahre – dazumal ist’s der Samstag gewesen. Die betagte Magd hatte noch die Garbe herausgeschnitten aus dem wallenden Korn. Dann setzte sie sich plötzlich auf die Garbe und rief: „Viktel, geh’ geschwind ein wenig her!“ Die Tochter steckte die Sichel in das Gehalme und kam herbei. – „Viktel,“ sagte die Magd und nahm sie hastig bei der Hand, „Viktel, Dir mag nichts an auf der Welt, Du kannst arbeiten und bist leicht zufrieden. Nur eine Gefahr stellt Dir nach. Meine Mutter hat’s oft und oft gesagt, unser armer Stammen hätt’ so viel heißes Blut – thät’ das Leben verbrennen und oftmalen auch die ewige Seligkeit. Viktel, das Mannerleut’ Gernhaben! hüte Dich und laß Dich nicht verführen. – Jetzt wird’s mir ganz blau vor den Augen – – Kind! – wo bist denn? – Kind!“
Da schrie das Viktel schon nach Hilfe, bis die Schnitter alle zusammenliefen – aber der ewige Schnitter hatte den Menschenhalm geknickt....
Das Mädchen ließ jetzt die Nadel ruhen, legte die Hände gefaltet in den Schoß und betete ein Vaterunser.
Und während diese Ruhe war, verstummte draußen plötzlich das Rieseln des Brunnens. Das Viktel blickte durch’s Fenster hinaus und erschrak. Am Brunnen lehnte, mit einer Hand den Ständer umarmend, mit der andern sich auf den Rand des Troges stützend, der Graber-Schorsch und trank an dem hervorsprudelnden Quell. Das Mädchen schlich auf den Zehenspitzen rasch zur Hausthür und schob den zweiten Riegel vor und duckte sich an den Fenstern, daß sie der Mann, der draußen war, nicht bemerken konnte. Vor dem Graber-Schorsch verschlossen sich die Häuser; er betrat nur solche, deren Thüren er erbrach. An die vierzig Jahre mochte er alt sein, an die zwanzig war er im Arrest gesessen. Diebstähle und Einbrüche leugnete er nicht, denn er war zu verkommen, um darin ein Unrecht zu erkennen. Auch der Mutter des Viktel hatte er aus dem Bettstroh einst das wenige Silbergeld fortgenommen, welches sie von ihrem Vater für das Kind überkommen hatte. Er leugnete es nicht, aber er gab es nicht zurück, weil er es verspielt und vertrunken hatte, er saß es ab, und das Land bezahlte sein Sitzen und die Dienstmagd hatte nichts. Nur eines einzigen Raubmordes konnte er überwiesen werden, und den entschuldigte sein Vertheidiger mit Hunger und Noth und mangelhafter Erziehung und mit Dingen, die sich in solchen Fällen eben gar so schön sagen lassen. So ging der Graber-Schorsch seit einigen Wochen wieder frei herum und suchte Brot und Unterstand, wurde aber überall abgewiesen. Wie er zu dem respektirlichen Anzug kam, den er[S. 331] trug und in welchem er einem Förster ähnlich sah, wurde von den Leuten wohl besprochen, aber nicht näher untersucht. Die Haare waren heute gut geschnitten, der Backen- und Kinnbart glatt rasirt, der Schnurrbart in Hörnchen aufgedreht. Es war ein großer, sehniger Mann, die lange Rast im Arreste hatte seine Glieder behender gemacht, als sie etwa in mühevoller Arbeit geworden wären.
Als er sich in einem langen Zuge satt getrunken hatte, schien er auch etwas zu Essen haben zu wollen. Er schritt zur Thüre und rüttelte. Dann schlich er spähend um’s Haus, lugte zu den Fenstern hinein und prüfte mit Kennerauge die Vergitterungen. Das Viktel hatte sich aus Angst in den dunkelsten Winkel gekauert und sann auf allerlei Mittel, dem Hause zu entkommen und in der entfernten Nachbarschaft Hilfe zu suchen. Denn, daß die Leute vor Abend vom Tanzfeste nicht nach Hause kehren würden, das wußte sie.
Als der Graber-Schorsch das Einsteigen in’s Haus aufgegeben zu haben schien, blickte er eine Weile in die Richtung gegen Breitegg hin, wo das Wirthshaus war. Dann zog er eine große Brieftasche aus dem inneren Rocksack, durchsuchte alle Fächer, und da er sie leer fand, schleuderte er die Tasche mit einem Fluch zu Boden. Hernach setzte er sich auf eine Bank und sah das Haus an. Als er eine Weile so gesessen war und wer weiß was ausgesonnen hatte, kam des Feldweges ein Fremder heran. Ein junger, schlanker Mann, im Anzuge des Aelplers, aber mit einem zarten Angesichte, auf welchem das Gebirgswetter nicht viel zu verspüren war. Die Brauen und Wimpern der großen, blauen Augen waren so scharf, daß es gar dem Viktel, welches an einer Fensterecke herauslugte, auffallen wollte. Das Haar wucherte in halbgeschnittenen Locken unter dem Jägershute[S. 332] hervor und verlor sich an den Backen herab in einen zarten Flaum. Ein dunkles Schnurrbärtchen umrahmte weich die vollen, rothen Lippen, und die Hände waren so fein und weiß wie die des Herrn Kaplan zu Breitegg, nur noch kleiner. Dieser hübsche „Jägersmann“, der aber kein Gewehr bei sich hatte, sondern ein leichtes Spazierstöckchen, ging rasch auf den Graber-Schorsch zu und fragte, ob hier nicht ein Führer zu haben sei auf den Wockenberg.
Der Schorsch stand auf, musterte den Fremden mit unstetem Auge und antwortete: „O ja.“
„Wie lange Zeit braucht man von hier bis zur Höhe?“
„Drei Stunden.“
„Gut,“ sagte der Fremde, „so kann man bis Sonnenuntergang bequem oben sein, und auf dem Rückweg leuchtet der Mond. Der Führer trägt mir das Seitentäschchen hier, dann wünsche ich einen Bergstock. Ich bin nur für einen Landritt eingerichtet und für die Partie etwas unvorbereitet. Allein, da ein so schöner Abend zu werden verspricht –“
„Werden das Nöthige schon finden,“ sagte der Schorsch und streckte seine Hand nach der Tasche aus, ohne dem Fremden in’s Gesicht zu sehen.
„Wollt Ihr selbst mit mir gehen?“
„Ja,“ murmelte der Schorsch.
„Ihr seid wohl der Besitzer dieses schönen Gehöftes?“
„Geht mich nichts an. Wenn der Herr wünscht.... den Stock schneide ich im Walde.“
Die Beiden gingen weiter – der Graber-Schorsch voran, der junge Fremde hinten d’rein.
Das Viktel stand hinter dem Fenster und zitterte. Sie hatte jedes Wort vernommen, sie hatte dem Fremden in’s Gesicht geschaut so lange, bis derselbe plötzlich seinen Blick[S. 333] gegen das Fenster hin wandte; am schimmernden Glase prallte dieser Blick zurück, und doch schoß er wie ein Blitz in das Herz des Mädchens, dem es heiß bis in alle Finger- und Zehenspitzen fuhr...
Eine Weile war sie wie betäubt dagestanden, dann sprang sie hin, riß die Thür auf und eilte den beiden Männern nach. Erst draußen auf freiem Stoppelfelde holte sie dieselben ein. Der Schorsch schleuderte ihr einen wilden Blick zu, aber sie griff nach der Hand des Fremden, daß dieser still stand und fast erschrocken war vor dem schönen, blondlockigen Mädchen, das so plötzlich neben ihm stand.
„Halt’ mir’s der Herr nicht für übel,“ sprach sie heftig athmend, „kennt Ihr ihn nicht?“
„Wen, mein Kind?“
„Den da!“ sie streckte ihren Finger gegen den Schorsch aus und rief: „Zu tausend Gottes Willen, Herr, mit dem geht nicht auf den Berg!“
„Du Luder, Du verdammtes!“ knirschte der Schorsch und wollte über das Mädchen herfallen.
„Halt!“ rief der Fremde und stieß ihn zurück; da fuhr der Andere wuthentbrannt in sein Kleid, im nächsten Augenblicke knallte ein Pistolenschuß und der Graber-Schorsch floh in wilden Sprüngen hin gegen das Birkengehölze. – Als der Rauch verflogen war, stand der Fremde todtenblaß, so daß das Mädchen aufschrie: „Heiliger Gott, hat er Euch was gethan?“
Er war heil, aber ihr war der Aermel zerrissen und sie blutete am Arm. Als der Fremde das sah, riß er sein Halstuch los, um die Wunde zu verbinden.
„Na freilich, als ob’s was wäre!“ rief das Mädchen, „laßt’s ein wenig bluten, ist gut für das Kopfweh. – Aber[S. 334] so ein Lump da! Ja, gleichschauen thut’s ihm – der hat schon Leut’ umbracht! Schaut, da ist eine Brieftasche, die hat er früher weggeworfen. Ich will was Schlechtes heißen, wenn das nicht ein Blutflecken ist da d’rauf!“
Selbstverständlich, die Partie auf den Wockenberg war aufgegeben. Der Fremde kehrte mit dem Mädchen zum Hofe zurück, dort setzte er sich an den Kopf des Brunnentroges und mußte trotz ihres Sträubens die Wunde sehen, und legte ein schneeweißes Taschentuch darüber, daß kein Tröpfchen mehr hervorfloß. Hierauf stellte er allerlei Fragen an das Viktel, das mit jeder Antwort verlegener wurde, bis es endlich tief zu Boden sah und schwieg.
Und als es so war, zog der Fremde ein Ringlein vom Finger, steckte es an ihre zitternde Hand und sagte: „Wir sehen uns heute nicht das letzte Mal. Einstweilen trage dieses Kleinod als Andenken an den Mann, dem Du aller Wahrscheinlichkeit nach das Leben gerettet hast. Ich habe heute sonst nichts, um es Dir zu lohnen, mein schönes Kind. Gott mit Dir!“
Rasch ging er davon, schritt zum Thale, bestieg sein Pferd und ritt fürbaß.
Die Leute kamen heim vom Tanze, waren schläfrig, suchten das Bett und begannen am andern Tag die Woche wie immer. Auch das Viktel arbeitete wieder auf dem Felde und war die Emsigste und war die Stillste. Zur großen Verwunderung des Hofes kam ein Arzt aus dem Bezirksstädtchen angefahren, der sich nach dem verwundeten Mädchen erkundigte und sich überzeugte, daß der Arm des Viktel fast heil war. Hingegen trug sie den Herzfinger der linken Hand in einer Binde.
Was ihr daran geschehen sei? fragte sie eine Genossin.
„In die Sichel hab ich närrischer Weise gegriffen,“ antwortete das Mädchen, „ist aber nichts.“
Da streifte sich beim Garbenbinden zufällig einmal die Hülle vom Finger und die Genossin sah daran keine Wunde, sondern ein goldenes Ringlein mit einem funkelnden Steine. So mußte es die Viktel nun wohl gestehen, daß ihr jener fremde Mann, welchen sie dem Schorsch abgejagt hatte, einen Ring an den Finger gesteckt, den sie nicht mehr herabbringe. Aber sie gestand nicht, daß sie fort und fort an den Fremden denken mußte. So gut und so lieb hatte noch kein Mensch mit ihr geredet, als dieser Mann. Er hatte mit einer so wunderlich weichen Stimme ihren Namen ausgesprochen und kein Mensch auf der Welt hat solche Augen wie er; seitdem sie in dieselben hineingesehen, kamen ihr alle anderen Augen vor wie von trübem Glase. Sie hatte keine ruhige Nacht; so lange sie wach war, dachte sie nur an ihn, und als sie schlief, sah sie ihn. Sie sah es, wie er von dem Graber-Schorsch den Wockenberg hinangeführt, beraubt und in den Abgrund gestürzt wurde; bei seinem Sturze zuckte sie auf und erwachte. Dann wieder legte er seinen Arm um ihre Gestalt und sie fühlte, wie er den Ring an ihren Finger schob.
Ein Knecht war im Hofe, der flüsterte dem Mädchen einmal zu, er habe gehört, sie bringe den fremden Ring nicht vom Finger. Er wolle ihr ihn herabziehen. Sie fragte scharf, was ihn ihr Ring kümmere?
„Ah, nichts,“ war die Antwort.
„So gehe weiter!“
Er war abgewiesen.
Da kam eines Tages an die Viktoria Zimmermann eine Zuschrift. In gar seltsam höflicher Weise, wie man etwa zu einer vornehmen Frau sprechen mag, wurde sie eingeladen,[S. 336] in die Residenz zu reisen und in der Schloßstraße Nummer Eins vorzusprechen und ihren Namen zu nennen. Reisegeld lag dabei, welches fünfmal so viel ausmachte, als was eine Hin- und Rückfahrt kosten konnte.
„Viktel, Viktel!“ sagten die Leute, „da steckt was dahinter. Du machst Dein Glück. Es wird vom fremden Mann sein, ganz gewiß. Das war kein gemeiner Mensch, der Ring ist vom feinsten Gold und hat einen Karfunkel, der auch in der finstern Nacht, wenn Du die Hand unter der Decke hast, glänzen muß wie ein Stern. – Wann fährst denn schon in die Stadt?“
„Wer hat gesagt, daß ich fahre?“ antwortete sie. „Will wer mit mir reden, so hat er nicht weiter zu mir, als wie ich zu ihm. Ich geh’ Keinem nach; mir brennt das Geld in der Hand; thät’ ich nur seinen Namen wissen, daß ich es kunnt zurückschicken.“
„Hast schon recht, Viktel,“ sagte der Leeshofer, „hast ganz Recht, wie Du denkst. Der Mensch muß sich selber werth machen.“
Und sie ging nicht. Um so größer aber war in ihr die Unruhe; und es war, als ob jeder Tropfen Blut in ihr immer wieder dem linken Herzfinger zurieselte und am Ringlein neu erglüht zurücksprang.
Der Graber-Schorsch war seit jenem Sonntage in der Gegend nicht mehr gesehen worden, doch hörte man, er zöge mit allerlei Strolchen und werbe eine Bande. Andere wollten wissen, er sei schon wieder eingefangen worden und man werde ihn ehbaldigst hängen. Am Frauentage im September auf dem Kirchplatze ging der Gerichtsbote auf den Leeshofer zu und fragte, ob in seinem Hause nicht eine sichere Viktoria Zimmermann wohne? Dieselbe habe unverzüglich in die[S. 337] Residenz zu fahren und sich in der Schloßgasse Nummer Eins zu melden. So stand es auch in der gerichtlichen Zuschrift, die der Bote übergab.
„Ah so?“ meinte der Leeshofer, „jetzt kann ich mir denken, um was es sich handelt. Ein Zeugenverhör, gewiß des Graber-Schorsch wegen. Ei ja, Viktel, da mußt Du freilich gehen, da bleibt nichts Anderes übrig.“
Das Mädchen war innerlich tief enttäuscht. Also nur zu Gericht sollte sie und aussagen, wie der Schorsch den Fremden führen wollte und auf sie geschossen hat. – Und wenn man sie auch des Ringes wegen verhören wollte? Der geht nimmer vom Finger.
Man wünschte ihr viel „Glück und Gesund“, sie fuhr in die Residenz. Sie hatte in ihrem Leben noch keine Stadt gesehen, und als sie auf dem großen Bahnhofe ausstieg und die schwere Pracht um sich sah, und die Menge von Menschen und Wagen, und den Lärm hörte, da blieb sie stehen wie eine Bildsäule, schloß die Augen und dachte: „Jetzt, Viktel, jetzt nimm Dich zusammen.“
Die Schloßstraße erfragte sie leicht, es war die vornehmste Straße, die mit ihrer Herrlichkeit und mit ihrem bunten Leben mitten durch die Stadt zog.
„Jetzt möchte ich nur wissen,“ sagte der Mann, den sie sich als Führer gedungen hatte, „was das schön’ Dirndl in Numro Eins zu thun hat? Gewißlich den Liebsten aufsuchen, der etwan dort auf der Wacht steht?“
„Ich muß zum Gericht,“ beschied das Viktel, das mit dem rothen Handbündelchen neben ihm herging.
„Zum Gericht? Ei so, so. Da wirst Dich aber im Weg irren, Dirndl; in Numro Eins weiß ich kein Gericht.“
„Was denn?“
„Numro Eins ist das Schloß, wo der Prinz drinnen wohnt.“
„Na, sei so gut!“ rief das Mädchen und blieb stehen. Als jedoch der Führer die Vorladung las, sagte er: „Es ist richtig, Du mußt in’s Schloß!“
Sie gingen weiter – das Viktel stets mitten auf der Straße, so daß es fortweg in Gefahr war, von den Wagen niedergefahren zu werden. Sie sah und hörte kaum, was um sie vorging; sie dachte nur an das Schloß und an den Prinzen und an ein Märchen vom Prinzen und der Schäferin, welches sie von ihrer Mutter gehört hatte. Und sie seufzte auf: „Wer weiß, wie das mit mir ausgeht!“
Plötzlich weitete es sich und der Führer geleitete das Landmädchen über einen großen Platz, der mit viereckigen Steinplatten gepflastert war. Vor ihnen erhob sich ein Palast mit hundert Fenstern und gemeißelten Figuren an den Wänden und Zinnen. Sie schritten durch das weit offene Flügelthor eines hohen, vergoldeten Gitters in den innern Hof, wo an der Pforte die Wache mit aufgepflanzten Gewehren stand, so daß das Viktel davor erschrak und anfangs glaubte, diese Soldaten stünden da, um Jeden niederzumachen, der in das Schloß treten wolle. Sie bedankte sich beim Führer und bezahlte ihn; dann nahm sie ihre Vorladung in die Hand und hielt dieselbe, langsam vorschreitend, der Wache entgegen. Die Männer standen da, wie von Holz geschnitzt. Im inneren Thorbogen erschien jetzt etwas, bei welchem dem Viktel zum Erschrecken und zum Lachen zugleich war. Ein Mann, der das Gesicht voll Bart hatte und einen versilberten Pelz trug und einen goldenen Stab mit einem mächtig funkelnden Knopf in der Hand hielt. Dieser Mann – das Mädchen war ungewiß darüber, ob es nicht[S. 339] schon der Prinz wäre, daher machte es einen tiefen Knix – besah das Papier und wies das Mädchen über eine breite Treppe hinauf, die mit einem buntfarbigen Teppich belegt war. Die junge Dienstmagd aus dem Leeshofe wußte nicht recht, wo man da gehe, einestheils that ihr der weiche Teppich leid, darauf zu treten, anderntheils waren an beiden Seiten die Steinstufen so glatt, daß man ausgleiten konnte. So stieg sie mit einem Fuß auf den Teppich und mit dem andern auf den nackten Marmor. Ihr Herz pochte heftig, aber sie war entschlossen, sich durch nichts irre machen zu lassen und aufrichtig zu sein. Wenn der Mensch – so dachte sie – nichts Schlechtes auf dem Gewissen hat, so kann ihm auch im Prinzenschloß nichts geschehen.
Im Saale trat ihr ein dickes, schwarz gekleidetes Herrchen entgegen, das eine sehr hohe Glatze und einen kurzgeschnittenen weißen Vollbart hatte. Sein Gesicht war roth und blatternarbig, seine Nase weidlich kupfern, aber seine grauen Aeuglein blickten klug und sanft. Er blieb vor dem Mädchen stehen, setzte die Füße mit den funkelnden Stiefeln ein wenig auseinander, legte die Arme auf den Rücken und sagte mit freundlicher, aber immerhin etwas schnarrender Stimme: „Also Sie sind die Lebensretterin! Die Viktoria Zimmermann aus Breitegg!“
„Ich heiße so und bin aus der Breitegger Pfarr’,“ antwortete das Viktel, „aber wenn der Herr Du zu mir wollt’ sagen, so wär’s mir lieber.“
„Kann gern’ geschehen, Du fein’ Mädel,“ lächelte das Herrchen, „und jetzt komme einmal mit mir da herein; kannst ein wenig Toilette machen, wenn Du willst, ich werde Dich hernach zu Seiner Hoheit führen.“
„Was soll ich da machen?“ fragte sie, als sie mit ihm in ein schönes, lichtes Zimmer trat. Plötzlich blieb sie mitten auf dem Boden stehen und starrte auf ein Gemälde hin, das an der Wand hing. Es stellte in Lebensgröße das Haupt jenes Mannes dar, der ihr vor ein paar Wochen den Ring an den Finger gesteckt hatte.
„Meiner Tag!“ hauchte sie, „jetzt was ich derschrocken bin! G’rad wie lebig! G’rad wie lebig! – Wer ist er denn?“
„Der da auf dem Bildniß? Den sollst Du ja kennen; hast ihm doch das Leben gerettet. Deshalb ließ er Dich kommen. Es ist der Prinz.“
„Jesus, Maria und Josef!“ rief sie, „’leicht will er mich heiraten gar!“ – Es war ein Aufschrei. Aber der kleine Herr schmunzelte und streichelte ihre bebende Hand, mit der sie sich an einer Stuhllehne stützte. –
Eine Viertelstunde später stand das junge Bauernmädchen auf dem Teppiche des fürstlichen Gemaches. Wohin sie blickte, goldene Pracht, dazwischen Vasen mit üppigen Rosen und aufrankendem Laubwerk und in allen Wänden, aus Goldrahmen schauend, sah sie ihr ärmliches Bild. Ihr war angst und bang. Da erschien der Prinz. Er war in Militäruniform und hatte an der Brust ein Sternchen. Das sah sie nicht, sie sah nur sein Angesicht – es war dasselbe mit dem süßen Blitz des Auges, mit dem tiefen und weichen Laut des Mundes. Er schritt rasch auf sie zu, faßte ihre Hand und sagte: „Willkommen! Wir sind ja alte Bekannte, aber Sie müssen nicht übel von mir denken, mein Kind, daß ich Sie amtlich holen ließ, sonst wären Sie ja nicht erschienen und ich bin doch so sehr Ihr Schuldner geworden.“
Sie entgegnete nichts, schlug das Auge zu Boden und nur einmal zuckte es glühend zu ihm auf.
„Nun erzählen Sie mir einmal,“ sagte der Prinz und machte eine leichte Geste mit der Hand, wobei er die ihre losließ, „erzählen Sie mir, Viktoria, wie geht es Ihnen, ist die Wunde am Arm schon ganz heil? Habt Ihr noch so gutes Wetter zu Breitegg? Ich hoffe, jener Mensch wird doch wieder in Gewahrsam sein.“
Sie sah ihn fragend an, worüber sie ihm eigentlich zuerst Antwort geben solle. Aber ohne eine solche abzuwarten, bat er, daß sie in ein Nebengemach trete, und begleitete sie. Im Nebengemache rauschte eine junge, schlanke Dame in rosaseidenem Kleide.
„Hier, meine Theure,“ sagte der Prinz zur Dame, „stelle ich Dir das Bauernmädchen, den Schutzengel Deines Emerich vor!“
„Grüß’ Sie Gott, meine Liebe!“ sagte die Dame mit einem glockenreinen Stimmchen, warf einen flüchtigen Blick auf die rauhe Hand des Mädchens, an welcher der Ring funkelte, schritt, die beiden Arme vorstreckend, auf das Viktel zu, und neigte ihr Haupt leicht gegen deren Wange, daß es von Ferne aussah wie ein Kuß. „Ich habe Ihnen viel, sehr, sehr viel zu danken. O, nehmen Sie Platz.“
Blaß, wie eine Sterbende, sank das Mädchen auf einen rothen Sammtsitz; das hohe Paar richtete die freundlichsten Worte an sie; plötzlich aber stand sie auf; „ich hab’ da nichts zu suchen,“ hauchte sie und wollte davon.
Die Dame hielt sie zurück. Dem Prinzen wurde ein Besuch gemeldet. „Ich sehe Sie noch, meine Gute!“ sagte er, drückte ihr rasch und fest die Hand und ging aus dem Gemache.
Das arme Mädchen hätte ihm mögen nachrufen: Bleib’, laß’ mich hier nicht allein! –
„Das, was ich Ihnen schulde, wackeres Kind, ist nicht mit Gold zu bezahlen,“ sprach nun die Dame, „Sie sind wohl arm, wie Alle Ihres Standes; Sie haben von mir eine sorglose Zukunft zugute; dieselbe ist Ihnen durch eine für Sie hinterlegte Summe bereits gesichert. Vor allem bin ich bewogen, Ihnen den Ring abzulösen, den Ihnen mein dankbarer Gemahl als Pfand gegeben hat. Nehmen Sie als erstes und heiligstes Zeichen meiner Erkenntlichkeit dieses Kreuz.“ –
Sie wollte dem Mädchen ein goldenes Kreuzchen um den Hals hängen, dieses wehrte mit beiden Händen ab und rief: „O Gott, nein! Was brauch’ ich noch voran ein Kreuz, hab’ eh hinten eins.“
Die Dame machte ein Lächeln, weil sie glaubte, die Bauernmagd rede im Spaß; bei dieser jedoch war es harter Ernst. „Ich bin kein Prälat nicht,“ sagte sie trotzig, „ich bin eine dienende Dirn und weiß es gleichwohl, daß es nicht kann sein, aber den Ring, den er mir einmal hat angesteckt, den geb’ ich nimmer her.“
„Ich bitte zu bedenken, meine Liebe,“ hauchte die Dame, „daß mir gar viel an dem Kleinode liegt!“
„Mir auch,“ stieß das Mädchen heraus und biß die Lippen zusammen.
„Daß es der Verlobungsring ist, den mein Emerich von mir erhalten hat.“
„Das kann schon sein,“ versetzte das Viktel, „aber Euer Mann ist er nicht. Ich weiß es recht gut, daß unser Prinz noch nicht geheiratet hat.“
„Ich muß bitten!“ sagte die Dame und erhob sich. Das Mädchen blieb sitzen, richtete sein Gesichtchen ernst und traurig zu dem blassen Antlitze der Fürstin und sprach: „Es ist nicht[S. 343] recht, daß ich es sage, aber es ist auch nicht recht, daß Ihr unverheirateter Weise so beisammen lebt. So gut wie Ihr, kann ich ihn jetzt auch lieb haben, und –“
Die Dame strich rauschend durch das Gemach; dem Mädchen knickte sein Haupt ein, es verdeckte das Gesicht mit beiden Händen und rief: „Es kann nicht sein! Ich hab’ ihn so viel lieb!“ und schluchzte laut.
Die Fürstin eilte auf sie zu, legte ihr weiches Händchen auf die Schulter der Weinenden und sagte mit Beklommenheit: „Thörichtes Kind!“
In ihren Augen selbst glänzte eine Thräne. Wie fand sie die Liebe zu dem Manne, der ihr Glück war, begreiflich, verzeihlich! Hier liebte nicht das Bauernmädchen den Prinzen, sondern das Weib den Mann. Die Fürstin haßt ja alle Nebenbuhlerinnen, wie es jedes Weib thut und nicht anders kann – aber das kindliche Geständniß dieses armen, jungen Wesens, das unter seinem Schmerze zusammenschauert, rührte sie.
„Viktoria,“ sagte sie sanft, aber im Tone, wie man zu einem Kinde oder zu einem Irrsinnigen spricht: „Du hast einen schönen Namen, Du wirst siegen über eine Leidenschaft, die Dich zugrunde richten müßte. Du wirst einen braven Mann finden, der Dich glücklich macht, wie Du es verdienest.“
„Ich bitte tausendmal um Verzeihung, wenn es ungeschickt war,“ versetzte das Mädchen und wischte sich die Thränen aus den Augen, „bin gleichwohl so gescheidt, daß ich weiß, ein armes Dienstbot kunnt nicht taugen für so einen Herrn. Nur den Ring geb’ ich nimmer.“
„Aber, meine Gute –“
„Wenn ich ihn nur nicht wieder gesehen hätt’! Ich bin in Euer Haus gekommen zu meinem Verderben!“
„Ich sage Dir noch einmal, Du sollst von heute an ein sorgenfreies Leben haben, sollst nicht mehr in den harten Bauerndienst, sollst selbst eine wohlhabende Bäuerin sein. Nur denke nicht, mein Kind, und vergesse für alle Zeit – ich wünsche es – und streife das fremde Gold von Deinem Finger, dann wirst Du froh sein.“
„Nein!“ schrie das Mädchen, „den Ring gebe ich nicht mehr. Der Ring ist verwachsen mit meinem Fleisch und Blut.“
Die Fürstin, ihrer kaum mehr mächtig, hastete bebend nach der Linken des Mädchens. Dieses riß aus und rief: „Und wenn Ihr mir den Finger abschneidet, ich kann ihn nicht lassen!“ Da trat der Prinz wieder ein und traf beide Frauen weinend. Das Viktel aber sprang auf, wies mit dem Finger auf den Eintretenden und sagte: „Den hätten Sie gefunden ermordet auf dem Wockenberg, wenn ich nicht wär’ gewesen. Aber dafür verlang’ ich nichts; daß ich ihn abgehalten, ist Christenpflicht gewesen. Nur der Ring ist’s! Weil er mir den gegeben hat, gehört er mein. Ich kann mir nicht helfen!“ – Mit diesen Worten stürzte sie dem Ausgange zu.
Die Fürstin sank auf einen Fauteuil und hauchte: „Das ist mein Unglück.“
„Was ist vorgefallen?“ fragte er.
„Sie giebt ihn nicht zurück!“
„Lasse sie, Angela, lasse sie,“ beschwichtigte der Prinz, „es ist ein albernes Wesen.“
„So sprichst Du heute, Emerich. Weiß ich aber, was war und was kommen kann? Ach, der Verlust dieses Ringes ist mir eine böse Bedeutung.“
„Was war, meine Einzige, das habe ich Dir schon zur Genüge mitgetheilt,“ versetzte er.
„Ich finde es nicht gut für einen Fürsten, sich allzu harmlos unter das Volk zu begeben,“ sagte sie.
„Ich stimme Dir bei, Angela, nur dünkt es mich langweilig, immer und immer den Herrscher spielen zu sollen. Ich sehne mich zuweilen, Mensch zu sein draußen in der Natur. Ach, warum soll der Fürst immer gefangen sein, umringt und bewacht! Die Krone, die sie mir in kurzer Zeit auf’s Haupt drücken wollen – ich gebe sie wohlfeil!“
Unmuthig sprach er diese Worte; die Fürstin streichelte ihn: „Du bist so gut, Emerich, aber Du bist ein Schwärmer. Blicke mir doch wieder einmal in’s Auge!“
Er that’s mit einem hastigen Blick und sagte: „Warum soll ich Dir nicht in’s Auge sehen können, meine Liebe! Ich hoffe, daß ich Alles, was ich persönlich thue oder lasse, jederzeit werde verantworten können.“
„Warum siehst Du so eilig wieder in die leere Luft hinein, Emerich? Genirt Dich mein Blick?“
„Ja, Angela, ja! Wenn ich in Dein schönes Auge schaue, so kann ich nicht denken und sprechen; der Gedanke ertrinkt in diesem See, verbrennt in dieser Sonne.“
„Galanter Mann! Indeß würde ich von Deiner Liebe noch tiefer überzeugt sein, wenn Du an meiner Seite bliebest, anstatt wie ein Waldmann im Gebirge herumzustreifen und Dich verschiedenerlei Gefahren auszusetzen.“
„O laß’ mir doch meine Freude an den Bergen, oder theile sie mit mir, mein Kind.“
„Ich begreife das Vergnügen nicht, zwischen den Bergen zu sein und auf Mörderhände zu warten.“
Der Prinz lächelte und versetzte nicht ohne Schalkheit: „Diesmal macht weniger der Mörder, als der Schutzengel meiner Theuersten bange. – Nein, nein, jener Landritt war[S. 346] nicht der erste und wird nicht der letzte sein. Daß ich einmal in Gefahr war, Verbrecherhänden anheimzufallen, wird mich nicht ängstlich machen. Wenn der Mann wirklich eine böse Absicht hatte – was allerdings unstreitig ist – so hatte er sie nicht gegen den Fürsten, sondern einfach gegen die Geldtasche.“
„Ich begreife, mein Herz, das Gefühl der Dankbarkeit, das Du zu jener Stunde der Befreierin aus der Gefahr entgegengebracht hast, auch ich werde der Vorsehung mein lebelang danken, jedoch bedauere ich, daß Du der Magd den Ring verpfändet.“
„Mein süßer Engel,“ versetzte nun der Prinz und legte ihr Händchen zwischen die seinen, „Du weißt nicht, wie mir damals zu Muthe war. Hätte ich Der, die mich dem Leben, die mich Dir erhielt und die für mich blutete, Geld geben sollen oder die Taschenuhr? Nein, nein. Nur das Theuerste, was ich bei mir trug, war gut genug.“
„Du solltest nicht belehrt werden dürfen darüber, was es bedeutet, wenn ein Mann einem Weibe den Ring an den Finger steckt. Nun belehrt Dich die Bauernmagd.“
„Angela!“ sagte der Prinz sehr leise, aber ernst.
Sie sah ihn scheinbar ruhig an und entgegnete: „Welch’ ein vorwurfsvoller Ton! – Ich begehre von ihr den Ring zurück.“
Sie verließ das Gemach. Er stand und blickte ihr nach und murmelte: „Ich liebe die eifersüchtige Frau; aber Deine Eifersucht, Angela, ist niedrig. – Wäre es möglich! Wäre es denkbar, daß Du recht hättest? So wärest Du es selbst, die meinen Sinn nach dem armen Mädchen wendet. – Sieh Dich vor, Angela, Ringe sind zu ersetzen, Herzen nicht! – Ich gab ihr den Reifen, so sei und bleibe er ihr Eigenthum.“
Das kleine blatternarbige Herrchen, mit welchem das Viktel bei der Ankunft im Schlosse gesprochen hatte, war Geheimsecretär des Prinzen und hieß Magister Flaus. Er war Meister in Welt- und Hofkünsten, die rechte Hand des Prinzen, die linke der Fürstin, und die Schnürchen der meisten beweglichen Puppen ringsum gingen in seiner Faust zusammen.
Bei Magister Flaus sprach nun so höflich und unterthänig, als in der Eile möglich, der Leibkutscher des Prinzen vor, ein strammer, kräftiger Kerl, der eben erst von den Uhlanen für den fürstlichen Privatdienst ausgehoben worden war.
„Was soll mit ihr geschehen?“ fragte dieser.
„Mit wem?“ fragte der Magister.
„Mit der Bauerndirn. Vor etlichen Minuten ist eine Bauerndirne die Treppe herabgelaufen; sie muß in den Gemächern der Hoheiten gewesen sein. Sie that gar absonderlich und kam mir nicht recht richtig vor.“
„Sie soll angehalten werden.“
„Habe ich gethan.“
„Warum Er?“
„Ist mir gerade angesprungen.“
„Wo ist sie jetzt?“
„In der Wachtstube.“
Magister Flaus gab Befehl, daß die junge Bauernmagd einstweilen bewacht werde; er würde dann die Sache untersuchen.
Und eine Stunde später trat der Magister aus den Appartements der Fürstin, wohin er gerufen worden war, und beschied den Kutscher zu sich.
„Er heißt Jonas Strigel?“ fragte der kleine Herr.
„Allemal,“ antwortete der Bursche und pflanzte seinen Schnurrbart auf.
„Sag’ Er mir einmal, Jonas Strigel, wieso hat Er die fliehende Bauerndirne abgefangen?“
„Ist mir eingefallen, sie könnte ’leicht was gestohlen haben.“
„War das der einzige Grund? Weiß Er nicht, daß dafür die Wache am Thore steht?“
„Das Mädel hat ganz getaumelt, wär’ arg zu Boden gestürzt, wenn ich sie nicht hätte gehalten.“
Aber der Herr Magister war auch mit dieser Begründung nicht zufrieden; er lugte so schief und zwinkernd in das Gesicht des Kutschers und sagte schmunzelnd: „Die Kleine ist nicht übel!“
„Sauber ist sie!“ stimmte der Bursche hastig bei.
„Das wär’ Eine –“
„Ja!“ rief der Kutscher.
„Zum heiraten.“
„Wohl, wohl, Herr Magister. Sie nähme mich, ich sah ihr’s an.“
„Der tausend, da seid Ihr ja schon im Reinen. Na, gratulir’! Hat auch Geld, das Mädel. Hat Er an ihrer Hand den Brillantenring gesehen, Jonas?“
„Der Teufel hol’ mich, nein. Ich hab’ nur alleweil in die Larve ’glotzt.“
„Ganz vernünftig,“ gab der Magister bei, „der Ring ist auch nicht ihr Eigenthum; sie erhielt ihn als Pfand von einem Herrn. Aber nicht so, wie Er denkt, Er schlechter Junge, Er! Wird’s schon noch erfahren, wie das war. Nun will die Landschöne den Ring nicht mehr vom Finger lassen, während dem Verpfänder daran liegt, ihn zurück zu erhalten. – Jonas,“ das Herrchen klopfte dem stattlichen Burschen, so gut er gelangen konnte, auf die Achsel. „Er ist ein gescheidter Mann und genießt unser Vertrauen. Wollt’ Er’s übernehmen, dem Mädel den Ring vom Finger zu kriegen?“
Der Kutscher drehte an seinem Barthörnchen, lugte mit halb geschlossenen Augen so vor sich hin und antwortete endlich: „Warum nicht!“
„Bis morgen müßte es geschehen sein und hat Er mir den Ring persönlich zu übergeben. Begriffen?“
„Ganz wohl, Herr Magister!“
„Und reinen Mund gehalten!“
„Verstatte mir, ist sie noch in der Wachtstuben?“
„Ei, Närrchen, wer wird so ein laubfrisch Ding in der Wachtstube lassen! Sie befindet sich im Untergebäude in den Kammern der Küchenmädchen.“
„Die weiß ich!“ Der Kutscher machte seinen militärischen Gruß und ging.
„Apropos, Jonas!“ rief ihm der Magister Flaus nach, „aber nur den Ring.“
Das arme Viktel, die junge Magd aus dem Leeshofe, saß in einem kahlen Zimmer des fürstlichen Schlosses, stützte die Ellbogen auf ihr Handbündel und starrte wie verloren auf den Boden hin. Kaum wußte sie, wie sie aus der Wohnung der schönen jungen Frau hierhergekommen war. Ihr wirbelten vor den Augen alle Farben, sie erinnerte sich nur dunkel, daß sie unterwegs auf der Treppe von einem baumlangen Menschen angehalten und gekost worden war, und daß sie in der Soldatenstube Einem die Faust in’s Gesicht geschlagen habe. Was es in einem solchen Schloß für sündhafte Leute giebt! – Dann war sie in dieses Zimmer gebracht worden. Ein Tisch stand da; sollte sie heute hier essen? Sie hat keinen Hunger. Ein Bett war hier; sollte sie die heutige Nacht darin schlafen? Das Fenster ging in einen Hof hinaus, ringsum lauter Mauern. Schon dämmerte der Abend.
Sie kam sich vor wie eine Gefangene. Was wollte man mit ihr? War der Fremde, den sie damals am Leeshofe gesehen hatte, also der Prinz? Und er hat eine Geliebte und diese will den Ring von ihr zurück haben? – Auch der Trotz ist jetzt da. Und wenn sie ihr den Kopf abschneiden, so macht sie die Hand zur Faust, daß der Ring nicht herabgeht. – Was hat diese Frau für ein giftiges Auge! Und er hat sie, das Viktel, wieder so freundlich angesehen und schier so lieb mit ihr gesprochen wie dazumal. Sie verlangt, sie mag von ihm nichts, als den Ring. –
So waren ihre Gedanken. Dann kam ihr zu Sinn, es warte in diesem Palaste nichts Gutes und sie solle trachten, hinauszukommen. Am Thore stehen Soldaten mit langen Messern. Wenn sie nur ein einziges Wort mit dem Prinzen sprechen könnte, sie glaubt es nicht, daß er ihr Böses anthun lassen will. Ihre Brust strebt lebhaft nach Athem; die Luft ist hier gerade so wie laues, faules Wasser – man erstickt.
Als es finster geworden, wurde das Zimmer von der Laterne beleuchtet, die zum Fenster hineinschien. Um diese Zeit war’s, daß das Viktel sein Bündelchen fester band und leise das Zimmer verließ.
Am dunklen Gange begegnete ihr Jemand, der sie fragte: „Wer ist das?“
„Ka Mensch braucht Spinat! mannig’s Tag’s ist’s just, wie wann’s verhext wär’!“ rief das schlaue Mädchen und fand als Gemüseverkäuferin richtig den Weg in’s Freie.
Sie lief weit die Straße hin und sie athmete auf. Die zahllosen Lichter wollten sie blenden, hier stieß sie an eine Mauer, dort an einen Laternenpfahl oder an einen der ruhelos hin- und herwogenden Menschen. So taumelte sie hin. Sie fragte nicht, nach welcher Richtung, nach einer Seite mußte[S. 351] die Straße doch aus der Stadt führen – und sonst wollte sie nichts. Je öder und dunkler die Gassen wurden, desto freier fühlte sie sich; endlich lief sie zwischen langen Gartenmauern hin, hier noch ein Haus und dort noch eines, hier noch eine Laterne, dort noch ein Fensterschein, hier noch ein Fußgänger, dort noch ein Wagen, dann von all’ dem nichts mehr, und sie stand auf freier nächtiger Heide, über sich den weiten Himmel mit Mond und Sternen.
Sie setzte sich auf einen Stein, um zu rasten, und sagte: „So, jetzt weiß ich’s, wie’s in der Stadt ausschaut.“
Sie nahm Brot aus ihrem Bündel und aß es; es war noch Brot von daheim. Im Steine des Ringleins glühte das Mondlicht, fast funkelte er lebhafter als das Gestirn des Himmels.
„Wie finde ich jetzt heim?“ fragte sie sich.
Dann stand sie wieder auf und ging und ging. Nur weit weg von der Stadt, wohin sie kam, deß fragte sie sich nicht. Plötzlich sah sie neben der Straße eine hohe schwarze Gestalt. Sie blieb stehen und blickte d’rauf hin; auch die Gestalt schien gegen sie gerichtet zu sein, regte sich aber nicht. So lange standen Beide, bis es dem Mädchen endlich einfiel: Gespenst, du bist zuletzt gar nicht lebendig! Sie nahm sich ein Herz und trat auf die Wiese hinaus und stand vor einem Schober getrockneten Klees, wie solcher an Stangen aufgespießt zu werden pflegt.
Das ist mir gerade recht, dachte das Viktel, der Klee gehört zwar nicht mein, aber ich werde ihn auch nicht fressen, ich werde nur darin liegen, bis es Tag wird. – Sie zerstörte den Schober mit kundiger Hand und machte sich ein Bett, legte sich auf Klee und hüllte sich mit Klee ein und sagte: „So, in Gottesnam’!“
Allein nach solchem Tage ging das Einschlafen nicht so leicht wie daheim nach dem Heuen oder Kornschneiden. – Morgen, so dachte sie, hab’ ich ja wieder mein gutes Bett. Aber eine närrische Fragerei wird das sein von den Leuten. Was ich Neues thät’ wissen? Zu was sie mich gebraucht hätten? Ob ich was kriegt hätt’? Nichts werde ich erzählen; braucht’s kein Mensch zu wissen, daß sie mir den Ring wieder haben wegnehmen wollen. – Geld, weiß Gott, wie viel Geld, hat sie mir geben wollen. Ich brauch’ kein’s, ich verdien’ mir meine Sach’ schon selber, und jetzt schlaf’ ich. –
Der Schlaf läßt sich nicht befehlen. Das Mädchen drückte die Augen fest zu, aber sie gingen immer wieder auf und schauten in den Sternenhimmel hinein. Eine Sternschnuppe um die andere flog hinab. „Gott tröst’ alle Sterbenden!“ sagte die Ruhende. – Im Grase zirpten noch Heimchen. Hunderte von Thierchen waren auf der Wiese und umkreisten das Mädchen; das Viktel ahnte nichts von dem, was für diese Nacht in den Mauern des Prinzenpalastes ihretwegen geplant worden war. – Da fiel ihr jetzt ein: Wenn schlechte Leute des Weges kämen und sie mich hier gewahrten im Klee! In der Nähe einer solchen Stadt giebt es gewiß allerlei Gesindel. Wenn der Graber-Schorsch daherginge! .... Sie faltete ihre Hände über die Brust und flüsterte das Gebetchen, welches sie als Kind von ihrer Mutter gelernt hatte: „In Gottesnam’ schlafen, sechs Engel werden mir wachen, zwei zu Haupten, zwei zu Füßen, zwei zur Seiten, Unsere liebe Frau wird ihren Schutzmantel ausbreiten. Amen.“
Bald nachher erschraken die Heimchen vor ihrem Schnarchen.
Der Peter fuhr früh in der Morgendämmerung aus, um Klee einzuheimsen. Schon von weitem sah er die kahle Stange ragen und fluchte über das Gestrolche, welches ihm schon wieder einen Schober auseinandergeworfen habe. Als er dem Haufen in die Nähe kam, wurde es in demselben lebendig und ein bildhübsches Dirndl sprang aus dem Klee hervor und lief davon.
Der Peter sprang ihr nach, erwischte sie, und das Viktel hatte glühende Augen und rief: „Wann Du nicht auslaßt, so kratz’ ich!“
„Kratz’ zu, kleine Hex’! Was hast Du denn in meinem Klee gemacht?“
„Geschlafen.“
„Weißt Du’s, daß der Peter in seinem Klee nicht umsonst schlafen läßt? Komm! Wir wollen zu zweit suchen, ob ein vierblätteriger dabei ist!“
„Laß aus, sag’ ich, Du großmäuliger Dingling, Du! Ist denn in dieser Gegend jedes Mannsbild vom Teufel besessen! Auslaß’!“
Der Peter hatte einen Biß in der Hand; eine so ungemüthliche Dirn ließ er laufen.
Als er den Klee auf den Leiterwagen faßte und wahrnahm, wie derselbe noch warm war, wollte er dem Mädchen neuerdings nachlaufen; zum Glück war es schon weit davon.
Sie blickte rings um und sah von Ferne die Thürme der Stadt. Sie fragte an Häusern nach dem Wege in ihre Gegend und fand sich bald zurecht.
Als es schon Mittagszeit war und ihr Schuhwerk schneeweiß vor Staub, sah sie vor sich auf der Straße einen Mann am Stocke mühsam dahinschreiten. Er war in bäuerlicher Kleidung, trug aber eine Soldatenmütze, hinter welcher das[S. 354] dunkle Haar kurz und glatt geschnitten und der Nacken frisch rasirt war. Bald sah sie: ein noch junger Mann mit falbem Schnurrbärtchen, aber abgehärmt und blaß im Gesichte.
„Kein gutes Wandern, wenn’s so heiß ist!“ redete sie ihn an. „Wie weit denn?“
„Bis Wernsdorf, wenn’s geht,“ war seine Antwort.
„So, da gehen wir ja eine Weil’ miteinander.“
„Werde wohl nicht mitkommen können,“ sagte er, sein blaues Auge blickte sie gar offen und traurig an.
„Ich gehe ja auch gerne langsam, wenn ich einen Kameraden habe,“ meinte sie, „hat Er im Fuß was?“
„Jetzt nicht mehr,“ antwortete er, „ist aber eine Bleikugel drinnen gesteckt, vom Feldzug her – und das thut Einen höllisch geniren.“
Sie sagte nichts darauf, ging still und langsam neben ihm her und dachte allerhand.
– So ist’s, wenn der Mensch großen Herren dient, der Eine geht mit Schand und Spott aus, der Andere mit einer Blessur.
Sie mußte so laut gedacht haben, daß es der Invalide hören konnte, denn er sagte nun: „Welcher hohe Herr hätte denn einen Nutzen an meinem durchschossenen Fuß? Ich bin freiwillig gegangen, wie ich gesehen hab’, der Feind wollt’ in unser Land einbrechen. Und wenn ich ein Bettelmann sollt’ bleiben mein Lebtag lang, so wird’s mich nicht gereuen, daß ich gegangen bin.“
Sie blieb stehen, schaute ihn an – es war ein schöner Kopf, seine Augen brannten nicht, wie der Blitz, sondern wärmten, wie Sonnenschein.
„Narrheiten,“ sagte sie, „wer wird denn ein Bettelmann bleiben! Wo ist Er denn daheim?“
„Ja,“ antwortete er, „daß weiß ich selber nicht recht. Gebürtig bin ich in Wernsdorf, und seit neun Jahren habe ich in Oberkirwald als Holzknecht und auch sonst herum gearbeitet, und da hab’ ich gehört, wollten mich die Wernsdorfer nicht mehr gern behalten, weil sie sagen, das Heimatsrecht wäre verjährt.“
Das gab ihr wieder zu simuliren, denn, wie wir schon bemerkt haben mögen, das Viktel war kein Weibsbild, welches blos sprechen, sondern welches auch denken konnte. Schau, dachte sie, das ist auch spaßig, der hat keine Heimat und hat sich doch für seine Heimat anschießen lassen.
„Geh,“ versetzte sie jetzt, „bist schon nicht bös’, wenn ich Du sag’ – geh’, häng’ Dich ein in meinen Arm, thust Dich gleich leichter.“
„Wenn Du schon so gut bist,“ sagte er und hing sich ein wenig an ihren Arm, „mich lust’s zwar gar nicht nach Wernsdorf, aber Deinetwegen gehe ich gern mit Dir, weil wir schon so Bekanntschaft machen. Wie heißt denn, Dirndl?“
„Viktoria Zimmermann heiß’ ich und bin Dienstmagd auf dem Leeshof in Breitegg, wenn Du’s weißt.“
„Recht gut weiß ich’s, bin letzt Jahr dort im Pfarrhof Knecht gewesen. Wenn Du etwan vom Johann Schmied einmal was gehört hast.“
„Ja Du, vom Sehen aus kommst mir eh bekannt vor,“ versetzte sie, „und sind des Pfarrer-Hansels wegen nicht einmal zwei Weibsbilder raufend worden?“
„Hast auch gehört davon? Na, Dummheiten waren es. Ich hab’ von all zweien gar keine mögen. Und jetzt, denk’ ich, werden sie meinetwegen nicht mehr viel raufen. Den Krüppel mag Keine.“
„Na, das wär’ nicht schlecht!“ rief das Viktel und war recht roth im Gesicht, dann setzte sie leiser bei: „Du kriegst leicht Eine.“
„Sapperlot,“ sagte er jetzt, „was Du für einen vornehmen Ring am Finger hast! Da ist ja gar ein Edelstein drinnen!“
„Ist mir nichts drum,“ antwortete das Viktel, „wenn er Dir gefällt, Hans, so zieh’ ihn herab...“
Was doch die Menschen thöricht sind, gerade oft, wenn ihnen das schönste Glück lacht.
Ein junger Prinz zu sein, dem man alsbald die Krone aufsetzen will, eine schöne maienfeine, liebesglühende fürstliche Braut zu haben – ich wollte mir nicht viel Besseres wünschen. Prinz Emerich wollte es eigentlich auch nicht, aber eben, weil der Mensch nicht Herr seiner Wünsche ist, so ist er nicht Herr seines Glückes. Prinz Emerich war sich’s vielleicht gar nicht bewußt, was er wollte, oder gestand sich’s nicht ein. Das half ihm aber nichts, er fühlte sich unbehaglich, unzufrieden.
Mit erneuter, erzwungener Lebhaftigkeit wandte er sich zu Angela, der Eifersüchtigen, Leidenschaftlichen, dem Weibe mit diesen zwei Fehlern, die sonst den liebenden Mann zu entzücken pflegen.
Ihre Eifersucht hatte zuerst das Gespenst genannt, das seither nicht mehr ganz von ihm gewichen war. Es neckte und ängstigte ihn mit lieblichen Träumen. Er sagte es laut und sagte es still, er habe nur die Fürstin lieb, aber sein Herz loderte an ihrer Glut nicht auf, wie sonst, er dachte an –
Ja wohl, er dachte an jenes Wort seiner Braut, der hingegebene Ring hätte kein gutes Bedeuten. Jenes einfältige Kind – es ist ja doch noch ein Kind – kennt nicht einmal den[S. 357] Geldeswerth des Ringes, der ihr an Gold zehnmal aufgewogen wird, und es giebt ihn nicht vom Finger. Sie denkt nicht an den Mann, aber sie will seinen Ring, und ahnt es nicht, was von ihm an diesem Ringe hängen geblieben ist...
Als der Winter vorbei war mit seinen glänzenden Festen und glänzenden Qualen, mit dem starren goldenen Joche des höfischen Lebens, unter welchem Mancher seufzt, aber Alle lächeln müssen – jene in Rosen maskirte Last, welche der Menschheit ewiger Dämon, der Keinen wahrhaftig glücklich sein läßt, tückisch dem Reichen aufgebürdet hat – als die „Saison“ vorbei war und der Frühling hereinlächelte über die Mauern der Stadt, da fühlte Prinz Emerich in sich die Sehnsucht erwachen nach den Bergen. Hinaus in die stille, einfache, große Natur und zu jenen schlichten Menschen, deren Tugenden größer sind, als die der Vornehmen, weil sie selbstloser sind; deren Fehler und Laster unschädlicher sind, als die der Großen, weil es ihnen an Macht gebricht.
Und eines Tages bestieg er sein Roß und ritt incognito davon. Warum er gerade die Richtung nach Breitegg einschlug? War es die von Ferne blauende Höhe des Wockenberges, die ihn reizte? Als er unterwegs auf den Fluren die jungen, anspruchslosen Blümlein sah, da dachte er wieder an das Viktel. Das war jenes von Eifersucht erweckte, liebliche Gespenst. Aber sie hatte für ihn geblutet. – Die Zeit her nicht allzu selten, wenn sein Sinnen unbewacht war und er sich dem stillen Hinschwärmen übergab, war ihm das Bauernkind eingefallen, das seinen Ring trug. Allmählich hatte seine dichterische Seele ihr anmuthiges Bild umgestaltet und vervollkommnet zu einer jener reizenden Schäferinnen, von denen die alten Sänger erzählt haben, und für die er schon als Knabe eine wunderliche Zuneigung gefühlt hatte.
Das schwarze Hengstlein trabte flink dahin, als wüßte es den Weg, den sein Herr meinte. Die Hügel erhöhten und bewaldeten sich und der Wockenberg kam immer näher; das Blau seiner Wälder bräunte sich und seine Felsenzinnen wurden schärfer und schärfer. – Oft sehnte sich Prinz Emerich nach einsamen Höhen. Die gesellschaftliche Höhe, auf der er stand, wollte ihn nicht befriedigen; es schien ihm, als wäre von ihr aus der Blick auf das Leben ein gar umnebelter und verschobener. Ihm verlangte nach freier, reiner Höhe, um mit dem klaren Auge des Denkers und dem warmen Herzen des Menschen die Welt zu betrachten. Er kannte den hohen Werth der Kunstblume: Civilisation, aber er suchte und liebte auch das verborgene Veilchen und das Dornröschen in der Wildniß.
Hinter der mit jungen Buchen besetzten Schlucht, welche aus der Hügelgegend in das Bergthal von Breitegg führt, sah unser Reiter neben dem Wege einen Mann, der auf dem Feldhange mit einer Haue emsig in die Erde Löcher schlug und in jede dieser Vertiefungen etwas hineingleiten ließ. Der Mann trug eine Soldatenmütze.
„He,“ rief der Reiter dem Arbeiter zu, „was macht Ihr da?“
Der Andere zog seine Mütze und antwortete: „Ackerbohnen setzen.“
„Gehört der Acker Euch?“
„Das nicht. Hab’ ihn in Pacht, bis die Bohnen zeitig sind.“
„Und seid Ihr ein Freund von Bohnen?“
„O, das wohl, wenn sie nicht von Blei sind.“
Das Pferd war ungeduldig, aber der Reiter zähmte es, daß es stand, und er sagte zum Arbeiter: „So scheint, daß Ihr auch mit Bleibohnen Bekanntschaft gemacht habt?“
„Mag wohl sein, Herr. Da drinnen“ – er deutete auf den Schenkel – „hat eine gesteckt. Habe den letzten Feldzug mitgemacht.“
„Ei, da sind wir ja Waffenbrüder!“
„So! Auch dabei gewesen? Gewiß bei den Dragonern. Na, das freut mich. Wollt’ der Kamerad nicht ein wenig Rast halten? Da, wie die Straße um den Berg biegt, steht gleich mein Häusel. Meine Alte kann Ihm mit Buttermilch aufwarten und der Rapp – ei ja, ein sauberes Thier! – mag ’leicht einen Schippel Heu; ich komme bald nach, will voreh just mit der Handvoll fertig werden.“
Der Reiter nahm die Einladung an, bog um den Berg, hielt vor dem Häuschen und sprang vom Pferde. Als er sich bückte, um durch die niedrige Thür einzutreten, stand das Viktel vor ihm. Er erschrak, sie nicht.
„Herr Hochheit,“ redete sie ihn an, „das gefreut mich, daß Er uns auch einmal heimsucht.“
„Wie!“ rief der Prinz, „da finde ich ja meinen Schutzgeist!“ Sein erster Blick war auf ihre Hand, sie trug ein Ringlein, aber nicht das seine.
„Ist vorbei,“ entgegnete sie, „wer wird denn von so Sachen so lang’ reden! Wenn der Herr Hochheit niedersitzen möcht’! Ist halt Alles so viel ungeräumt bei uns. Jetzt muß ich aber geschwind meinen Mann herheißen.“
„Wenn es der Bohnensetzer ist,“ sagte er, „der kommt bald nach, hab’ schon mit ihm gesprochen. – Also, verheiratet, Viktel!“ Er sagte das Wort leise und weich und blickte ihr in’s Auge. Aber jetzt that ihr sein Blick nichts mehr.
„Ich hab’ einen braven Mann kriegt,“ entgegnete sie, „von Wernsdorf ist er gebürtig. – Ja, und jetzt fällt mir was ein.“
Sie eilte in eine Nebenkammer, kehrte bald wieder zurück und hielt zwischen den Fingern einen in weißes Papier gewickelten Gegenstand.
„Das gehört dem Herrn,“ sagte sie, „ich brauch’ es nicht.“
Er nahm den Gegenstand und schälte ihn aus dem Papier, es war der Brillantring. – Er verbarg seine innere Bewegung und sagte ganz gelassen: „Sie giebt mir das zurück und denkt nicht daran, daß es mich kränken könnte?“
„Bitt’ halt um Verzeihung,“ antwortete das Viktel, „ich red’, wie ich’s versteh’, aber ich sag’, auf’s Kränken darf man nicht allemal schauen. Es ist recht närrisch von mir gewesen und ich will es dem Herrn Hochheit seiner Frau Braut tausendmal abbitten, daß ich dazumal den Ring nicht hergegeben hab’. Wenn Ihr Euch miteinander einmal versprochen habt, so gehört der Ring dem Herrn und der Herr gehört ihr und da hilft Alles nichts. – Thu’ ihn jetzt der Herr Hochheit nur einstecken, daß Er ihn nicht verliert, und ich bedank’ mich für den guten Willen.“
Bei Hofe lernt man ein gutes Benehmen für allerlei Gelegenheiten und Verhältnisse. Aber in dieser Sache wußte der Prinz nicht, was er sagen und thun sollte. Er hielt den Ring lange in seiner Hand und betrachtete das Viktel. Nun aber war’s seltsam. Ein unsichtbarer Faden, der sich so allmählich gesponnen, der bisher sein Herz so eigenartig beunruhigt und ihn in diese Gegend gezogen hatte, war nun plötzlich wie abgeschnitten. Er begriff nicht, wie er an dieses Bauernmädchen so oft hatte denken müssen. Es war, wie alle anderen hübschen Dirnchen auch sind. – Aber – und das fiel ihm nun ein – die Eitelkeit! Wie maßlos muß die Eitelkeit eines Mannes sein, wenn sie selbst einem Fürsten gefährlich werden kann, welcher weiß oder zu wissen glaubt,[S. 361] daß eine Bauerndirne in ihn verliebt ist! – Ob denn nicht doch die Eitelkeit ein gutes Theil zur wirklichen Liebe beiträgt? – Nun sie einen Andern nahm, ist’s in ihm kühl. Er sah sie an und gestand sich nur noch das Eine: Konnte sie auch nicht so schön sein, als sie in ihrer Abwesenheit ihm die Phantasie gestaltet hatte, so war sie doch eigentlich schöner als vor einem Jahre. Die Farbe ihres Gesichtes war zarter und ein wenig weißer, ihr Auge schien größer und noch milder, ihre Lippen lächelten weicher und ihre Locken schmiegten sich noch ungezwungener um das Köpfchen, wie damals. Auch waren die Formen ihres Körpers gerundeter.
Dann betrachtete der Prinz das ärmliche, aber reinlich gehaltene Häuschen und sagte nun: „Warum habt Ihr nur keinen größeren Hof gekauft?“
„Das Kaufen ist leicht gesagt,“ meinte sie.
„Ihr zieht es vor, das Geld auf Zinsen liegen zu lassen.“
„Wir haben keins.“
„Es ist doch bekannt, daß bei Eurem Gerichtsamte eine Summe für Dich hinterlegt wurde?“
„Ich bedank’ mich recht,“ sagte sie, „aber für den Rath, daß der Herr nicht mit dem Schorsch auf den Berg gehen sollt’, will ich nichts nehmen. Unsereins braucht auch oftmals guten Rath und kann ihn nicht zahlen.“
„Doch für den Blutstropfen.“
„Ist lang’ verheilt. Gießen ja auch die Soldaten ihr Blut aus und kriegen nichts dafür.“
„Also für den Ring, den Du hier zurückgiebst.“
„Schon gar nicht,“ rief sie und ging einige Schritte von ihm weg, „für den Ring schon gar nicht.“
Nun trat mit seinem steifen Fuß der Hans ein, der Bohnensetzer.
„Das Roß steht draußen in der Sonn’ und hat nichts zu fressen,“ verwies er, „das hätt’ beim Militär nicht sein dürfen! – Na, Herr Kamerad, thu’ Er sich kamod machen, den Rappen will ich schon besorgen. Hast keinen Wachholdernen mehr daheim, Viktel?“
Er meinte Branntwein, sie aber war erschrocken über seine Rede und sagte leise: „Kennen wirst ihn doch, den Herrn! Nicht! Jesus und Josef, das ist ja der Herr Hochheit, der Prinz!“
Jetzt starrte der Hans auf den Reitersmann, dabei zog er langsam seine Mütze ab.
„Laßt das,“ versetzte der Prinz, „wir haben Anderes zu besprechen.“
„Ist mir eh gleich so rar gewesen!“ rief nun der Hans drein, „hab’ ja beim Tambach-Defilé die hohe Ehr’ gehabt; haben sich aber Eure Hochheit seither den Bart weggeschnitten! Na, bitt’ gehorsamst.“
Sie redeten noch ein Weilchen hin und her. Der Prinz genoß eine Schale Ziegenmilch. „Besseres,“ meinte das Viktel, „können wir nicht aufwarten.“
„Ihr beschämt mich tief, wenn ich mich erinnere, welche Gastfreundschaft der Viktoria in meinem Hause zu Theil geworden ist. Ein bischen ist sie jedoch selbst daran Schuld, sie lief auch so davon.“
„O heilige Maria, wie bin ich froh gewesen, als ich vom Schloß draußen war!“
„Ich hatte die Absicht, Dich zu bewirthen –“
„Um’s gute Essen ist mir nicht viel.“
„Und Dich den Herrschaften vorzustellen.“
„Na, na, die Schloßherrschaften, die kenn’ ich schon,“ eiferte das Viktel, „den Herrn Hochheit nehm’ ich aus, aber die andern Männer sind all’ nicht viel werth.“
Es ist hierauf Einiges angedeutet worden, wobei Prinz Emerich Mühe hatte, seinen Zorn zu unterdrücken. Dann aber sagte er, das junge Weib an der Hand fassend: „Du bist eine vernünftige Frau, so wirst Du den Hof nicht nach seinen niedrigen Elementen beurtheilen. Es giebt auch im Palaste gute Menschen, die Euch schlichten Landleuten näher stehen, als Ihr glaubt, weil sie ganz wie Ihr streiten und leiden, weil auch dort, trotz aller goldenen Pracht, nur zwei Dinge sind, die glücklich machen können, das gute Gewissen und die Liebe. – Euch, Ihr lieben Menschen, ist wohl Beides beschieden; ein Drittes ist wünschenswerth, und ich wünsche daher, daß Ihr es annehmt. Will diese hübsche und stolze Frau ihre gute That nicht für Geld gethan haben, so wird es der Mann, der wacker für sein Vaterland stritt und davon ein Wundmal durch sein Leben trägt, nicht hindern dürfen, wenn ihm sein Fürst eine Ehrengabe reicht. Freut Euch die Landwirthschaft, so hoffe ich, daß ich im nächsten Jahre auf meiner Wanderung in Euern Großbauernhof einkehren kann.“
Der Hans sagte zum Viktel: „Wenn er es uns schon so gut meint, warum sollen wir es nicht dankbar annehmen? Brauchen wir es nicht, so wird’s unserem Bübel taugen, wenn es ein Großbauernsohn ist.“
Sie nahmen es an. Der Prinz schüttelte Beiden wacker die Hände, bestieg sein Roß, ritt heimwärts und liebte seine Fürstin.


In den schattenfrischen Thalgründen des oberen Jiller steht so manches alte Mauerwerk, an dem bedächtige Geschichtsforscher, magere Sagensammler und langhaarige Maler hin und her klettern wie Steinböcke und Gemsen im Gefelse, nur daß sie nicht ganz so behendig sind. Ritterburgen und Räubernester! ’s ist ein gar so dankbarer Stoff allerwege, zumal, da diese Dinge heutzutage nicht mehr so herrisch und gefährlich sind, wie voreinst in der guten alten Zeit – Gott habe sie selig!
Da giebt es aber doch in den schattenfrischen Gründen des oberen Jiller eine Ruine, die völlig unbekannt und verlassen ist. Sehr viel Haselnußgebüsch umwuchert das graue, zerklüftete und zerbröckelnde Mauerwerk, und wenn die Haselnüsse reifen, so sind zumeist die Spechte und anderen Knacker schon davon und die Dingelchen fallen nieder durch das gilbende Blätterwerk und kollern auf das Gestein und bleiben liegen im Schutt und in den Rissen: „Ist Niemand da, der Haselnüsse mag?“
– ’s ist Niemand da. Die schönen jungen Frauen, die voreinstmal, als hier noch der große stolze Bau stand, darin gelebt haben, hätten gerne bisweilen ein wenig so Nüsse geknackt, aber da sind solche noch nicht gewachsen an den[S. 365] Wänden, in den Höfen, in der Kapelle und in den Zellen des Nonnenklosters Taubenzell. Und wollten die gottseligen Jungfrauen dergleichen wilde, aber deswegen doch süße Früchte nagen, so durften sie sich den kleinen Gang hinaus in den Hirschwald nicht verdrießen lassen. Da oben war Haselnußgesträuche so dicht und voll als man es nur wünschen konnte, und der Thierlein gab es auch so manche, die im Moose krochen, im Strauchwerk raschelten, in den Lüften flogen und den gottseligen Jungfrauen zur Kurzweil waren.
So war es auch einmal am Tage der heiligen Edeltrudis; die Haselnußbüsche setzten erst ihre kleinen Knösplein an, denn es war der Rosenmonat und zum Reifen lange noch Zeit. Aus dem Engthale, in dem das Kloster stand, stieg ein halb Dutzend Nönnlein hinan gegen den Hirschwald; – jede hatte ihren dunkelgrauen Habit mit der weißen Busenbinde und dem braunen Rosenkranz; jede hatte ihren Capuchon, den sie aber heute über den Nacken hinabhängen ließen oder gar als Sack für die Sammelfrüchte benutzten. Und jede hatte auch einen recht zierlich geflochtenen Korb an die Seite gebunden, denn sie gingen aus, um Schwämme zu suchen und Erdbeeren zu finden. Sie hatten von der Oberin die Grenze vorgeschrieben, über die sie nicht hinaus durften, um nicht etwa in das Revier der Ritter von Karnguld, oder in ein Bereich zu gelangen, dessen Schwämme und Erdbeeren nicht mehr zum Kloster Taubenzell gehörten. Es waren derlei Maßregeln gar nicht überflüssig, denn die Früchtesammlerinnen waren lauter unerfahrenes Blut, jung, lebendig und wohl auch hübsch. Nur eine war dabei, die einen ganz kleinen Schaden hatte. Dieser Schaden bestand in einem winzigen Härchen; das Härchen stand mitten aus einem Wärzchen her[S. 366]vor, das Wärzchen hinwiederum stand zuhöchst auf der Spitze des Näschens, das sehr anmuthig gewesen wäre, wenn es nicht ein wenig allzu kühn in die Welt hineingeragt hätte, der die junge Nonne doch in Form Rechtens entsagt hatte. – Es steht zwar nicht in den Kloster-Annalen zu lesen, daß dieses Härchen aus dem Nasenwärzlein der hochehrsamen Jungfrau Natalia vormals den jungen Männern so sehr in die Augen gestochen habe, daß sich diese sofort geschlossen, oder anderen Dingen zugestrebt, bis Natalia sich von dem Irdischen zu dem Himmlischen wendete und in die friedsamen Mauern von Taubenzell flüchtete; – aber von der boshaften Welt war derlei thatsächlich behauptet worden. Sei dem wie immer, hoffen wir, daß desweg’ der Jungfrau Lohn im Himmel nicht geschmälert ist.
Wir könnten nun auch noch von den übrigen Früchtesammlerinnen manch’ Erbauliches erzählen, doch möge sich der Leser zumal mit der Versicherung begnügen, daß sie allsämmtlich sehr hübsch und heiter waren.
Eine Einzige jedoch insonderheit; Gudwella hieß sie, die hatte kaum fünfzehnmal gesehen, wie die Kirschen blühen; die war auch noch gar nicht eingemummt in den dunklen Habit der Genossinnen, war erst kurze Zeit als Novize im Kloster Taubenzell. Sie trug ihr luftiges, lichtbuntes Kleidchen, in dem sie wie ein kleiner Schmetterling neben den grauen Puppen flatterte. Sie hüpfte über jede Hecke, stieg auf jeden Stein, predigte, äffte hierin den alten Klosterkaplan, so daß die Genossinnen in die Händchen klatschten. Dann wieder beugte sie sich zu einem Waldmeisterblümchen, hob davor den Finger und sprach: „Ich könnt’ es wohl, aber merk’, ich brech’ dir nicht den Hals. Wachse brav, bist du groß, so wirst mein Mann, will einen Waldmeister han!“ Auch spielte[S. 367] die Kleine Versteckens und wußte wie ein Rehlein hinter jegliches Laubwerk zu schlüpfen, und während sie die Anderen etwa unter dem Erlbusch suchten, war sie längst hinter dem Hagebuttenstrauch, oder in den Haselstauden, oder hinter den Johannisbeerblüthen. Plötzlich rief sie aus einer Bachweide her: „Schwester Natalia lobesam, komm’ mal her und hol’ Dir diesen schönen Blattpilz!“ – Und als die Schwester herbeieilte, um sich nach der Gabe Gottes zu bücken, da that sie jählings einen kreischenden Schrei und huschte hintan. Der Blattpilz war ein junger Laubfrosch gewesen, und der wäre dem tugendsamen Mägdlein schier mit allen Vieren in das Antlitz gesprungen. Die Genossinnen lachten laut und Gudwella kicherte hinter den Weiden.
So kamen sie immer tiefer in den schattendunkeln Wald hinein, und zu allem rieselte der laue Sommerhauch in den Blättern, die in Millionen Scheibchen und Herzchen auf dem Gezweige wiegten, da und dort ein übermüthiger Falter, ein schalkhaft Vöglein darunter. Das Haidekraut mit seinen lieblichen Blüthenkrönchen und winzigen Staubgefäßen wurde auch immer höher und die Nonnen mußten mit ihren weißen Händchen die grauen Kutten baß emporheben, wollten sie nicht hängen bleiben im Gestrüppe. Gudwella, welche in solchen Fällen immer die Anschicksamste war, hatte ihr ohnehin nicht sehr langes Kleidchen ein- für allemal mit einem buchenzweig’nen Gürtel so hoch hinangeschnallt, daß nachgerade jegliche Gefahr für den Saum beseitigt war. Bald thaten ihr das auch die Anderen nach, und nun hatte jede ihren flatternden Laubkranz um die Hüften, und manch’ Eidechslein unter dem Kraut stand verwundert still, die neue handsame Tracht der Nonnen von Taubenzell betrachtend.
Der Schwämme wollten sich nur wenige finden und so hüpften die Nönnlein immer weiter waldeinwärts und kamen endlich gegen eine Schlucht, in der ein Wasser rauschte, und in der es so finster war, daß die paar Sonnenpunkte, die sich doch durch die dichten Laubkronen Bahn gebrochen hatten, auf dem braunen Moosboden dalagen wie blinkende Dukatlein.
Gudwella, der sich in der Hitze der lustigen Waldwanderung das Gesichtchen geröthet und das goldfarbige Haar gelöst hatte, war immer die Erste voran. Jetzt aber stand sie plötzlich vor einem blühenden Dornstrauch still, legte ein Händchen an den Mund und winkte mit der anderen Hand ihren nachfolgenden Gefährtinnen, daß sie leise herankommen und keinen Laut von sich geben sollten. Das hielten sie denn auch so und schlichen ganz behutsam gegen den Dornenstrauch, begierig auf ein Vogelnestchen, das sie darin zu sehen hofften.
Indeß meinte Gudwella ganz etwas Anderes. Sie guckte in den Strauch, und zwischen den Blättern und Rosen desselben auf der anderen Seite wieder hinaus, sie sah in die Schlucht hinab, in der das Wasser rauschte. Und dort war zwischen bemoostem Gestein, welches in Wänden den schattigen Raum umfriedete, eine Stelle, an der das Wasser ganz ruhig stand, und sehr klar und tief zu sein schien. Und in diesem versteckten Wasser war etwas, weswegen Gudwella so angelegentlich in den wilden Rosenstrauch lugte.
In dem Wasser, das zwischen dem Gestein ruhig stand, plätscherten die schlanken weißen Glieder eines schönen Knaben, der sich badete. Die Mädchenschaar riß ihr ganzes Dutzend Augen auf und spähte in die Schlucht und ergötzte sich höchlich an dem schönen Haupte mit den kohlschwarzen Augen, in denen etwas ganz Unbeschreibbares, fast wie Thau und Feuer lag, ergötzten sich an den dunkeln Lockenschlangen, die sich[S. 369] völlig bis zu den breiten Schultern hinabschlängelten, ergötzten sich an den ein bischen aufgeworfenen kirschrothen Lippen, hinter welchen zuweilen das Schneeweiß der Zähne hervorblinkte, an dem feinen Kinne, an den zarten, schier fraulichen Wangen, an der kühnen weißen Stirne; ergötzten sich endlich an den behendigen Armen, an der hohen, ebenmäßig schönen Brust, über die ein dunkles Schattchen ging. Jählings aber plätscherte es heftig im Wasser und die Jungfrauen stoben zurück.
Wie eine erschreckte Taubenschaar waren sie auseinander gefahren und drehten sich jetzt schier verwirrt im Kreise und wußten nicht, wohin mit den Augen. Keine brachte ein Wort hervor. Jede hub eilig an, Schwämme zu suchen im Gebüsche, wo seit der Welt Erschaffung kein einziger noch gewachsen. Vor jedem grünen Heupferdchen und vor jedem Käfer im Grase schraken sie zurück. Hernach huben sie selbander an zu kichern und schließlich schlichen sie wieder gegen den Dornstrauch, um doch die schönen lichten Röslein zu betrachten, und die gelben klebrigen Fädchen, die inmitten derselben hervorstanden und im Lufthauche gar leise wiegten. Auch waren die kleinen länglichen Blätter so frisch grün und hatten so fein gezackte Ränder, und am holdseligsten waren doch noch die Knöspchen, aus denen schon ein wenig das Roth der Blüthe guckte. – Ja, so ein Dornstrauch ist eigentlich ganz wunderbar schön, wer ihn recht mag besehen! Und die braunen schlanken Zweige, und die scharfen, halb verborgenen Dörnchen daran – man muß sich ja nicht immer davon stechen lassen! –
Der Edelknabe Rodam hatte wohl nicht geahnt, daß Liebhaberinnen des Dornstrauches so nahe waren; er hatte sich in aller Behaglichkeit und Lust im Wasser gewiegt, gerenkt, gehoben, hatte seine geschmeidigen Glieder gestreckt[S. 370] nach allen Seiten, hatte selbst ein paar prächtige Purzelbäume geschlagen in der krystall’nen Fluth – bis er endlich, des Vergnügens satt, auf den Moosteppich des Ufers sprang und dort noch unterschiedliche Kurzweil trieb, ehevor er in seine schmucken Kleider schlüpfte.
Und als er nun so in seinem grauen, stets knapp geschnittenen Tuche, das kirschrothe Seidenwamms und das blaue Mäntelchen um sich geworfen, das Sammtbaretlein keck in die Stirne gedrückt und selbst einen zierlichen Degen schon an den Lenden, dahin sprang über Gestein und Gebüsch, wie ein junger Hirsch, der sich an der Quelle gelabt hat – da gab es nichts Besonderes mehr am Dornenstrauch, da blickten die Nönnchen dem flinken und heiteren Jungen nach, bis er, im Dickichte verschwunden, dem Schlosse der Ritter von Kernguld zueilte.
Und da sonach nichts mehr zu sehen war ringsum, als das aufquellende und webende Leben der Wildniß und das dunkle Wasser in der Schlucht, da schrie Gudwella: „Jetzt weiß ich’s, jetzt geh’ ich in’s Wasser und lern’ das Schwimmen!“ Da jauchzten ihr alle Anderen zu und sagten dasselbe; allein das Mädchen war bereits davon gehüpft, hatte flugs sein Röcklein hingeworfen und war mit einem hellen Juhschrei in den Dumpf gesprungen, in welchem kurz vorhin der Edelknabe geplätschert hatte. Sie wogte lustig hin und wieder, streckte die zarten Arme nach den Wellen aus, die sie selbst geschlagen hatte, und goß diese Wellen über ihr Haupt. Nun kamen auch die Genossinnen herbei, da schrie Gudwella: „Nichts, da ist nur Platz für Eins, geht ihr dort unten!“ Und sie schlug so heftig um sich, daß die Anderen dem Gischten nicht nahen konnten, wollten sie nicht mit pudelnassem Habit in’s Kloster zurückkehren.
Das hat die fünf Jungfrauen gewaltiglich verdrossen, denn just hier in diesem Dumpfe hätten sie sich an der weichen Kühle zu erquicken gewünscht.
„Wißt Ihr was, Schwestern“, sagte nun Natalia, die Jungfrau mit dem Härchen, „jetzt wollen wir Anderen gar nicht baden. Und es schickt sich auch nicht, und wir wollen es der Oberin sagen, was diese Gudwella für ein ungesittig Mädchen ist. Jetzt aber eilen wir fürweg, sie mag allein sehen, wie sie ihre Schwämme findet.“
Deß waren die Uebrigen einverstanden. Sie waren nicht sonderliche Freundinnen der toll-heiteren Gudwella, die Jeder gern ein Schnippchen schlug und trotzdem vor der Oberin der Hahn im Korbe war, gleichwohl sie noch ein Küchlein im Ei und lange noch nicht genug Fähigkeit hatte, ja vielleicht niemals haben würde, wie solche von einer tugendsamen Schwester im Kloster Taubenzell wohl verlangt wird.
Die Nonnen von Taubenzell hatten keine Obliegenheiten, die sie noch mit der Welt verbunden hätten, sie lehrten nicht etwa verwahrlosten Bettelkindern das Lesen und Schreiben, noch weniger drängten sie sich an die Betten verwundeter Krieger oder anderer Kranken, trieben auch nicht Ackerbau, noch anderes Gewerbe, wie solche Dinge so gerne den Geist vom Himmlischen ablenken. Das Kloster war von einem frommen Könige gestiftet worden, der selbst zuweilen nicht ungerne durch die neu angelegten Gärten und Lauben schritt und die sittsamen Jungfrauen mit väterlichem Wohlgefallen betrachtete, Gott dankend, daß er nicht in jener heidnischen Religion geboren war, in welcher die Könige ihren wohlgearteten Frauen nicht Klöster, sondern Harems anlegen. – Es war eine hohe Grundsumme für die Anstalt hinterlegt worden; außerdem mußte jede eintretende Novize ihr gutes[S. 372] Schärflein mitbringen, und nebstbei waren alle Güter und Höfe in weiter Runde dem Kloster gabpflichtig, alljährlich gingen der älteren Schwestern dreie mit großen Körben und Säcken hausiren, um die Gaben einzuheimsen. Was ferner Gott in den Gärten und im Hirschwalde wild wachsen ließ, das sammelten die in so vieler Hinsicht bienenfleißigen Nonnen auch ein – und so ließ sich auf bequeme Weise ein recht frommes Leben führen und mit Gebet, Gesang und erbaulichen Betrachtungen dem Himmel zustreben.
Es waren wohl auch strenge Satzungen aufgeschrieben, um die Sittsamkeit, sonderlich die Keuschheit zu hüten, die indeß, wie jedes Meistergesetz, nach Bedarf und Umständen gewendet werden konnten. Das Bedenkliche dabei war nur, daß zu Sittenrichtern und Vollstreckern der Strafurtheile stets die älteren Jungfrauen, die Patriarchinnen sozusagen, bestimmt waren. Die irdische Gerechtigkeit kennt keine strengeren und unerbittlicheren Richter, als derlei gottselige Matronen, die niemals gefallen zu sein glauben, oder den Fall zu verheimlichen wissen, oder desselben selbst vergessen haben.
Es lebten an die dreißig Jungfrauen in den Mauern zu Taubenzell, die der Sage nach thatsächlich so unschuldig wie die Tauben gewesen sein sollen.
Doch hatte sich einmal – es war etwa sechzehn Jahre vor den hier erzählten Begebenheiten – etwas sehr Besonderes ereignet. Der Wolf im Hag genannt, das war der Besitzer der Hageburg, eines großen Gehöftes jenseits des Berges, ein kräftiger herrischer Mann, hatte eine Nonne aus Taubenzell entführt. Es war dabei keine Vermummung und keine Strickleiter und kein Mauerdurchbruch in Anwendung gekommen, denn die Nonne ging gern, ging von selbst, kam ihm schon auf dem halben Wege entgegen. Sie hatte es bei[S. 373] Zeiten eingesehen, daß ihr jung’ Fleisch und Blut nicht just ausschließlich für’s Beten und Singen gemacht, sondern auch für Gottes liebe Geschöpfe tauglich war; und da war es ihr einmal in den Sinn gekommen, unseren Herrgott könnte es leichtlich verdrießen, wenn sie ihre Talente vergrabe und nicht anwende und ausnütze, wie andere Leute die ihren. Ließ sie sich denn von dem Wolf im Hag gern entführen, und bald war auch die Hochzeit vorbei. Als aber das erste Kind, ein Mädchen, zur Welt kam, da starb das Weib; und als dieses Kind gegen das jungfräuliche Alter schritt, da erfaßte den Mann und Vater jählings der Geist der Frömmigkeit. Er war einer langwierigen Krankheit verfallen, und da er in derselben die Nächte hindurch oft schlaflos in seinem einsamen Bette lag, gleichwohl von jeglichem Ungeziefer verschont, hub doch das Gewissen an, ihn zu beißen. Er kam sich gar entsetzlich lasterhaft vor. Insonderheit quälte ihn der Gedanke, daß er sein verstorbenes Weib dem Kloster entlockt und es dergestalt leichtlich der ewigen Verdammniß zugeführt habe. Und wenn der Kranke doch in einen Schlummer fiel, so war er in demselben sehr unruhig und es erschien ihm im Traume sein Weib in einer Gestalt, welche die Muthmaßung von der Verdammniß nur bestätigte. Darüber fragte der Wolf im Hag einen Priester, und dieser gab ihm zu verstehen, zu Beider, seines und seines Weibes Seelenheil und Sicherheit sei es allerdings räthlich, daß etwas gethan, daß nämlich dem lieben Gott ein ihm geraubtes Schäflein wieder zurückgegeben werde. Das verstand der Wolf und er entschloß sich, sein einzig Kind, sein Töchterlein Gudwella in jenes Kloster zu stellen, aus welchem er sein Weib gezogen hatte. Das heitere, tollwitzige Kind, das trotz einem Knaben den Finken und Goldamseln nachstöberte, die Forellen und Krebse mit bloßen[S. 374] Händen aus dem Waldbache fing, dem kein Graben zu tief und keine Hecke zu hoch war, das mit allen Wesen der Erde seinen Schabernack trieb, sich selbst dabei zum Pfande einsetzte und in allen Lagen seine unbändige Lebhaftigkeit und gutmüthige Lustigkeit bewahrte – dieses Weltkind sollte nun in’s Kloster gehen. Doch war es beschlossen, und daraus machte sich Niemand weniger etwas, als Gudwella selber. Das Mädchen freute sich ordentlich auf das viele Beten und Singen, weil es mit seiner schallenden Stimme alle anderen Klosterfrauen leichtlich zu überschreien hoffte. Das Mädchen nahm sich vor, im Kloster mit beiden Händen fromm zu sein, und zeitweilig auch noch mit den Füßen nachzuhelfen, kurz, in den Mauern zu Taubenzell ein recht lustiges Leben zu führen.
Hat’s auch so gehalten, die kleine Jungfrau Gudwella, und gleichwohl in Zucht und Strenge gehalten, zu ernsten Betrachtungen und trübseligen Dingen angeleitet, war doch nichts, wovor Gudwella zurückschreckte; sie war in Allem dabei und mitten d’rin, und sie verstand Allem die leichte und heitere Seite abzugewinnen, und war immer vergnügt, oft ausgelassen, während sie sonst Jegliches zur Zufriedenheit der Oberin verrichtete.
Wir haben ihre Art heute auf dem Waldwege bereits ein wenig kennen gelernt.
Als Gudwella sich nun einsam in dem dunklen stillen Wasser sah, in welchem vorhin der Edelknabe geschwommen war, da trat sie etwas Eigenes an, sie wußte nicht, wie ihr war, was sie sollte; es kam ihr vor, als müsse sie in dem Gewässer noch die Wärme empfinden, die der Knabe in ihm zurückgelassen hatte. – Ihr Uebermuth war völlig geschwunden, es ging ihr durch’s Mark, schier als ob ein seltsam Gift in den Tropfen wäre. Sie rang mit den Wellen, an ihren[S. 375] Busen wollten diese sich legen wie Blei und Glut. Sie war in Gefahr unterzusinken, da schrie sie plötzlich: „Dieses Wasser ist verhext!“ und schwang sich an das Ufer.
Zitternd zog sie die Linnen an, die vom Gischten naß geworden waren, so daß dieselben sich nun glatt und weich um die Formen ihrer Glieder schmiegten und dermaßen wohl auch das Wandeln erschwerten.
Sie irrte im Walde umher und war in sich verloren; sie horchte dem Wasserrauschen und erschrak wieder vor demselben. Ein weißes, verlaufenes Kaninchen fing sie ein, setzte sich damit auf das Gras und hub es auf ihren Schoß. Das Thierchen glotzte sie mit seinen rothen Augen treuherzig an und zog fortwährend sein Näschen aus und ein. Dann erhob sie sich, stellte das Kaninchen auf ihre linke Achsel und sagte: „Pst, da oben bleibst jetzt hocken und muckst dich nicht!“ Darauf fand sie reife Erdbeeren, pflückte dieselben in ihr Körbchen, und das Thierchen saß wirklich ganz ruhig auf ihrer Schulter, nur daß es ein klein wenig an dem feuchten Lockenhaar nagte und zupfte und dabei recht aufgeweckt seine langen Ohren spitzte.
Als Gudwella endlich dem Thale des Klosters zuhüpfte, hatte sie ihre tollwitzige Laune vollständig wieder gewonnen und versuchte, ob das Kaninchen zur Feier ihres Einzuges in die geweihten Mauern denn nicht auf dem Scheitel ihres Hauptes hocken wolle. Und richtig, mit solch’ lebendigem Haarschmucke schritt nun das Mädchen schalkhaft bedächtig in das Refectorium ein, in welchem die graue Gemeinde der Nonnen bereits beim Mahle zusammen saß.
Jetzt aber erhob sich eine ältere Schwester von ihrem hochlehnigen Sessel, winkte, ohne auch nur ein einziges Wörtchen zu sagen, dem Mädchen zu, umzukehren, und trieb dieses in wahrer Form zur Thür hinaus.
Einige Stunden später saß Gudwella auf dem Sünderbänklein in der grauen Halle; und alle Schwestern waren in diesem Raum versammelt, aber jede hielt sich fern von der weltlustvollen Tochter des Wolf im Hag, über die nun das Gottesgericht hereinbrechen sollte.
Bald kam die Oberin herangeschwebt; sie hielt ihr betagtes Haupt aufrechter, als sonst; ihre linke Hand legte sie an die Brust, über welche ein goldenes Kreuz hing, die Rechte hielt sie etwas gehoben, um mit derselben den Gruß zu winken. Gemessen und streng stand sie nun da. Noch hatte sie keinen Blick auf das Mädchen geworfen, das auf der Sünderbank saß und nicht recht wußte, was es heute für ein Gesichtchen ziehen, ob es ausnahmsweise einmal ganz ruhig und feierlich sitzen bleiben, oder ob es sich behendig erheben und der Aebtissin ihre heiteren und zierlichen Grüße machen sollte.
Die Oberin wendete sich an die Reihen der Nonnen und hub an so zu reden: „Liebwerthe Schwestern! Wir hatten gehofft, eher in das Grab steigen zu dürfen, als ein Unglück zu erleben, wie ein solches über unser gottgeweihtes Haus hereingebrochen ist. Wohl war uns seit geraumer Zeit schon bekannt, daß ein Weltkind in unseren Mauern weile, für dessen Heil wir stets den Segen des Himmels erflehten; aber wir haben nicht gewußt, daß eine gefährliche Sünderin in unserer Mitte lebe, die, weil mit mancher bestechenden Eigenschaft ausgestattet, leichtlich Verderben und das schrecklichste Unheil über unsere theuere Gemeinschaft bringen könnte. Gottes Rathschluß hat uns aber die Gefahr gnädigst aufgedeckt, freilich durch ein Vorkommniß, das wir tief bedauern, durch ein Aergerniß, das uns erschüttert hat. Möge das gedachte Wesen Gott danken, daß es noch nicht die ewige, sondern[S. 377] vormal nur die irdische Strafe ist, der es anheimgefallen. Die Satzungen unseres heiligen Ordens haben für eine so gröbliche Uebertretung der Tugend kaum eine Sühne, sondern den unmittelbaren Ausstoß aus unserem Hause. Da wir aber zu Gott hoffen, daß er das so junge, leichtfertige Weltgeschöpf noch erleuchten werde, so wollen wir demselben Gelegenheit geben, sein schweres Fehl in unseren Mauern zu büßen. Wir ordnen zu Recht, daß die Novize, Gudwella genannt, die Tochter des Wolf im Gehage, vom Feste der Apostelfürsten Petrus und Paulus an drei Tage und drei Nächte hinter zweifachen Thüren in die stille Herberge verschlossen werde.“
Ein Schauern ging durch den Kreis der Schwestern, und selbst Natalia, die Jungfrau mit dem Härchen, erblaßte.
Die stille Herberge, das war kein trauter Ort, das war eine Kammer unten im alten, verlassenen Meierhofe, der am Rande des Gottesackers stand, in dem die alten Rüst- und Folterwerkzeuge aufbewahrt lagen, in dem das Beinhaus und auch die Wohnung des Todtengräbers war. Die stille Herberge, die zudem noch mit gar seltsamen Geräthen ausgestattet war, diente dem Kloster Taubenzell zur Bußkammer. Der Meierhof stand eine Strecke abseits vom Kloster in einem verwilderten Hain von Erlen, Birken und blassen Weiden.
Als Gudwella gemerkt, daß sie der Gegenstand der Versammlung im grauen Saale war, hatte sie sofort sehr aufmerksam der Rede der Oberin zugehört, und war wirklich ein wenig erschrocken, als von einer Sünderin verlautet wurde, die in die stille Herberge müsse. Sie kannte die stille Herberge vom Vorübergehen; da hatte sie einmal durch das Gitterfensterchen hineingeguckt und aus Vorwitz laut gefragt, ob Niemand daheim sei, bis sie einen offenen Sarg gesehen, der für die Büßerinnen als Bettstatt bestimmt war.
„Je, dies Bett wär’ mir viel zu klein!“ hatte sie hierauf hell gerufen und war davongehüpft. –
„Ist das, weil ich mich oben im Wald gebadet habe?“ fragte jetzt die verurtheilte Novize eine Nebenstehende, die aber sogleich zurückwich und keine Antwort gab.
„Ehrwürdige Frau Oberin“, sagte Gudwella hernach zur Aebtissin, die auf ihrem Platze noch stehen geblieben war, „warum zu Peter und Pauli erst? Muß es schon sein, so will ich gleich in den Kotter hinein, daß ich bald wieder herauskommen kann.“
Ueber diese Bemerkung war ein großer Theil der Schwestern entrüstet. Die Oberin richtete sich noch höher auf. Sie hatte erwartet, daß das Weltkind einen Fußfall thun und um Gnade flehen werde, die sie denn vielleicht bereit war, auch zu geben. Nun ihr aber diese neuerliche Leichtfertigkeit, dieser schier gotteslästerliche Trotz entgegentrat, war sie sofort fest entschlossen, das strenge Urtheil, wie es noch selten zu Taubenzell gefällt worden, an Gudwella auszuführen.
Nun vergingen noch der Tage sechs, da war Peter und Paul. Von den betagtesten drei Schwestern wurde die Tochter des Wolf im Hag zum Meierhof geleitet, von dem nur das finstergraue Giebeldach über das hochwuchernde Baum- und Buschwerk emporragte.
Der Todtengräber, ein alter, vierschrötiger Mann, mit Knochen so knorrig und wuchtig, als hätte er dieselben im alten Beinhause eigens für sich herausgemustert, hatte bereits von Allem Kenntniß, über Alles Auftrag. Der nahm nun die Jungfrau an der Hand, blickte ihr mit seinen grauen, alterstrüben Aeuglein in das Antlitz und murmelte: „Beim Kreuz, das ist einmal eine Sünderin, die sich gewaschen hat!“ Und er führte sie durch einen niedrigen Thorbogen, an dem der[S. 379] Epheu rankte, führte sie durch einen öden Hof, in welchem dort und da ein Fensterlein mit eisernen Balken war, aus dessen weiten Fugen aber nichts als graue Heuhalme hingen. Dann führte er das Mädchen einen finsteren Gang entlang, schloß ein Thor auf und hinter sich wieder zu, führte das Mädchen durch einen zweiten Gang, in welchem Holzmodergeruch wehte, schloß endlich wieder ein Thor auf und sagte: „Nichts für ungut, ich hab’ das Stüblein recht gelüftet; da sind die Bücher, da ist der Betschemmel, da ist das Lager, da ist das Brot; das Wasser werde ich noch bringen.“
Die Flügelfenster mit den kleinen, sechseckigen Scheibchen standen offen; vor dem Eisengitter fächelten die thauigen Zweige einer Birke, zwischen denselben war die Aussicht auf begraste Hügel, über welchen braune und graue Holzkreuzlein ragten. Die Bücher, welche auf einem altarartigen Tischchen lagen, bestanden aus Erbauungsschriften, geziert mit Kupfern aus der Leidensgeschichte der Heiligen. Der Betschemmel war ein eckiger Stein, der aus dem Boden ragte. Als Bettstatt diente ein Sarg, der so grau und wurmstichig war, daß man auf die Vermuthung kommen konnte, er habe schon drei Jahre lang unter der Erde gestanden. Das braune Laibchen des Brotes war das Einzige, was freundlich an das Leben gemahnte. Der irdene Wasserkrug war nun auch herbeigeschafft worden; der Todtengräber sagte: „Drei Tage werden vergehen, wie die siebenundvierzig Jahre vergangen sind, die ich in diesem Hause verlebe. Hab’ manch’ Andere hier hereingeführt, in deren Haut nicht Jede stecken möchte; Ihr ergötzt Euch leichtlich mit Euch selber, luget in den Wasserkrug.“ Sagte es, verschloß die Pforte und schlich durch den hallenden Gang davon.
Kaum war Gudwella allein, so streckte sie die Hand aus dem Fenster, riß einige Birkenzweige ab und schmückte damit ihr Haar sowohl, als auch ihre unheimliche Lagerstatt. Dann blickte sie im Gemache umher, fand aber nichts als die grauen Wände; auf dem bestaubten Ofen lag ein bestaubter Todtenschädel, den schlug sie mit einem Birkenzweig herab, daß er über den Boden kollerte, dann rief sie: „Oho! Hast dir weh gethan!“ Sie wollte den Schädel zum Fenster hinauswerfen, allein das eng geflochtene Gitter ließ ihn nicht durch; da sagte Gudwella: „Siehst du, jetzt haben sie dich auch eingesperrt, und jetzt halten wir zusammen.“
So hatte das Mädchen in der stillen Herberge die erste Bekanntschaft gemacht. Ihr natürlicher Humor, der gute Geselle, war mit ihr in das Gefängniß gegangen; freilich hatte er eine etwas andere Farbe und Tonart, wie da draußen im freien Wald; aber der Schalk war es doch noch immer. – Schließlich wand Gudwella dem Knochenschädel ein Birkenkränzlein um die Stirne: „Könntest ja mein Bräutigam geworden sein, wenn du nicht wahrscheinlich eine tugendsame Klosterfrau gewesen wärest....“
Aber für die Länge unterhält sich’s mit einem Todtenkopf nicht recht possirlich, und als der Tag vorüberging und von der reichen, heiteren Welt draußen nicht einmal eine Mücke zum Fenster hereingeflogen war, dachte Gudwella an das Wort des Todtengräbers: „Ihr ergötzt Euch leichtlich mit Euch selber, luget in den Wasserkrug!“ – Im Wasserkrug war Wasser: sie lugte doch hinein, ob der gute Mann nicht etwa süßen Meth in denselben gethan habe. Es war Wasser, jedoch, im dunklen Spiegel desselben war ein rosig’ Köpfchen gezeichnet und gemalt – ihr eigen’ Angesicht lächelte ihr entgegen und zeigte die weißen Zähnchen und die hellen Aeug[S. 381]lein und das zierliche Näschen, das glatt und sauber war über und über, und auf dem kein böses Haar stand. – Das machte ihr vielen Spaß, und sie blies in den Wasserspiegel, daß alle Theile des Gesichtchens wie Quecksilber zitterten, und darüber lachte sie hell und ergötzte sich.
So war der erste Tag vergangen. Aber die erste Nacht? Im Sarge lag Stroh: Gudwella warf es nicht heraus, um sich auf dem kalten Boden ein Lager zu bereiten. „Vor dir fürchte ich mich schon lange nicht“, hatte sie zum Sarge gesagt, „du bist auch im grünen Walde gewachsen, wie ich.“
In der Abenddämmerung blickte sie noch hinaus in das Freie, wo Fledermäuse flatterten und Johanniswürmchen schimmerten. Zwischen den Kreuzen huschte es wie eine dunkle Gestalt dahin....
Gudwella schloß das Fenster.
Der Edelknabe hieß Rodam. Er war ein Sohn der ritterlichen Krimburger und hatte sich bislang im Kerngulder Schlosse als Page der Jugend erfreut. Er hatte hier die Feinheit und Sittigkeit der Frauen und die Tapferkeit und den Edelmuth der Männer gesehen. Er hatte der schönen Schloßfrau den Becher goldbraunen Methes kredenzt, er hatte dem Herrn das funkelnde Schwert an die Seite geschnallt. Er hatte die Armbrust im Walde geführt, er hatte gelernt, das feurige Roß zu zähmen. So hatte es sein Herr Vater gewollt und freute sich seines kräftigen und wohlgestalteten Sohnes, der nun im Kerngulder Schlosse zum Ritter geschlagen in die heimatliche Burg zurückkehren sollte.
Inzwischen jedoch ereignete sich die Geschichte, die hier erzählt wird.
Am Vortage seiner Ritterweihe zog Rodam noch durch den Wald, durch den er so oft gewandelt und geritten war, und von dem er nun Abschied nehmen sollte. So kam er auch zur schattigen Schlucht und zur Wassertiefe, in die er seinen Leib so oft getaucht hatte. Das wollte er auch heute noch einmal thun: die Knabenschaft soll weggeschwemmt, der junge Ritter soll getauft sein in den kalten Fluthen des Waldes.
Am andern Tage aber, kaum eine Stunde danach, als das breite Schwert auf seine Schulter niedergesunken war, vernahm es Rodam bei festlichem Mahle wie eine Mär’, daß im Kloster Taubenzell eine wunderholde Jungfrau zur Gefangenschaft im Todtenhause, die stille Herberge genannt, verurtheilt worden, weil sie sich im Walde gebadet habe an der Stelle, wo vor ihr ein Jüngling im Wasser geschwommen sei.
Als Rodam diesen Bericht vernommen hatte, setzte er seinen silbernen Humpen an den Mund und trank ihn aus.
Und ehe er noch zurückkehrte in seiner Väter Burg, durchstreifte er die Gegend, um die Wahrheit des Gerüchtes zu erproben, umkreiste das Kloster, um die Jungfrau, wie sie ihm beschrieben war, zu sehen. Er sah sie nur von ferne, aber er erfuhr genau die Tage und Nächte ihrer Gefangenschaft. Da sagte er zu sich: „Minnedienst ist Ritterthat! Die Jungfrau, die vielleicht meinetwegen duldet, soll nicht verlassen sein.“
Er faßte der Pläne mehrere. Vor dem Fenster stehen und Lautenspielen zur nächtlichen Weile war ihm zu knabenhaft. Den alten Wart bestechen, wollte ihm nicht recht möglich scheinen; denn der Alte war ein ehrlicher Klotz, der brachte selbst die goldenen Ringlein, so an den ausgegrabenen Gebeinen hingen, den Erben zurück. Aber ehrliche Leute sind[S. 383] ja leichtgläubig, und weil sie nicht betrügen, so müssen sie betrogen werden, damit auch an ihnen des Lebens Gleichgewicht zur Geltung komme. –
Als jedoch am Peter- und Paulitag der Abend nahte, für den Rodam schon so Manches vorbereitet hatte, da stieg eine Nonne nieder vom Klosterhügel und begehrte bei dem alten Gräber Einlaß zur Büßerin, um dem jungen Blute die nächtlichen Stunden zu mildern und ihm Litaneien und Psalmen vorzubeten, so wie es die Oberin befohlen habe.
„Ist einmal ein vernünftig Gebaren das“, brummte der Alte, „sollte es ihr schon nach dem Psalm nicht verlangen, so wird ihr gewiß ein Plauderstündchen willkommen sein.“ Und er geleitete die Schwester durch die Gänge und Pforten in die Zelle der Jungfrau. Dann drehte er knarrend wieder die beiden rostigen Schlösser ein und schritt langsam und schier erleichterten Herzens in sein Stübchen am Haupteingange zurück.
Gudwella, die am Fenster saß, war eben beschäftigt gewesen, aus Brotkrümelchen einen Edelknaben zu kneten; nun hatte sie das Gebilde sofort zwischen sich und der Mauer hinabsinken lassen und blickte verwundert auf die eingetretene Nonne, die im Dunkeln stand und sich kaum regte.
„Ei,“ fragte Gudwella endlich, „habt Ihr auch die Tugend verletzt, daß Ihr hier seid?“
„Ich habe mich auch im Waldwasser geatzt,“ versetzte die Schwester, „und darum bin ich hier.“
Gudwella stutzte. Was war das für eine Stimme? Die kannte sie nicht, die hatte sie im Kloster nie gehört; ein solcher Ton geht nicht aus Frauenmund.
„Jungfrau, ich bitt’ Euch, woll’t mich nicht verdammen,“ sagte jetzt die fremde Gestalt, „wenn es so ist, daß Ihr meinetwegen hier schmachtet, so will ich Euch zur Gesellschaft[S. 384] sein an diesem rüchigen Ort, der für ein so junges und schönes Frauenbild nicht will geschaffen sein. Ich bin Rodam, der Sohn der ritterlichen Krimburger, und selbst zum Ritter geschlagen vor wenigen Tagen im Schlosse der Kerngulder. Ich bin der Knab’, den Ihr in der Bergschlucht mögt gesehen haben, dem Ihr nachgefolgt seid und dessentweg’ Ihr der Freiheit beraubt worden. Jungfrau, ich bitt’ Euch um die Gunst, lasset mich Euer Wächter sein.“
Bei diesen Worten war der Nonnenhabit von der Gestalt niedergesunken und ein junger Rittersmann stand da in herrlicher Schönheit des Leibes und im stolzen Schmucke seiner Würde.
Die Jungfrau saß unbeweglich am Fenster. Es war in der Dunkelheit nicht zu sehen, wie sie erblaßte, wie sie zitterte und wie ihr Aug’ im Zorne glühte. Sie wollte den kühnen Eindringling von sich weisen, sie wollte um Hilfe schreien, allein in ihrer Brust wüthete ein Kampf, den sie bisher noch nie empfunden, und ihre Zunge war wie gelähmt. Endlich sank ihr Haupt und sie hub heftig zu schluchzen an.
Da sank der Ritter auf sein Knie und sagte: „Jungfrau, was soll das bedeuten? Ich versteh’ es nimmer. Ich habe mich verleiten lassen, vielleicht durch Uebermuth, vielleicht durch Eitelkeit, die dem Ritter nicht geziemt; vielleicht wohl auch, weil ich Euere holdsame Gestalt im Garten erblickt. Wie sehr Ihr angelegen mir seid – daß ich um Euretwillen der Ritterehr’ vergessen, zur List gegriffen hab’, das mag’s Euch weisen. Nun bin ich da; am Morgen, wenn der erste Fink wird singen und die Grasmücke zirpen, wird nach der Verabredung der Pförtner wieder erscheinen und die Nonne von dannen geleiten. Rodam aber wird hier auf seinem Knie ruhen die ganze Nacht und Euch anflehen um Verzeihung.“
So sprach der Jüngling. Gudwella aber hatte sich erhoben und das Lichtlein angezündet auf der rostigen Lampe. Rodam hatte eine Kohle aus der Ofennische genommen. „Jungfrau,“ sagte er, „hier mit diesem Griffel ziehe ich einen Kreis auf dem Boden um mich herum; und wenn ich einen Schritt aus diesem Kreise trete, bevor der Pförtner erscheint, so soll mich der große Gott verdammen auf Erden und bei seinem letzten Gerichte!“ Und er zog mit der Kohle einen schwarzen Ring um sich.
Das Mädchen sah ihm dabei zu, dann sagte es leise: „Ist schon recht, das ist der Zauberkreis, und wenn Ihr über denselben hinausspringt, so holt Euch auf der Stell’ der Andere mit den schwarzen Hörnern und mit der glühenden Kette!“
Es war schon wieder die Schalkheit in ihr.
So lebten sie nun; Gudwella saß am Fenster und blickte in die Nacht hinaus auf den stillen Friedhof, der von den hohen Weiden und Birken des Haines umgeben war, und über den die Sternlein des Himmels funkelten. Rodam stand in seinem Kreise wie eine Statue aus Erz; die Linke hatte er an seinen Gürtel gestemmt, in der Rechten hielt er das entblößte Schwert, das er auf den Boden stützte. Die Locken wallten ihm wild um das jugendzarte Gesicht; seine Lippen, über welchen kaum noch der schattende Hauch der Männlichkeit zu verspüren war, hielt er fest geschlossen, sein großes Auge wendete er nicht von dem Mädchen, das zu hüten und zu schützen er gekommen war.
Endlich wollte Gudwella ein wenig ruhen, und als sie sich in den Sarg niederließ, rief sie lustig wie einst durch das Fenster herein: „Je, dies Bett ist mir viel zu eng!“
Das Licht wurde nicht ausgelöscht; da könnte, schloß das Mädchen, der Rittersmann ja seinen Kreis nicht sehen und möchte leichtlich aus Zufall die Grenze überschreiten.
Draußen stand nun der Mond über den schwarzen Wipfeln des Haines, und die Kreuze warfen ihre Schatten über die thaublassen Grashügel, und es war, als ging ein silbernes Spinnengewebe über Alles.
„Geht,“ rief die Jungfrau plötzlich aus ihrem Schreine hervor, „geht, Herr Ritter, laßt Eure schauerliche Weis’ und legt das Schwert aus der Hand, das kann ich nicht leiden.“
Gelassen lehnte Rodam das Schwert an die Mauer, stand aber nichts destoweniger nach wie vor bewegungslos auf seiner Stelle.
Als es aber gegen den Morgen ging und Rodam merkte, daß Gudwella nicht schlummere, sagte er: „Jungfrau, habt Ihr Euch in dieser Nacht gefürchtet?“
„Wovor hätte ich mich fürchten sollen?“ entgegnete das Mädchen, „nicht vor den Todten habe ich mich gefürchtet, weil Ihr dagewesen; und nicht vor Euch habe ich mich gefürchtet, weil die Todten nahe sind.“
„So werde ich in der nächsten Nacht wiederum kommen, um bei Euch zu wachen.“
Auf dieses Wort hatte das Mädchen nichts entgegnet.
Nun mußte draußen schon der Fink singen und die Grasmücke zirpen, im Gange hallten die Schritte des Thorwarts. Rodam hüllte rasch den grauen Habit um, that die dazugehörige Kapuze über das Haupt, und als der Schlüssel im Schlosse knarrte, stieg er aus seinem Kreise und machte eine schier minnesame Verneigung vor der Jungfrau, die sich in ihrem leichten Kleidchen halb auf dem Lager erhoben hatte.
Der schlaftrunkene Alte führte hierauf die Nonne hinaus, schloß die Pforten; und als die letzten Schritte in den Gängen verhallt waren, da fand es Gudwella gar einsam und öd in der Kammer, genannt die stille Herberg.
Am zweiten Tag versuchte es die junge Büßerin, einen großen, roth und blaugefleckten Schmetterling durch das Fenster zu locken, was ihr aber nicht gelang; der schöne Falter setzte sich wohl an ein Birkenreis und lugte ein wenig in das Gemach; der goldlockige Mädchenkopf mochte ihm gefallen, aber die Kammer war ihm zu dunkel und so flatterte er wieder davon. Bald darauf sah Gudwella auf einem Birkenblatte eine schwarze Puppe mit hellrothen Sternchen kleben. „Wart,“ sagte sie freudig, „jetzt bekomme ich aber doch noch einen herein!“ Sie löste das Blatt behutsam ab und legte es in der Kammer auf das Tischchen. Sie legte auch noch andere Blätter dazu, deren sie vom Fenster aus habhaft werden konnte; und sie verwahrte das Püppchen sorgfältig zwischen all’ dem Grünen, und wartete nun, bis das Ding flügge werden sollte.
Es verging der Tag, es kam frisches Brot und frisches Wasser; es ließ sich die Oberin erkundigen, ob die Novize ein besonderes Bedürfniß oder ein Seelenanliegen habe; sie sandte bei dieser Gelegenheit ein Fläschchen erfrischenden Getränkes, welches die Büßerin aber mit einer etwas störrigen Bemerkung zurückschickte. Es kam auch sonst der Alte noch mehrmals in die Kammer, aber der Schmetterling schlüpfte nicht aus.
Und zur späten Abenddämmerung meldete sich wieder die Schwester bei dem Pförtner und verlangte Einlaß zur Büßerin, um dem jungen Blut die nächtlichen Stunden zu[S. 388] mildern und ihm Litaneien und Psalmen vorzubeten, wie es die Oberin befohlen habe.
Der Eintritt war ganz wie in der ersten Nacht, nur daß Gudwella diesmal den Ritter schon erwartet zu haben schien. Sie hatte ein Schnürchen in Bereitschaft, das sie vom Henkel des Fensters bis an die gegenüberliegende Wand so ziehen wollte, daß es die Kammer in zwei Theile schnitt, den einen für Gudwella, den andern für den feinen Rittersmann. Der Kohlenkreis, meinte sie bei sich, sei doch zu eng gezogen und könne gar so leicht übersehen werden in der nächtlichen Dunkelheit, wenn etwa das Oel der Lampe ausginge und das Licht verlösche.
Rodam hatte nichts dagegen einzuwenden. Er legte die Vermummung ab und konnte sich nun in dem ihm angewiesenen Raume etwas freier bewegen, als in der vorigen Nacht.
Gudwella blickte wieder zum Fenster hinaus und sagte auf einmal: „Ei, das ist doch schön, jetzt steigen aus den Gräbern die Funken auf.“
Rodam eilte, um zu sehen. Glühende Johanniswürmchen schwebten über den Hügeln. Gudwella lachte, daß sie durch ihren bildlichen Ausdruck den Ritter an’s Fenster gelockt habe. Der Jüngling, dem Mädchen einmal so nahe gekommen, wahrte seinen Vortheil, ohne jedoch im Geringsten an die Grenzschnur zu streifen.
Das Mädchen hub an zu schwätzen, erzählte vom Walde, vom heimatlichen Hofe, mischte allerlei kleine Schwänke darunter; dann aber begann es auch an den jungen Rittersmann in recht zierlicher Art unterschiedliche Fragen zu stellen, die er mit Freundlichkeit und Minne beantwortete. Dann sagte sie, wie ihm doch das schwarze, weite Wamms mit den hellrothen Schlitzen über der Brust so gut lasse, aber die[S. 389] obere Schleife, achte sie, müsse er etwas knapper ziehen. Rodam stellte sich an die Schnur und sagte: „Jungfrau Gudwella, ich kann es mit meinen Augen nicht sehen, wie mir die Schleife am Halse steht; ich bitt’ Euch daher, daß Ihr mir sie nach Eurem Ermessen zurechtrücken wolltet.“
Da hob das Mädchen die zarten Hände bis gegen das Kinn seines jungen Hüters, zog die Sammtschleife knapper, ließ sie wieder locker, daß der weiße schlanke Hals ein wenig herauslugte, und band sie dann um so fester und enger zusammen. Rodam versäumte nicht den Augenblick, als nach vollbrachtem Werke die Händchen sanken, um dieselben mit den seinen aufzufangen und minniglich zu küssen. – Dabei nun strich er freilich ein wenig an die Schnur, daß dieselbe bis an ihre Enden hin erzitterte.
Ueber den Wipfeln des Haines stand wieder der Mond und goß, trotz des trübflackernden Lämpchens das weiße Bild des Fensters mit seinen dunklen Rahmen und Gittergewinden auf den Boden der Kammer.
„O nein, Mond“, sagte da Gudwella, „mit dem bloßen Schein bin ich nicht zufrieden, ich will dein ganzes kugelrundes Leiblein bei mir im Kämmerl haben.“
Sofort stellte sie den vollen Wasserkrug an’s Fenster. „Gucket, Herr Ritter,“ rief sie, „da d’rin hockt er jetzt, der Schelm; nur zum Trinken muß man ihm was vorsetzen, gleich ist er da.“
Die ganze Mondscheibe blinkte aus dem schwarzen Grunde des Wassers.
„Ja, der hat’s gut,“ entgegnete Rodam, „der braucht nicht erst die Kleider abzulegen, wenn er badet.“
Gudwella schwieg diesmal. Sie entfernte sich ein wenig von der Schnur, und der Jüngling wog erst jetzt das aus[S. 390]gesprochene Wort, und es war ihm weh’, das reizende Kind verscheucht zu haben. Es war ihm jählings gar schwül in seiner Brust, er schlug den Fensterflügel auf und lehnte sich an die Brüstung.
„Warum thut Ihr das?“ sagte Gudwella, „Ihr müßt das Tuch über’s Haupt legen, wenn Ihr zum Fenster geht.“
„Es schreit der Nachtvogel so stark,“ sagte der Jüngling.
„Der Nachtvogel? Herr Ritter, vielleicht fliegt er herein, daß wir ihn füttern könnten,“ versetzte das Mädchen, welches alles Gethier und selbst die Nachteule um sich versammelt haben wollte. Sie eilte an das Fenster, um zu horchen; und jetzt waren da die beiden Häupter so nahe beisammen, daß Gudwella fühlte, der Rittersmann habe eine heiße Wange, daß Rodam vernahm, wie der Jungfrau das Herzchen schlug. Und da war es plötzlich dem jungen Edelmann, der rechts stand, als ob er den Vogel nur mit seinem linken Ohre höre, dem Mädchen hinwiederum schien es, als ob derselbe zur Rechten schreie – sie wendeten ihre Köpfe, und so fügte es sich, daß jählings die zwei Paar Lippen aneinander glitten....
In demselben Augenblicke hallten draußen im Gange die Schritte eines Nahenden. Es sang noch nicht der Fink, es war erst Mitternacht. Rodam schlüpfte nicht in seine Vermummung, er griff nach dem Schwerte. Gudwella aber erhaschte ein Psalmenbuch, schlug es auf und betete laut im gewohnten Litaneienton:
„Mein Leben wollten sie vertilgen in der Grube, sie legten einen Stein auf mich. Schon schlug das Wasser über meinem Haupte zusammen, ich dachte, es ist aus mit mir. Da rief ich aus des Abgrundes Tiefe, Jehova, Deinen Namen. Du nahtest Dich am Tage, als ich Dich um Hilfe[S. 391] flehte, und sprachst: Fürchte Dich nicht! Du, Herr, führtest die Sache meiner Seele, Du rettetest mein Leben!....“
Als der alte wachsame Todtengräber vor der Thür hörte, daß die Büßerin so bete, und also Alles seine Ordnung haben werde, ging er wieder davon. Gudwella aber erschrak baß über das Klagelied des Jeremias, durch welches sie zufällig ihre eigene Herzensstimmung dem Rittersmanne vorgesungen hatte. – Ihre Seele zitterte, ihr Gemüth war schwer. Ohne noch ein Wort zu sagen, legte sie sich in ihren Schrein.
Rodam stand an der Markschnur, die von der Bewegung bei dem vorigen Ereignisse kaum noch zur Ruhe gekommen war, und seine Gestalt sah wieder einer ehernen Statue gleich; nur sein offenes Antlitz war geröthet, und sein großes, dunkles Auge glühte und wollte sich von der lieblichen Schläferin nimmer wenden.
Draußen jauchzte noch zweimal die Nachteule; des Mondes blasse Tafel auf dem Boden hatte sich gar seltsam gegen den Sarg hin verschoben. Das matte Licht der Lampe war verloschen.
Endlich sang der Fink, zirpte die Grasmücke; der alte Wart kam und geleitete die fromme Schwester von dannen. Und als Gudwella erwachte, war sie allein.
Am dritten Tage ließ die Aebtissin der jungen Novize sagen, sie und alle ehrwürdigen Schwestern seien erfreut, daß Gudwella so geduldig und standhaft in ihrer Buße verharre, und man bete für sie, daß sie auch noch den letzten Tag und die letzte Nacht in christlicher Ergebenheit zubringe, auf daß sie rein und gerechtfertigt in die heiligen Mauern des Klosters zurückkehren könne.
Es war dem Stifte viel gelegen an diesem Weltkinde, welches, wenn auch launig, übermüthig und ausgelassen, doch sein irdisch’ Gut der himmlischen Gemeinde zum Opfer brachte. Die bösen Begierden erachtete man durch die stille Herberge wohl als gebrochen; und so wurde erwartet, daß Gudwella, die in dieser Sache weder an ihrem strengen, gottesfürchtigen Vater, noch an einem anderen Freund oder Verwandten eine Zuflucht hatte, nach Verlauf des Probejahres den bindenden Segen, der sie bis zum Tode an das Haus des Friedens fesseln soll, dankbar annehmen werde.
Darum wurden dem Mädchen am dritten Tage seiner Gefangenschaft die obigen gütigen Worte gesagt. – Zwei Schwestern hatten sie gebracht, waren aber bald wieder aus dem unheimlichen Gemache davongegangen. – Die haben es eiliger, als die brave Nonne, die zur Nachtzeit kommt, um der armen Büßerin christliche Beistandschaft zu leisten – hatte sich der Pförtner gedacht.
Dann hatte der Alte der Gefangenen wieder die nöthigen Dinge gebracht, und hatte schließlich gefragt, ob noch Oel in der Lampe, worauf Gudwella „ja“ geantwortet, und hatte die Zelle verlassen.
An diesem Tage waren zwei Hummeln in das Kämmerlein geflogen, hatten um das Haupt des Mädchens eine Weile herumgeläutet, hatten hierauf Hochzeit mit einander gehalten.
Der Schmetterling unter den Birkenblättern aber hatte sich noch immer nicht entpuppt, und das Mädchen blickte sehnsüchtig in den sonnigen, blühenden Tag hinaus, in welchem überall das Leben spann und klang. Die Hügelchen schienen sich nach und nach zu ebnen, selbst die hölzernen Kreuze morschten und sanken der Erde zu, während aus dieser Halm um Halm, Blüthe um Blüthe in reicher Fülle sproßte.
Endlich kam auch des dritten Tages Abend und mit ihm die Nacht. Bei dem Pförtner meldete sich wieder die Klosterfrau, im Kämmerlein erschien der Ritter.
Er grüßte minniglich, sie dankte fein. Er hob ihre weiche Hand zu seinen Lippen, sie lächelte mild. Sie war heute nicht übermüthig und sie war nicht verzagt; sie war der Jungfrauen holdeste – sie dankte süß, daß er gekommen.
Sie hatte heute keine Schnur gezogen, und auch der Kohlenkreis war verwischt. Als sie die Lampe wollte anzünden, war kein Oel darin. Also bat sie den jungen Rittersmann, daß er auch in dieser Nacht, wie in den vorhergehenden Nächten, ihr tugendsamer und treuer Hort verbleiben möge.
„Meine liebholde Jungfrau,“ antwortete der Jüngling, „Rodam hätte Euch Folgendes zu sagen: Seines Vaters Landgüter sind groß, aber sie haben ihre Grenzen ringsum, und diese Grenzen sind mit Marksteinen besetzt, auf daß der Landmann und der Hirt und der Jäger weiß, wie weit sich das Reich erstrecke. Und so muß auch, schöne Jungfrau Gudwella, Rodam’s Reich in Euerem Gemache eine sichtbare Schranke haben, über die er nicht greifen darf, innerhalb derselben er aber schalten und walten mag nach Lieb’ und Lust. – Ihr seht, mildreiche Maid, dort über den Weiden steht der Mond; er legt seine lichte Tafel auf den Boden dieses Kämmerleins; wollet Ihr es erlauben, daß ich Besitz nehme von diesem hellen Viereck und darin verbleibe die ganze Nacht, und darin schalte und walte nach meinem Belieben?“
„Das will ich Euch gerne gestatten, mein höflicher Rittersmann,“ versetzte Gudwella gemessen, „die Zelle ist nicht groß, und es mag mich daher sehr freuen, daß Euere Ansprüche so bescheiden sind.“
Sie hatte erwartet, daß sich wieder Gelegenheit bieten würde, an seiner vielleicht etwas lockeren Bekleidung Einiges zu ordnen. Nun er dort am Ofen wie eine Bildsäule stand und stehen sollte, war an derlei nicht zu denken.
Gudwella hatte von seiner und ihrer Tugendlichkeit einen hohen Begriff, und dachte an nichts, und wußte von nichts, was es außer derselben etwa noch geben könnte. Aber darin war ihre Weltanschauung im Klaren, daß allzu große Bescheidenheit den Rittersmann nicht ziere. Sie that schweigend ihr Oberkleid ab und legte sich in das bereits völlig traulich gewordene Bettlein. Sie löste ihr Haar, sie legte ihren Arm unter das Haupt; dann rührte sie sich nicht mehr, betete still, träumte, schlief endlich ein. –
Rodam aber stand, stets seines Ritterwortes eingedenk, auf dem silberig schimmernden Viereck. Gar still war es im Kämmerlein und draußen, und das freundliche Rund des Mondes zog so langsam über den Wipfel des Haines dahin.
Einmal bewegte sich die Jungfrau ein wenig und hauchte träumend ein süßes Wort.
Rodam sah zum Boden nieder, auf dem sein helles Reich sich still und sachte der mitternächtigen Himmelsgegend zu bewegte.
Es war eine schwüle Nacht; Rodam mußte am Kinne seine Schleife lockern und sein schwarzes Wamms mit den hellrothen Schlitzen über der Brust. Die reichen Locken seines Hauptes waren ein wenig feucht; einzelne Härchen regten sich und zitterten wie im Hauche eines südlichen Lüftchens. Wer es gesehen hätte: aus den Spitzen dieser Lockenhaare haben blaue, glanzlose Flämmchen gezuckt zur selbigen Stunde.
Rodam dürstete nach einem Schluck Wassers, allein von seiner Stelle aus konnte er den Krug nicht erreichen. Die[S. 395] Spitzen seiner Finger waren kalt, er legte sie an die Stirne, an die glühenden Wangen, an die lechzenden Lippen.
So verging Stunde um Stunde in heißer Glut und in stiller Ruh’. Und als die Mitternacht und ein halb’ Stündchen noch verflossen war, da ereignete es sich, daß Jungfrau Gudwella plötzlich vom Schlummer emporfuhr und einen schweren Schreckhauch that.
Die Augen schlug sie auf, da sah sie über sich das helle silberperlende Rad – und die Tafel des Mondes lag auf ihrem Schreine....
In demselben Augenblicke aber schob sich ein Wolkenstreifen, der lange schon am nächtlichen Himmel stand, vor den Planeten; tiefer Schatten stand im Kämmerlein allerwärts. – Der Jüngling hatte keinen eigenen Boden mehr unter seinen Füßen. Das lichte Bereich war verloren. – – –
Am Morgen, als Rodam wieder davon war, flatterte ein buntes Flämmchen im Kämmerlein umher. Der Schmetterling hatte sich entpuppt.
Und als die Sonne aufging und das Glöcklein schallte oben in der Kapelle des Klosters, da kamen der Schwestern sieben, um die standhafte Büßerin aus ihrem düsteren Gewahrsam zu befreien.
Gudwella schritt mit blassem Antlitz und gelöstem Haar aus der Zelle, und ihr Auge senkte sich demuthsvoll zur Erde.
Da war es zur Stunde, daß der alte Thorwart und Todtengräber einen heiseren Ruf der Ueberraschung ausstieß.
Auf einem hohen, wildschnaubenden Hengste kam herangeritten, genau nach Mannesart im Sattel sitzend, die Schwester im grauen Habit, welche die drei Nächte hintereinander gekommen war, um der Büßerin, dem jungen Blut, die nächtlichen Stunden zu mildern.
Und in einem kühnen Satze sprang diese Nonne jetzt vom Roß, weithin flatterte der Habit auf den Sand und ein schmucker Ritter stand da, dem Alten drei schwere Goldstücke in den Hut werfend – als Schlüsselgeld.
Dann, als die sieben ehrwürdigen Frauen mit der jungen Büßerin herankamen, stellte sich der Rittersmann trotzig ihnen in den Weg, begehrte in kühner Sprache, daß man anhalte und ihn höre, und warb dann schön und minniglich um die junge Maid Gudwella.
Und die junge Maid schlug entzückt ihr Auge auf und sah im strahlenden Tageslichte die Anmuth und Herrlichkeit ihres vielgetreuen Hüters. Mit züchtigem Schritt abwendete sie sich von den sieben würdigen Schwestern und legte ihre Hand in die des Ritters.
Im Niedergange stand die blasse Scheibe des Mondes; im Aufgange aber loderte das Flammenrad der Sonne, voll ewiger Majestät verkündend: „Das Leben siegt!“

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.
Peter Rosegger.
Ein Beitrag zur Kenntnis seines Lebens u. Schaffens.
Von Hermine und Hugo Möbius. Ca. 9 Bogen in Lexikon 8o, reich illustriert mit verschiedenen Beilagen; elegant kartoniert. Preis M. 3.50.
Der Inhalt zerfällt in: I. Roseggers Leben (Jugendzeit in Alpl, Handwerkerzeit in der Waldheimat, Studienzeit in Graz; sein Leben in Graz und Krieglach, Rosegger als Vorleser, seine religiösen Anschauungen, die Heilandskirche und das Waldschulhaus, Roseggers 60. Geburtstag). II. Roseggers Werke: Charakteristik des Dichters, Einführung in seine Werke (Besprechung der Hauptwerke, der kleineren Erzählungen und Schilderungen, der Schriften in steirischer Mundart). III. Aufzählung der Werke und vollständiges Inhaltsverzeichnis derselben (alphabetische Reihenfolge der mehr als 1300 verschiedenen Erzählungen etc.) – Eine Fülle von interessanten Illustrationen, die zum Teil noch nie veröffentlicht wurden, werden dem Werk zur besonderen Zierde gereichen; der Preis ist ein außergewöhnlich niedriger.
Leipz. N. N. sagen u. a.: Ein zuverlässiger Führer ist das vorliegende Buch in jedem Falle. Und es liest sich gut. Auch zu Geschenkzwecken dürfte es sich seiner geschmackvollen Ausstattung wegen gut eignen.
Pädagog. Brosamen: Das ist ein wunderhübsches Buch nach Inhalt und Ausstattung, ein höchst empfehlenswertes Geschenk! Wie sehr mir das Buch gefallen hat, erhellt wohl daraus, daß ich das Buch ohne abzusetzen, durchgelesen habe.
Neues Wiener Tageblatt: Reich an Schilderungen und Charakteristik ist dieses Rosegger-Buch und wert, von jedem gelesen zu werden, der den Dichter liebt, so wie er es verdient, geliebt zu werden.
Peter Rosegger und die steirische Volksseele
von Ernest Seillière. Autorisierte Übersetzung von J. B. Semmig.
In eleganter Ausstattung M. 2.50.
Diese kritische Studie, die zuerst in der angesehensten Monatsschrift Frankreichs, der Revue des deux Mondes, erschien, hat in literarischen Kreisen berechtigtes Aufsehen erregt. Sie beschäftigt sich mit der Person und den Werken des Dichters in so eingehender und liebevoller Weise, wie dies bisher überhaupt noch nie geschehen, und zwar nicht blos vom poetischen und moralischen, sondern ganz besonders vom religiösen Standpunkte aus. In Deutschland wird diese Schrift um so mehr interessiren, weil es gerade ein Franzose ist, der Rosegger mit solcher Hingebung studiert hat. Noch mehr, Seillière ist überzeugter Katholik, und trotzdem liebt er den Dichter, von dem er selbst zu seinem Leidwesen bekennen muß, daß er in vieler Hinsicht auf einem ganz anderen Standpunkt steht als er. Das Eintreten des bedeutenden französischen Literarhistorikers für den steirischen Poeten wird diesem sicher zu weiterer Anerkennung verhelfen und ihm die Bahn für seinen Eintritt in die Weltliteratur ebnen.
Verlag von L. Staackmann in Leipzig.
Schriften von Otto Ernst
Letzte Erscheinung:
Vom geruhigen Leben
Humoristische Plaudereien
über große und kleine Kinder.
Buchschmuck von Max Dasio.
Dreizehntes Tausend
175 Seiten auf imitt. Büttenpapier
Preis brosch. M. 2.50
In Originalband M. 5.50

Preßstimmen-Auszüge:
Victor Blüthgen in der „Deutschen Monatsschrift“:.... Eine behaglich idyllische Stimmung liegt drüber, und man verfolgt eine sichere, vornehm formende Poetenhand, die gutlaunig-breit mit Hausweisheit und Kindern spielt... vor allem das mittelste gehört zu dem drolligsten und anmutigsten, was je aus dem Kinderleben in die Literatur übergegangen ist....
„Leipziger Lehrerzeitung“:.... Und nun kommen die Plaudereien, wie sie bis jetzt nur Ernst geschrieben hat, herzerquickende Plaudereien über einfache Vorgänge und Beobachtungen in der Familie.... Das Werk ist reich an eigenen Gedanken; Herzblut pulsiert in den Worten und ein wahrer Humor gibt überall die rechte Würze....
„Die Woche“, Berlin, schreibt in Nr. 23 vom 6. Juni u. a.: Ein köstliches kleines Wesen (Appelschnut) leibhaftig und wirklich bis in die Fingerspitzen, hat der Dichtervater in dieser Gestalt, getroffen. –
„Berliner Zeitung“: Ein neues Buch von Otto Ernst ist mir wie ein froher Festtag. Ich glaube, wir haben heute gar keinen besseren Humoristen und Satiriker als wie Otto Ernst.
Offenes Visier! Gesammelte Essays aus Literatur, Pädagogik und öffentlichem Leben.
Brosch. M. 3.–, geb. M. 4.–.
Buch der Hoffnung. Neue Folge der gesammelten Essays. 2 Bände.
Bd. 1 brosch. M. 3.–, geb. M. 4.–.
Bd. 2 brosch. M. 4.–, geb. M. 5.–.
Aus verborgenen Tiefen. Novellen und Skizzen.
Brosch. M. 3.–, geb. M. 4.–.
Der süße Willy. Ein humoristisches Erziehungsidyll. In elegantem Umschlag.
M. 1.20.
Narrenfest. Satiren und Burlesken.
Brosch. M. 2.–, geb. M. 3.–.
Kartäusergeschichten. Novellen und Skizzen.
Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.
Die Gerechtigkeit. Komödie des Revolver-Journalismus. 4. bis 6. Tausend.
Br. M. 2.–, geb. M. 3.–.
Flachsmann als Erzieher. Komödie. 21. Taus.
Brosch. M. 2, geb. M. 3.–.
Jugend von heute. Komödie. 10. Taus.
Brosch. M. 2.–, geb. M. 3.–.
Die größte Sünde. Drama. 7. Taus.
Brosch. M. 2.–, geb. M. 3.–.
Ein frohes Farbenspiel. Humoristische Plaudereien. 11. u. 12. Taus.
Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.
Gedichte. Der neuen Gedichte 2., der. Ged. 3. Aufl.
Br. M. 2.50, geb. M. 3.50.
Stimmen des Mittags. Neue Dichtungen.
Brosch. M. 2.50, geb. M. 3.50.
Otto Ernst. Eine literarische Studie von Johannes Schumann.
M. 1.–.
Verlag von L. Staackmann in Leipzig.
Weihnachts-Novitäten 1905:
Ernst, Otto, Besiegte Sieger. Novellen u. Skizzen. 3. vielfach veränderte Auflage der „Verborgenen Tiefen“. Brosch. M. 3.–, Gebund. M. 4.–.
Ertl, Emil, Die Leute vom blauen Guguckshaus. Roman. Brosch. M. 4.50, eleg. geb. M. 6.–.
Geissler, Max, Hütten im Hochland. Roman. Mit Buchschmuck von Felix Schulze. Brosch. M. 4.–, eleg. geb. M. 5.–.
Ginskey, Franz Carl, Das heimliche Läuten. Gedichte. Mit Buchschmuck von Alfred Keller, Wien. Brosch. M. 2.–, eleg. geb. M. 3.–.
Greinz, Rudolf, Im Herrgottswinkel. Lustige Tiroler Geschichten. Brosch. M. 3.–, eleg. geb. M. 4.–.
Im Laufe des Jahres erschienen:
Ernst, Otto, Asmus Sempers Jugendland. Der Roman einer Kindheit. 16.-20. Tausend. Broschiert M. 3.50, eleg. geb. M. 4.50, in Liebhaberhalbfranz M. 6.–.
Ernst, Otto, Der süsse Willy. Geschichte einer netten Erziehung. 8.-12. Taus. Mit Umschlagzeichnung v. Arpad Schmidhammer. Kartoniert M. 1.–.
Ertl, Emil, Opfer der Zeit. Novellen. 2. Auflage. Brosch. M. 3.50, eleg. geb. M. 4.50.
Geissler, Max, Das Moordorf. Ein Kulturroman. 3. und 4. Tausend. Mit Federzeichnungen von J. v. Eckardstein. Brosch. M. 5.–, eleg. geb. M. 6.–.
Greinz, Rudolf, Marterln und Votivtaferln des Tuifelemalers Kassian Kluibenschädel. Mit vielen launigen Zeichnungen von Arpad Schmidhammer. Eleg. kart. M. 3.–.
Nora, A. De, Sensitive Novellen. Umschlag von Ad. Münzer. Brosch. M. 2.50, eleg. geb. M. 3.50.
End of the Project Gutenberg EBook of Da Buch der Novellen. Erster Band, by
Peter Rosegger
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DA BUCH DER NOVELLEN. ERSTER BAND ***
***** This file should be named 63498-h.htm or 63498-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/6/3/4/9/63498/
Produced by the Online Distributed Proofreading Team at
https://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.